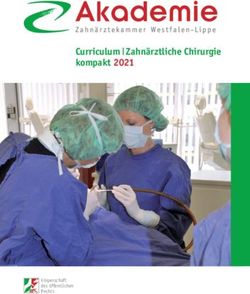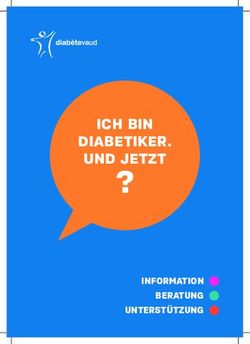40 Jahre Kinderintensivstation, Mainz
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
40 Jahre Kinderintensivstation, Mainz Veröffentlicht in: Die Kinderkrankenschwester 03/2006 Jg. 25 40 Jahre interdisziplinäre Kinderintensivstation in Mainz, ein Anlass für die beiden Organisatoren Ralf G. Huth (leitender Oberarzt) und Irene Harth (Fachkinderkrankenschwester), ein Jubiläumssymposium zu organisieren und viele Kollegen und Kolleginnen nach Mainz einzuladen. In Mainz wurde 1965 die erste Kinderintensivstation in Deutschland eingerichtet. Prof. Dr. Dr. hc. Jüngst ging in seinem sehr persönlich gehaltenen Vortrag auf die Anfänge und Entwicklung von pädiatrischer Intensivmedizin und Pflege ein. Er berichtete, dass 1962 das erste "Frühgeborenenhaus" (mit Balkon für die Besucher!) entstand. Und für uns heute unvorstellbar, war es in den Jahren 64/65 ein großer Einschnitt, dass Eltern ihre Kinder auf der Intensivstation besuchen durften. 1965 wurde dem damaligen Direktor der Kinderklinik, Prof. Dr. Ullrich Köttgen, ein Neubau wegen Ablehnung eines Rufs nach Frankfurt genehmigt. Der Fertigbau war als Provisorium für ein Jahr gedacht, beherbergte dann aber über 30 Jahre eine der angesehensten Kinderintensivstationen in Deutschland. In Mainz, so berichtete Prof. Jüngst, fand auch das erste Symposium für pädiatrische Intensivmedizin im Jahr 1970 statt. Hier wurde zudem die 1. Fachweiterbildung für pädiatrische Intensivpflege ins Leben gerufen. Wie der Präsident Prof. Devictor erläuterte, gehört zur Historie auch, dass ESPIC (European Society of Paediatric Intensiv Care) vor 20 Jahren in Mainz gegründet wurde. Mittlerweile gehören Ärzte und Pflegekräfte aus 66 Ländern zu dieser Gesellschaft. Auf dieser Tagung wurde aber nicht nur zurückgeschaut. Ralf G. Huth und Irene Harth hatten ein Programm zusammengestellt, in dem alle pädiatrischen Themenkomplexe kompetent und interessant aus den Blickwinkeln der verschiedenen Berufsgruppen beleuchtet wurden. Es begann mit dem Fachgebiet der Kinderkardiologie und Kinderkardiochirurgie. PD. Dr. Kampmann wies darauf hin, dass angeborene Herzfehler mit 1,2 % die größte Gruppe aller angeborenen Fehbildungen darstellen. Von 1996 bis 2004 wurden in Mainz 1800 Interventionen durchgeführt, 85% davon ohne Narkose und Intubation. Die Fortschritte in der Kinderkardiologie, so Kampmann, seien sicher nur durch die Implementierung einer solchen Einrichtung wie einer Kinderintensivstation möglich. Durch die gewonnen Erfahrungen sei es jetzt möglich, die Intensivbehandlungstage zu reduzieren, aber auch neue Indikationen und Techniken mit Hilfe der Intensivmedizin zu stellen bzw. durchzuführen.
Prof. Heinemann ging eindrucksvoll auf die absolut notwendige, gute Kommunikation zwischen Kardiologen und Kinderkardiochirurgen ein. Er stellte aber auch die problematische Rolle des Intensivmediziners dabei dar. Kompetenzen müssen klar definiert sein. Auch in den nächsten beiden Vorträgen ging es, wie Prof. Schranz sagte, um die "kollegiale Verantwortung". Er, der nach eigenen Angaben "in der sog. Baracke nicht gearbeitet, sondern gelebt hat", stellte neue Therapiestrategien vor. Ein ehemaliger Mainzer (Humpel), der jetzt in Toronto tätig ist, stellte die Bedeutung von Standards und Behandlungskonzepten heraus. Dabei erfuhren die Zuhörer Neues von der Behandlung mit Iloprost- Inhalation und der Gabe von Viagra© bei der Behandlung der pulmonalen Hypertension. Beeindruckend war in diesem Zusammenhang ein Bild eines Patientenzimmers in Toronto mit drei ECMO- Patienten. Die erste große Nachmittagssitzung behandelte die Themen Organversagen und Organspende. Dr. Sasse berichtete, dass weltweit 1400 Patienten täglich an einer Sepsis versterben, 25% davon auf einer pädiatrischen Intensivstation. Die Besonderheiten der Pädiatrie betonte er eingehend. Aus Paris kam Prof. Devitor, der über Indikationen, Therapieaussichten und neue Behandlungsmethoden, wie z.B. der MARS©- Therapie, berichtete. Über den Stand der Lebertransplantation(LTX) in Hannover (MHH) informierte die Kinderkrankenschwester Tönsfeuerborn. 1984 wurde in Hannover die erste Splitlebertransplantation durchgeführt, 1989 die erste Leberlebendtransplantation. Bisher wurden 399 LTX im MHH gemacht mit einer Überlebensrate nach einem Jahr von 90 %. Alle Organe werden über Eurotransplant gemeldet. Die mittlere Wartezeit ist bei einem high urgency gemeldeten Patienten 2-4 Tage. Über ein weiteres lebenswichtiges Organ, die Niere, referierte Prof. Hoffner aus Rostock. Das akute Nierenversagen hat eine Inzidens von 8 pro eine Million. Entscheidend für die Prognose ist die Ätiologie des akuten Nierenversagens. Die Mortalität beträgt 35- 73% . In der 2. Nachmittagssitzung lag der Schwerpunkt bei Organisation und Notfallmanagement. Frau Gießen- Scheidel. Leiterin der Fachweiterbildung in Mainz, gab einen Überblick über die Inhalte einer Fachweiterbildung. Sie hatte dies in verschiedene Aspekte unterteilt, wie medizinische, ethische, persönliche etc. Jeder einzelne Aspekt wurde praxisbezogen, gut nachvollziehbar und insbesondere sehr gut graphisch dargestellt erläutert. Dass die Pflegevisite ein wesentliches Mittel der Qualitätssicherung ist, konnte der Zuhörer nach dem Vortrag von Frau Reising, der jetzigen pflegerischen Stationsleitung der Mainzer Kinderintensivstation, sicher bestätigen. "Die Pflegevisite ist eine Interaktion von Sachverständigen der Pflege", so ihre Aussage. Eingeführt wurde sie in Mainz 1999 und ist jetzt fester Bestandteil in der pflegerischen Arbeit. Über Leben und Outcome nach Reanimation im Jahr 2005 und warum regelmäßiges Auffrischtraining notwendig ist, erfuhr der Zuhörer im Anschluss von Dr. Dirks.
Welch gute Beziehung zu ESPIC besteht, zeigte der nächste Referent. Das ESPIC Mitglied. J. Latour aus Rotterdam, möchte die Türen der Intensivstation neben den Eltern auch für Geschwisterkinder öffnen. Eltern sind mittlerweile für viele eine Selbstverständlichkeit, aber Geschwisterkinder? Auch in der Literatur wird dieses Thema sehr umstritten diskutiert. Latour gab sehr stichhaltige Argumente für einen offeneren Umgang mit dieser Frage. Die 3. Nachmittagssitzung beschäftigte sich mit der Neurointensivmedizin. Status epilepticus- Definition, Ursachen, Prognosen und Therapie - all dies schilderte Dr. Knuf. Er appellierte aber auch an alle, nicht gleich jedem Neuen unkritisch zu folgen, da häufig langfristige Untersuchungen fehlen würden. Der Leibarzt von Napoleon, Baron des Marets, so berichtete PD. Wagner hat als einer der ersten die therapeutische Hypothermie angewendet. Er nahm Schnee als Anästhesie bei Schnellamputationen. Dies ist sicher heute keine adäquate Indikation mehr, aber als Therapie bei Tachykardie, hämorrhagischem Schock, ARDS und dem SHT findet die Hypothermie Anwendung. Wichtige Therapiemaßnahmen bei der Behandlung des kindlichen Organspenders bildete den Abschluss dieser Sitzung. Am folgendem Tag ging es - nach Grußworten von Prof. Poets aus Tübingen - mit dem Schwerpunkt “das pädiatrische Trauma” weiter. Verbrühungen und Verbrennungen gehören hierzu. PD. Hennenberger gab einen allgemeinen Überblick zu diesem Thema, aber auch sehr praktische Ratschläge, die sicher bei dem einen oder anderen in Vergessenheit geraten sind. (z.B. dass die Handinnenfläche ca. 1% der Körperoberfläche entspricht). Über die Notwendigkeit von europaweit geführten Studien zum Thema Schädelhirntrauma wurde aus England berichtet. Was sich in 40 Jahren in der Behandlung eines Polytraumas verändert hat, schilderte PD Berger aus der Schweiz. Größte Veränderungen gab es in der Diagnostik, aber auch die Interventionen von chirurgischen Eingriffen sind seltener geworden. Ertrinkungsunfälle beinhaltete ein Beitrag aus Rotterdam. Es wurde dabei ausführlich auf die Auswirkung der entstehenden Hypothermie eingegangen. Zu erwähnen ist, dass die Körpertemperatur unbedingt oesophageal gemessen werden sollte. Wichtig aber auch der Hinweis, dass auftretende Hyperglykämien mit einem ungünstigerem neurologischen Outcome korrelieren. Nicht unerwähnt blieben aber auch die Traumata, die durch Vergiftungen entstehen. 25% aller Anfragen in der Giftzentrale in Bonn betreffen Kleinkinder im Alter zwischen 1 bis 3 Jahren. Insgesamt werden ca. 130.000 Anfragen in allen bundesdeutschen Giftzentralen pro Jahr gestellt, davon müssen 10-15000 im Krankenhaus behandelt werden. 500 Kinder erkranken schwer, die Mortalität liegt unter 10 Fällen.
Die bedrohlichsten Noxen sind Medikamente, besonders Antidepressiva, organische Lösungsmittel und Pestizide. Ipecacuanha zum Auslösen von Erbrechen ist heute obsolet. Giftentfernungstherapien sind forcierte Diurese, repetive Kohlegabe und Hämodialyse. Die darauffolgende Vormittagssitzung behandelte das Thema Ventilation. Dr. Rimensberger aus der Schweiz stellte neue Beatmungsstrategien vor, zeigte aber auch, wie schwierig es ist, Beatmungsfallstudien am Patienten zu führen. Aus Mannheim wurde ECMO bei Kindern mit Lungenversagen als Rescuetherapie vorgestellt. Insgesamt wurden 47 Patienten in der Zeit zwischen 1996 und 2000 behandelt. Sehr anschaulich wurde beschrieben, welche Erfolgsaussichten und welche Probleme bestehen. Beendet wurde die Vormittagssitzung mit den Themen "Non-invasive Beatmung" und "Helioxbeatmung”, die eine Option bei akuter Atemwegsobstruktion und schwieriger Beatmungssituation darstellt. Die Non- invasive Beatmung wurde bereits früh bei Kindern mit Poliomyelitis oder in der Neonatologie durch die Pulmarca angewendet. Ein unverändert großer Vorteil ist die Beibehaltung einer verbalen Kommunikation und die orale Nahrungsaufnahme. Heute sind es zumeist immunsuppremierte Patienten, die mit dieser Form der Beatmung erfolgreich behandelt werden. Abgerundet wurde das wissenschaftliche Programm mit den Themenkomplexen “Postoperatives Management” und “Qualitätssicherung und Dokumentation". Zu 1: Sehr diskussionsfreudig zeigten sich die Zuhörer bei dem Thema der Analgosedierung. Fazit war der Wunsch, ähnlich wie in der Neonatologie, dass Leitlinien in der Deutschen Gesellschaft für pädiatrischen Intensivmedizin erstellt werden. Vorgestellt wurde zudem eine Messtechnik, die ähnlich wie bei einem EEG die mit verschiedenen Medikamenten durchgeführte Analgosedierung durch objektive Messung darstellt. Nicht unterschätzt werden darf das Ernährungskonzept in dieser Phase. Welche Konsequenzen Unterernährung hat, stellte Dr. Joosten aus Rotterdam vor. Ein großes Problem, welches sicher jede Kinderkrankenschwester/pfleger in der Intensivpflege zu bewältigen hat, ist der Transport eines Intensivpatienten. Wo und wie lagern die Perfusoren, das Beatmungsgerät, der Monitor und vielleicht auch noch die Druckbeutel , ohne dass alles auf dem Patienten liegt oder aber herunterfällt. Von Dr. König aus Mainz wurden allen eindrucksvoll verschiedene Studien vorgestellt, wie sich die Morbidität, aber auch die Mortalität durch solche Transporte erhöht. In einer Studie von Moos 2005 wurden 1381 Neugeborenentransporte untersucht. In 395 Fällen gab es Komplikationen, in 60% war es ein Geräteproblem, in 41% mangelhafte Vorbereitung.(Überschneidungen waren gegeben). Alle Zuhörer waren aufgefordert über folgende Fragen nachzudenken: Warum transportieren wir? Welche Konsequenz ziehen wir aus dem Ergebnis nach einem diagnostisch indizierten Transport? Wie transportieren wir? Wer transportiert? Dr. König zeigte Lösungsansätze, wie sich durch ein entsprechendes Risikomanagement die Fehlerquote senken lässt.
Zu 2: Keine Fortbildungsveranstaltung ohne dass es um das Thema DRG und die Notwendigkeit von lückenlosem Codieren geht. Welche Prozeduren müssen unbedingt miterfasst werden, für welche Mittel gibt es Sonderentgelte, welche Folgen hat die Erweiterung um 74 DRG für die Pädiatrie/Neonatologie? Im Abrechnungssystem gibt es immer was Neues, das Neueste wurde in Mainz vorgestellt. Zu diesem Thema passend war der anschließende Vortrag über das Aufkommen von Datensammlungen und die erforderliche Zeit, die ärztliches und pflegerisches Personal benötigt, alle diese Daten zu erheben und zu dokumentieren. In Mainz wird die Datenerfassung nach einem positiv ausgefallenen Probelauf auf der Intensivstation auf ein PDMS- System in der ganzen Klinik umgestellt. Welche Voraussetzungen dafür geschaffen werden müssen, wie teuer eine solche Einführung ist und welche Vorteile langfristig ein solches System bringt, stellte Frau Kessler vor. Zur Ergänzung dann die Informationen der mobilen Datenerfassung. Frau Harth, wie erwähnt eine der Organisatorinnen, stellte allen die Frage: "Erinnern Sie sich noch an eine Sache, die gerade noch mal gut gegangen ist ? Wie haben Sie sich danach verhalten? Wurde der Beinahe-Fehler gemeldet?" Sicher liegt sie richtig mit der These, dass zumeist nach praktischen Lösungen gesucht wird, statt der Ursache auch vielleicht mittels des Qualitätsbeauftragten auf den Grund zu gehen. Durch Zeitdruck, unzureichende Ausstattung, schlechte Ausbildung u.ä. besteht eine latente Gefahr, dass Fehler entstehen. Fehler aber kosten auch Geld (unbestritten, was es für den Patienten bedeutet); eine Zielsetzung im Gesundheitssystem lautet, durch eine Reduktion der Fehler die Kosten im Gesundheitssystem zu senken. Aus Fehlern sollte gelernt werden. Dazu müssten diese und auch die Beinahe- Fehler aber gemeldet werden.. Wie dies funktionieren kann und was dazu unbedingt notwendig ist, wurde professionell dargestellt. The Future of paediatric Intensive Care - zum Abschluss musste der Zuhörer sich noch einmal auf die englischen Sprachkenntnisse konzentrieren und erfuhr, wie die Zukunft der pädiatrischen Intensivmedizin aussehen kann. So ging eine der interessantesten Fortbildungsveranstaltungen, die ich in den letzten Jahren über Intensivmedizin und Pflege besucht habe, zu Ende. Der Tagungsbericht ist sicher sehr ausführlich. Ich wollte aber allen aufzeigen, welch großes Spektrum die pädiatrische Kinderintensivmedizin und Pflege beinhaltet. Dies war auch das Ziel der beiden Organisatoren. Und diejenigen, die nicht das Glück hatten in Mainz diese Tagung mitzuerleben, bekommen vielleicht auf diesem Wege einen Überblick über Neues aus der praktischen Arbeit auf einer interdisziplinären Kinderintensivstation.
Nicht vermitteln kann ich, was viele emotional gespürt haben. Prof. Jüngst drückte es so aus: "Das, was Intensivmedizin heute wie vor 40 Jahren ausmacht, ist das partnerschaftliche empathische Miteinander von Patienten, Pflegenden und Ärzten." In Mainz wurde dies allen vorgelebt, nicht nur auf dem wundervollen Festabend. Welch ein Glück, wenn man ein ähnlich partnerschaftliches Miteinander in seiner eigenen Klinik wiederfindet. Marlies Bergers Fachkinderkrankenschwester Sozial und Gesundheitsmanagerin Kinderintensivstation Uniklinikum Hamburg Eppendorf
Sie können auch lesen