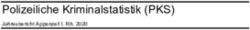Empfehlung für die Begutachtung der Lärmschwerhörigkeit (BK-Nr. 2301) - Königsteiner Empfehlung-Update 2020 - DGUV Publikationen
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Empfehlung für die Begutachtung der Lärmschwerhörigkeit (BK-Nr. 2301) – Königsteiner Empfehlung – Update 2020
kommmitmensch ist die bundesweite Kampagne der gesetzlichen Unfallversicherung in Deutschland. Sie will Unternehmen und Bildungseinrichtungen dabei unterstützen, eine Präventionskultur zu entwickeln, in der Sicherheit und Gesundheit Grundlage allen Handelns sind. Weitere Informationen unter www.kommmitmensch.de Impressum Herausgegeben von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV) Glinkastraße 40 10117 Berlin Telefon: 030 13001-0 (Zentrale) Fax: 030 13001-9876 E-Mail: info@dguv.de Internet: www.dguv.de Redaktion: Dr. Ulrike Wolf, Stefanie Palfner Ausgabe: Oktober 2020 zu beziehen unter www.dguv.de/publikationen Webcode: p010846 Bildnachweis Umschlagfoto: ©peterschreiber.media – stock.adobe.com
Empfehlung für die Begutachtung der Lärmschwerhörigkeit (BK-Nr. 2301) – Königsteiner Empfehlung – Update 2020
Kurzfassung
Empfehlung für die Begutachtung
der Lärmschwerhörigkeit (BK-Nr. 2301)
Auch diese überarbeitete Auflage der Die Auswertung der Befunde und eine
Empfehlung für die Begutachtung der sich daraus ergebende Kausalität der
beruflichen Lärmschwerhörigkeit beruflichen Tätigkeit für die Lärm-
(BK-Nr. 2301) hat den Anspruch, den schwerhörigkeit sind die Voraussetzung
aktuellen medizinischen Erkenntnis- für die sich anschließende MdE-Ein-
stand zusammenzufassen und die in der schätzung auf Grundlage der bekannten
Vergangenheit herausgearbeiteten all- und bewährten, aber jetzt zum Teil
gemeinen Erfahrungssätze zur MdE-Ein- modifizierten Tabellen der Fachliteratur
schätzung wiederzugeben. nach Boenninghaus/Röser, Brusis/
Mehrtens, Feldmann und Röser. Um die
Die vorliegende Empfehlung ist in fünf Bewertung der arbeitsbedingten
Kapitel gegliedert. Nach der Einführung Schwerhörigkeit der Bedeutung des
finden sich in Kapitel 2 allgemeine Infor- Gehörs in der Arbeitswelt weiter anzu-
mationen zu rechtlichen Grundlagen zur passen, wurden die Tabellen zur Berech-
Lärmschwerhörigkeit wie z. B. Ursachen- nung des prozentualen Hörverlustes aus
zusammenhang und Beweisanforderung. dem Sprachaudiogramm sowie aus dem
Tonaudiogramm überarbeitet.
In der Begutachtungspraxis besonders
relevant sind Kapitel 3 „Diagnostik“ und
Kapitel 4 „Auswertung“. Hier werden die
obligatorischen Verfahren und ihre
Besonderheiten für die BK-Nr. 2301 wie
ausführliche Anamnese differenziert
nach Freizeit und Beruf, Untersuchung,
Tonschwellenaudiometrie, Tympano
metrie, Sprachaudiometrie und Gleich-
gewichtsprüfung erläutert. Hervorzu
heben sind dabei die Differenzial
diagnostik mit DPOAE und TEOAE
und ggf. eine erforderliche Tinnitus
diagnostik.Inhaltsverzeichnis
Seite
Vorwort zur sechsten Auflage.............................................................................................................. 7
1 Ziele.................................................................................................................................................. 9
2 Grundlagen................................................................................................................................... 10
2.1 Rechtlicher Rahmen................................................................................................................. 10
2.2 Medizinisches Bild................................................................................................................... 11
2.3 Exposition...................................................................................................................................... 12
2.4 Ursachenzusammenhang..................................................................................................... 14
2.5 Beweisanforderungen............................................................................................................. 15
2.6 Zusammenarbeit von Gutachterin bzw. Gutachter
und Unfallversicherungsträger........................................................................................... 16
2.7 Definition der Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE)......................................... 17
3 Diagnostik (Allgemeines)..................................................................................................... 19
3.1 Anamnese..................................................................................................................................... 19
3.2 HNO-ärztliche Untersuchung.............................................................................................. 21
3.3 Tonschwellenaudiometrie.................................................................................................... 21
3.4 Tympanometrie........................................................................................................................... 22
3.5 Differenzialdiagnostik............................................................................................................ 22
3.6 Tinnitusdiagnostik.................................................................................................................... 23
3.7 Sprachaudiometrie................................................................................................................... 24
3.8 Gleichgewichtsprüfung.......................................................................................................... 25
3.9 Ergänzende Untersuchungen.............................................................................................. 25
4 Auswertung.................................................................................................................................. 26
4.1 Plausibilität der Befunde....................................................................................................... 26
4.2 Diskussion des Ursachenzusammenhangs................................................................ 27
4.3 Berechnung des prozentualen Hörverlustes.............................................................. 29
4.3.1 Berechnung des prozentualen Hörverlustes
aus dem Sprachaudiogramm.............................................................................................. 30
4.3.2 Berechnung des prozentualen Hörverlustes
aus dem Tonaudiogramm..................................................................................................... 32Inhaltsverzeichnis
Seite
4.4 Einschätzung der Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE).................................. 32
4.4.1 Ermittlung der MdE aus dem prozentualen Hörverlust......................................... 35
4.4.2 Vor- und Nachschäden........................................................................................................... 35
4.4.3 MdE-Staffelung........................................................................................................................... 39
4.4.4 Begleit-Tinnitus........................................................................................................................... 39
4.5 Empfehlungen............................................................................................................................. 40
4.5.1 Maßnahmen der Individualprävention.......................................................................... 41
4.5.2 Nachbegutachtungen.............................................................................................................. 41
4.5.3 Hörgeräteversorgung............................................................................................................... 41
5 Literatur.......................................................................................................................................... 43
5.1 In der Königsteiner Empfehlung aufgeführte Literatur.......................................... 43
5.2 Weiterführende Literatur....................................................................................................... 47
Anlage 1:
Mitwirkende bei der Überarbeitung der Königsteiner Empfehlung.................................. 49
Anlage 2:
Abkürzungsverzeichnis............................................................................................................................ 50Vorwort
zur sechsten Auflage
Die Empfehlung für die Begutachtung Dementsprechend waren an der Über-
der Lärmschwerhörigkeit (BK-Nr. 2301) arbeitung in einem interdisziplinären
– kurz auch Königsteiner Empfehlung Arbeitskreis beteiligt: der Deutsche
genannt – stellt seit über 40 Jahren eine Berufsverband der Hals-Nasen-Ohren-
Grundlage für eine gleiche und gerechte ärzte e.V. (BV HNO), die Deutsche
Bewertung der Lärmschwerhörigkeit Gesellschaft für Arbeitsmedizin und
sowie der daraus resultierenden Min Umweltmedizin (DGAUM), die Deutsche
derung der Erwerbsfähigkeit (MdE) dar. Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heil-
Nach der Rechtsprechung repräsentie- kunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e.V.
ren Begutachtungsempfehlungen den (DGHNOKHC), die Vereinigung Deut-
aktuellen wissenschaftlichen Erkennt- scher Staatlicher Gewerbeärzte (VDSG),
nisstand. der Verband Deutscher Betriebs- und
Werksärzte (VDBW), die Bundesanstalt
Die Königsteiner Empfehlung (damals für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
noch „Königsteiner Merkblatt“) wurde (BAuA), die Sozialversicherung für Land-
erstmals im Jahr 1974 von führenden wirtschaft, Forsten und Gartenbau
deutschen Audiologen in Zusammen- (SVLFG) sowie die DGUV und ihre Insti-
arbeit mit dem ehemaligen Institut für tute und Kliniken. Dabei haben die Vor-
Lärmbekämpfung erarbeitet. Seither stände der medizinisch-wissenschaft
wurde diese Begutachtungsempfehlung lichen Fachgesellschaften benannte Ver-
regelmäßig aktualisiert. treter entsandt. Als wissenschaftlichen
Leiter hat der Arbeitskreis aus seiner
Auch bei der jetzt fünften Überarbeitung Mitte heraus Herrn Professor Dr. med.
wurden die „Grundsätze der DGUV für Tilman Brusis gewählt; zur personellen
Empfehlungen zur Begutachtung bei Zusammensetzung des Arbeitskreises
Berufskrankheiten“ zugrunde gelegt vgl. Anlage 1 auf Seite 49.
(Brandenburg et al., 2009). Diese
Grundsätze stellen eine Selbstverpflich- Die überarbeitete Auflage orientiert sich
tung zur Erstellung von Begutachtungs- am aktuellen medizinisch-wissenschaft
empfehlungen dar. lichen Erkenntnisstand und berücksich-
tigt den aktuellen Stand der Rechtspre-
chung.
7Vorwort
Bereits bei der letzten Überarbeitung fundiert darüber diskutiert werden, wie
war sich der Arbeitskreis einig, dass die Audiometrieverfahren mit Störgeräu-
Bewertung der arbeitsbedingten schen eingesetzt werden können.
Schwerhörigkeit künftig der Bedeutung
des Gehörs in der Arbeitswelt weiter Die Bedeutung der Kombinationswir-
angepasst werden muss; dies gilt ins kung von Lärm mit ototoxischen Arbeits-
besondere für die beginnende Schwer- stoffen ist auch in Zukunft weiter zu
hörigkeit. Daher wurden nun die Hörver- beobachten.
lust-Tabellen (Tabelle 1 und 2) geändert.
Dadurch fällt die Bewertung des prozen- Die überarbeitete und aktualisierte
tualen Hörverlustes bei der beginnen- önigsteiner Empfehlung wurde in einer
K
den bis geringgradigen Lärmschwer für die Fachöffentlichkeit offenen Ver
hörigkeit künftig in den meisten Fällen anstaltung am 26. Juni 2019 in Berlin
etwas höher aus. Durch die Modifika- präsentiert und diskutiert. Änderungs-
tion der Tabelle 1 ist die Berechnung des vorschläge, die sich aus der Diskussion
gewichteten Gesamtwortverstehens ergeben haben, wurden im Arbeitskreis
nicht mehr erforderlich. Königsteiner Empfehlungen diskutiert
und zum Teil eingearbeitet.
Die mit einer Innenohrschwerhörigkeit
verbundenen Einschränkungen des Abschließend haben die Vorstände bzw.
Sprachverstehens fallen in realen Umge- Gremien der Fachgesellschaften und
bungsbedingungen mit Hintergrundge- beteiligten Institutionen sowie die
räuschen oft stärker ins Gewicht als dies zuständigen Gremien der DGUV und
mit den derzeit in der Begutachtung der SVLFG der Neufassung der „König-
eingesetzten A udiometrie-Testverfahren steiner Empfehlung“ zugestimmt.
in Ruhe festgestellt werden kann. Die
Forderung nach einer zusätzlichen Wir danken allen Beteiligten für die
Beurteilung des Hörvermögens bei Stör- konstruktive Zusammenarbeit bei dieser
geräuschen ist daher grundsätzlich wichtigen Aufgabe.
nachvollziehbar. Der Arbeitskreis war
mehrheitlich der Auffassung, dass für
den Einsatz von Audiometrieverfahren
mit Störgeräuschen zur lebensnahen
Beurteilung der funktionalen Auswir-
kung noch Forschungsbedarf besteht.
Wenn für die Begutachtung der Lärm-
schwerhörigkeit validierte Forschungs-
ergebnisse vorliegen, sollte zukünftig
81 Ziele
Diese Begutachtungsempfehlung richtet Die erforderlichen Untersuchungs
sich in erster Linie an ärztliche Sachver- methoden gelten dabei als Gutachten-
ständige (im Folgenden: Gutachterinnen standard. In Verbindung mit den nach-
und Gutachter), die das Vorliegen einer vollziehbaren MdE-Vorschlägen wird die
Lärmschwerhörigkeit (BK-Nr. 2301 der erforderliche Schlüssigkeitsprüfung der
Anlage 1 der BKV), also das Vorliegen Gutachten für die Unfallversicherungs-
eines lärmtypischen Krankheitsbildes träger und die Sozialgerichtsbarkeit
und des ursächlichen Zusammenhanges erheblich leichter. Hiermit wird aber
mit der beruflichen Tätigkeit prüfen und auch mehr Transparenz für die betroffe-
eine Aussage über die durch den lärm- nen Versicherten erreicht. Mit dem
bedingten Gehörschaden bedingte Min- erläuterten Verfahren werden eine weit
derung der Erwerbsfähigkeit (MdE) tref- gehende Gleichheit in der Bemessung
fen müssen. Die für die Begutachtung des lärmverursachten Hörverlustes und
erforderlichen Untersuchungen sind eine möglichst objektive Beurteilung
nach den Standards der Fachgesell- angestrebt.
schaften durchzuführen.
Die in der Empfehlung enthaltenen
Tabellen und Übersichten zur Einschät-
zung der MdE sind allgemeine Anhalts-
punkte und eröffnen der Gutachterin
bzw. dem Gutachter einen Beurteilungs-
spielraum für die Einschätzung des
Einzelfalles. Sie dürfen deshalb nicht
schematisch für die Ermittlung der indi-
viduellen MdE angewandt werden. Für
den Vorschlag zur Höhe der MdE ist ent-
scheidend, in welchem Umfang der
versicherten Person der allgemeine
Arbeitsmarkt mit seinen vielfältigen
Erwerbsmöglichkeiten verschlossen ist.
Der Funktionsverlust ist in Form des
prozentualen Hörverlustes anzugeben,
mit dessen Hilfe dann der MdE-Vor-
schlag entwickelt werden kann.
92 Grundlagen
Im Berufskrankheiten-(BK-)Verfahren mit der Berufskrankheiten-Verordnung
unterstützt die Gutachterin als unabhän- (BKV) ist die rechtliche Grundlage für die
gige Sachverständige bzw. der Gutach- Anerkennung und Entschädigung von
ter als unabhängiger Sachverständiger Erkrankungen als Berufskrankheit. In
die Unfallversicherungsträger bei der der Anlage 1 der BKV wird unter der
Klärung des medizinischen Sachver- Nummer 2301 die Lärmschwerhörigkeit
halts. Dabei prüft sie bzw. er, ob die in aufgeführt.
der BK-Liste bezeichnete Erkrankung
vorliegt und welche Gesundheitsstörun- Bereits mit der Aufnahme der Lärm-
gen der Berufskrankheit zuzuordnen schwerhörigkeit in die Liste der Berufs-
sind. Für die rechtliche Beurteilung und krankheiten ist festgeschrieben worden,
abschließende Entscheidung, ob im dass eine arbeitsbedingte Lärmeinwir-
Einzelfall eine Berufskrankheit anzu- kung grundsätzlich geeignet ist, eine
erkennen ist sowie ob und ggf. in wel- entsprechende Schwerhörigkeit zu ver-
chem Umfang ein Leistungsanspruch ursachen. Die BK-Nr. 2301 bezeichnet
besteht, ist der Unfallversicherungs die durch Lärm (Hörschall, ausgewertet
träger zuständig. als Dauerschallpegel) am Arbeitsplatz
hervorgerufene Schwerhörigkeit (Beein-
Allgemeine Ausführungen zur Stellung trächtigung des Hörvermögens). Eine
der Gutachterin bzw. des Gutachters davon abgrenzbare Gehörschädigung
sowie zur Begutachtung sind den „Emp- durch ein einmaliges Lärmereignis (z. B.
fehlungen der Unfallversicherungsträger Knalltrauma) ist als Arbeitsunfall zu
zur Begutachtung bei Berufskrankhei- bezeichnen (BSG-Urteil vom 12. April
ten“ (HVBG, 2004) zu entnehmen, die 2005, B 2 U 6/04 R).
von den Spitzenverbänden der Unfall-
versicherungsträger in Abstimmung mit Der Versicherungsfall einer Berufskrank-
der Bundesärztekammer und zahlrei- heit liegt vor, wenn kumulativ folgende
chen wissenschaftlichen Fachgesell- Voraussetzungen gegeben sind:
schaften erarbeitet wurden.
• eine Krankheit im medizinischen
Sinn (regelwidriger Körperzustand),
2.1 Rechtlicher Rahmen siehe 2.2
Der § 9 des siebten Buches des Sozial- • zur Verursachung der Krankheit
gesetzbuches (SGB VII) in Verbindung geeignete, dem BK-Tatbestand ent-
10Grundlagen
sprechende Einwirkungen aus der Eine Lärmschwerhörigkeit ist in der
versicherten Tätigkeit, siehe 2.3 Regel durch die Merkmale Innenohr-
schwerhörigkeit, Symmetrie und c5-
• die Verursachung der Krankheit durch Senke charakterisiert (siehe auch 4.2,
diese Einwirkungen, siehe 2.4 und 4.2 VDI-Richtlinie 2058 Blatt 2).
Der Leistungsfall liegt vor, wenn die Die subjektive Einschränkung der Hör
Versorgung mit einer Hörhilfe erforder- fähigkeit äußert sich bei Betroffenen
lich ist bzw. wenn aufgrund der MdE charakteristischerweise durch die nach-
Anspruch auf eine Rente besteht lassende Wahrnehmung von hochfre-
(vgl. 2.7). Dies ist in der Regel bei Errei- quenten Schallereignissen wie z. B.
chen einer MdE von 20 % – in der land- Vogelzwitschern, Läuten der Türklingel
wirtschaftlichen Unfallversicherung, oder des Telefons und durch Kommuni-
sofern es sich nicht um Beschäftigte in kationsprobleme bei angehobenem
der Landwirtschaft handelt, abweichend Hintergrundpegel wie z. B. bei Gesprä-
bei einer MdE von 30 % – der Fall. chen mit mehreren Personen, bei
Besteht aus Schäden im Sinne des § 56 Besprechungen, bei Familienfeiern, bei
Abs. 1 Satz 2 SGB VII schon eine stüt- Gaststättenbesuchen, in Verkaufsräu-
zende MdE, wird der Leistungsfall mit men oder bei Lautsprecherdurchsagen.
Rentenanspruch durch die Lärmschwer Das lauter stellen des Fernsehers kann
hörigkeit schon bei einer MdE von 10 % ein Anzeichen für eine Schwerhörigkeit
erreicht (vgl. 2.7). Ein Leistungsfall liegt sein.
ebenfalls vor, wenn ein lärmbedingter
Tinnitus einer Behand- Nach der höchstrichterlichen Rechtspre-
lung bedarf. chung1) erfüllt jede Einschränkung des
Hörvermögens die medizinischen Vor-
aussetzungen des BK-Tatbestandes. Es
2.2 Medizinisches Bild ist hierunter jede von einer altersent-
sprechenden individuellen Normal
Eine chronische Lärmeinwirkung kann hörigkeit abweichende Hörminderung
dosisabhängig die Haarzellen des mit den Charakteristika eines lärmbe-
Innenohres durch metabolische Über- dingten Gehörschadens zu verstehen.
forderung schädigen.
1) BSG, 2 RU 54/88 vom 27. Juli 1989
11Grundlagen
Das amtliche Merkblatt des BMAS zur gegeben sind und die versicherte Per-
BK-Nr. 2301 (2008) benennt allgemein son weiter im Lärm tätig ist.
Kriterien zur Erstattung einer ärztlichen
Anzeige. Auch eine Gehörschädigung, die auf ein
einmaliges Lärmereignis im Sinne von
Ein BK-Verdacht und somit die Erstat- Knalltraumen oder anderen Schallereig-
tung einer ärztlichen Anzeige ist auf nissen hoher Intensität zurückgeführt
jeden Fall dann begründet, wenn die wird, ist anzuzeigen. Der Unfallversiche-
versicherte Person rungsträger wird dann ggf. zunächst prü-
fen, ob es sich unter versicherungsrecht-
• eine Reihe von Jahren unter gehör lichen Aspekten um einen Arbeitsunfall
gefährdenden Lärmbedingungen tätig oder um eine Berufskrankheit handelt.
war und
• die Hörfunktionsstörung dem Bild 2.3 Exposition
einer lärmbedingten Schwerhörigkeit
(Innenohrschwerhörigkeit, Symmetrie, Relevant ist die Einwirkung von Lärm in
c5-Senke) entspricht und Zusammenhang mit einer versicherten
Tätigkeit.
• nach dem Tonaudiogramm die Voraus-
setzungen für eine Hörgerätever In Anlehnung an das amtliche Merkblatt
sorgung nach der HilfsM-RL gegeben zur BK-Nr. 2301 kann sich eine Lärm-
sind (siehe 4.5.3). schwerhörigkeit in der Regel nach mehr-
jähriger Exposition bei einem Tages-
Darüber hinaus ist die Anzeige auch zu Lärmexpositionspegel2) (LEX,8h), der den
erstatten, wenn die Voraussetzungen für Wert von 85 dB (A) erreicht oder über-
eine Hörgeräteversorgung noch nicht schreitet, entwickeln.
2) LEX,8h und LpC,peak werden nach der LärmVibrationsArbSchV bzw. TRLV Lärm, Teil 1 (Techni-
sche Regel zur Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung), im Rahmen der Gefähr-
dungsbeurteilung ermittelt und dokumentiert. Zu geeigneten Messverfahren verweist
Teil 2 dieser TRLV auf die DIN EN ISO 9612. Der LEX,8h nach LärmVibrationsArbSchV bzw.
TRLV Lärm enthält in keinem Fall Zuschläge. Die Auslösewerte (LEX,8h = 80 dB[A] bzw.
85 dB[A] oder LpC,peak = 135 dB[C] bzw. 137 dB[C] nach LärmVibrationsArbSchV) stellen
Werte dar, ab denen Präventionsmaßnahmen durchzuführen sind. Da die Königsteiner
Empfehlung bei der Angabe des LEX die Genauigkeitsklasse nicht berücksichtigt, kann der
LEX nach der TRLV Präventionsmaßnahmen auslösen (z.B. Maßnahmen in 4.5.1) obwohl
die Exposition nicht BK-relevant ist. Werden diese erreicht oder überschritten, folgt daraus
nicht zwangsläufig, dass eine Schwerhörigkeit arbeitslärmbedingt ist.
12Grundlagen
Maßgebend für die Beurteilung der ggf. die Pegel3) LpC,peak (oder LAImax)
arbeitsbedingten Lärmexposition ist der angegeben werden.
Tages-Lärmexpositionspegel LEX,8 h.3)
Der Tages- Lärmexpositionspegel (LEX,8 h) Durch die Berechnung der „Effektiven
ist der über die Zeit gemittelte äquiva- Lärmdosis (ELD)“5) nach Liedtke (2010b)
lente Dauerschallpegel in dB(A) bezo- wird die Lärmexposition für das gesamte
gen auf acht Stunden (Maue, 2000; Arbeitsleben auf den einheitlichen
Maue, 2009). Er umfasst alle am Pegel von 90 dB(A) bezogen. Die ELD
Arbeitsplatz auftretenden Schallereig- wird zusätzlich zu der tabellarischen
nisse. Die Tages-Lärmexpositionspegel4) Übersicht in Lärmjahren angegeben. Sie
sind als Ergebnisse fachkundiger ermöglicht dem Gutachter bzw. der Gut-
Ermittlungen der Lärmexposition (Lärm- achterin eine vergleichende Einschät-
VibrationsArbSchV in Verbindung mit zung bei der Beurteilung der Exposition
TRLV „Lärm“) in Bezug auf die Beurtei- unterschiedlicher Versicherter (weiteres
lung einer BK-Nr. 2301 ohne Berücksich- siehe Abschnitt 4.2).
tigung von Genauigkeitsklassen anzuge-
ben und zu verwenden. Sie sind in Extrem hohe Schalldruckpegel (z. B.
tabellarischen Übersichten chronolo- Knalle oder Explosionen) können das
gisch darzustellen. Die Herkunft der Gehör unmittelbar schädigen. Sofern
Daten ist anzugeben. Soweit möglich die versicherte Person solchen Ereignis-
sollen als Zusatzinformation die Genau- sen ausgesetzt war, sind die Spitzen-
igkeitsklasse nach TRLV Lärm, Teil 2 schalldruckpegel LpC,peak (oder die
„Messung von Lärm“, Kapitel 8 „Mess- maximalen „AI“-bewerteten Schall-
unsicherheit, Genauigkeitsklassen“ und druckpegel LAImax) – nach Möglichkeit
3) Wird die längerfristig typische Lärmexposition anstatt durch den Tages-Lärmexpositions
pegel (LEX,8 h) durch den Wochen-Lärmexpositionspegel (LEX,40 h) beschrieben, so ist dieser
zur Beurteilung heranzuziehen.
4) Nach LärmVibrationsArbSchV wird der Gehörschutz bei der Ermittlung des LEX nicht
berücksichtigt.
5) Die effektive Lärmdosis ergibt sich aus der Anzahl der Belastungstage (pro Jahr), dem
Lärmexpositionspegel LEX,8 h und der Expositionsdauer in Jahren. Es muss für die Begut-
achtung die „Effektive Lärmdosis“ (ELD) basierend auf Hörminderungsäquivalenzen nach
ISO 1999 vom Präventionsdienst des zuständigen Unfallversicherungsträgers berechnet
vorliegen (Liedtke, 2010b). Als Ergebnis soll die Anzahl der hörminderungsäquivalenten
Expositionsjahre („Lärmjahre“) angegeben werden. Diese „Lärmjahre“ beziehen sich auf
eine Expositionshöhe von LEX,8 h = 90 dB(A) (Konvention) und 220 Tage pro Jahr (Liedtke,
2010b).
13Grundlagen
mit den Zeitpunkten ihres Auftretens – 2.4 Ursachenzusammenhang
anzugeben. Im amtlichen Merkblatt des
BMAS zur BK-Nr. 2301 (2008) wird an Anerkannt und ggf. entschädigt werden
verschiedenen Stellen darauf hingewie- können nur solche Gesundheitsstörun-
sen, dass oberhalb des Wertes von gen, die wesentlich ursächlich oder teil-
137 dB(C), der in der LärmVibrations- ursächlich durch die unfallversicherte
ArbSchV als einer der oberen Auslöse- Tätigkeit verursacht worden sind.
werte für Präventionsmaßnahmen auf-
geführt wird, gesundheitliche Schädi Im Sinne des Unfallversicherungsrechts
gungen möglich sind. Eine Grenze für kann nur kausal sein, was auch im
eine unmittelbare Schädigung wurde im naturwissenschaftlichen Sinne als
BK-Merkblatt nicht angegeben. Nach Ursache gelten kann.
den bei Liedtke (2010 a) zusammenge-
fassten Forschungsergebnissen können Kommen mehrere Ursachen in Betracht
erst einmalige Schallereignisse von („konkurrierende Kausalität“), so richtet
mehr als 150 dB (Cpeak)6) im Einzelfall sich die Entscheidung nach der „Theo-
akute Gehörschäden hervorrufen. rie der wesentlichen Bedingung“.
Danach ist eine Ursache für eine
Es gibt bislang keine gesicherten Hin- Gesundheitsstörung nur dann rechts
weise dafür, dass Vibrationen, Infra- erheblich, wenn sie – aufgrund ihrer
schall, Ultraschall oder Körperschall an besonderen Beziehung zu dieser Stö-
Arbeitsplätzen das Gehör allein oder in rung – wesentlich zu ihrem Eintritt bei-
Kombination mit einer Lärmeinwirkung getragen hat. Tragen mehrere Ursachen
so schädigen können, dass sie für die wesentlich zum E intritt eines Ereignis-
Begutachtung der Lärmschwerhörigkeit ses bei, so kann e s auch mehrere
eine Rolle spielen könnten (Brusis, rechtserhebliche U rsachen geben.
2017 a; Kusserow, 2016). Dabei müssen die Ursachen nicht
„gleichwertig“ oder „annähernd gleich-
wertig“ sein. Wie gering der Beitrag sein
darf, um noch als rechtlich wesentliche
Ursache berücksichtigt zu werden, ist
nach den gesamten Umständen des
Einzelfalles zu entscheiden. Hierfür
sind eine Gegenüberstellung der
6) Dieser Wert entspricht etwa dem in der VDI 2058 Blatt 2 genannten Wert von
LAImax = 135 dB (Liedtke, 2010 a).
14Grundlagen
konkurrierenden Kausalfaktoren und rechtlich abzugrenzen. Er hat keinen
eine jeweils differenzierende Bewer- Einfluss auf die MdE.
tung von Art und Ausmaß ihres Ursa-
chenbeitrags erforderlich. Eine Differenzierung (z. B. ein sogenann-
tes MdE-Splitting) darf grundsätzlich nur
dann erfolgen, wenn ein BK-bedingter
Vor- und Nachschäden Anteil des Gehörschadens klar und hin-
reichend eindeutig von einem auf eine
Von der Berufskrankheit und ihren andere Ursache zurückzuführenden
Folgen sind Vor- und Nachschäden Schadensanteil abgegrenzt werden
abzugrenzen. kann. Hinweise zur MdE-Bemessung
des Vor- und Nachschadens sind in
Eine vor der ersten arbeitsbedingten Abschnitt 4.4.2 zu finden.
Lärmexposition bereits gegebene
Hörminderung ist versicherungsrecht-
lich ein Vorschaden. Auch ein nach 2.5 Beweisanforderungen
Beginn einer arbeitsbedingten Lärm
exposition eingetretener lärmunabhän- Die Tatbestandsmerkmale „versicherte
giger Hörverlust kann als Vorschaden zu Person“, „versicherte Tätigkeit“, „schä-
bewerten sein, wenn er vor dem Ver digende Einwirkung“, „Erkrankung“
sicherungsfall eingetreten ist. Die Gut- bzw. „Gesundheitsstörung“ sind im
achterin bzw. der Gutachter hat anzu Vollbeweis (mit an Sicherheit grenzen-
geben, ob und in welchem Ausmaß ein der Wahrscheinlichkeit) zu belegen:
solcher organbezogener V orschaden d. h., es darf kein vernünftiger Zweifel
nachweislich besteht und wie er sich auf darüber bestehen, dass diese Tatsachen
die Minderung der Erwerbsfähigkeit vorliegen.
(MdE, siehe Abschnitt 4.4) auswirkt.
Dies ist insbesondere für die Diagnostik
Eine von einer Lärmschwerhörigkeit der Gesundheitsstörung von Bedeutung.
sicher abgrenzbare Hörstörung, die Liegt nur ein Verdacht vor, muss dieser
nach Eintritt des Versicherungsfalls, durch weitere Untersuchungen erhärtet
unabhängig von der Lärmschwerhörig- werden, ansonsten ist der Verdacht
keit, zu einer weiteren Hörverschlechte- außer Betracht zu lassen. Liegen
rung führt, ist ein Nachschaden, schwankende und/oder grenzwertige
genauso wie eine Hörverschlechterung, Befunde vor, müssen Untersuchungen
die sich zeitlich nach Aufgabe der – ggf. auch mit zeitlichem Abstand –
gehörschädigenden Tätigkeit einstellt. wiederholt werden.
Der Nachschaden ist versicherungs-
15Grundlagen
Für die Bejahung des Ursachenzusam- 2.6 Zusammenarbeit von
menhangs, insbesondere zwischen Ein- Gutachterin bzw.
wirkung und Gesundheitsstörung, Gutachter und
genügt die hinreichende Wahrschein- Unfallversicherungsträger
lichkeit. Dies bedeutet, dass bei Abwä-
gung aller Umstände den für den Zusam- Der Unfallversicherungsträger formuliert
menhang sprechenden Umständen ein den Gutachtenauftrag als Auftraggeber
Übergewicht zukommt. Die Tatsachen, klar und eindeutig (z. B. Vordruck
auf die sich die Überzeugung gründet, „Gutachten BK 2301 [Lärmschwerhörig-
sind zu benennen. keit]“).
Ein Kausalzusammenhang ist nicht Dem Gutachter bzw. der Gutachterin
bereits dann wahrscheinlich, wenn er werden alle zur Begutachtung erforderli-
nicht auszuschließen oder nur möglich chen Unterlagen zur Verfügung gestellt.
ist. Dazu gehören insbesondere:
Ist ein Tatbestandsmerkmal nicht • Die Übersicht über alle Beschäfti-
bewiesen oder ist ein Ursachenzusam- gungsverhältnisse
menhang nicht hinreichend wahrschein-
lich zu machen, geht dies nach dem • Die Ergebnisse der Expositionsermitt-
auch im Sozialrecht geltenden Grund- lungen mit Angaben zu Dauer und
satz der materiellen Beweislast zulasten Intensität relevanter Einwirkungen:
der Person, die sich zur Begründung des Grundsätzlich enthalten diese eine
Entschädigungsanspruchs auf diese zusammenfassende Auflistung mit
Tatsachen und Zusammenhänge stützt. den Zeiträumen aller Beschäftigungs-
Fehlt es an Beweisen zur Begründung verhältnisse. Die Angabe des für den
des Entschädigungsanspruchs, geht jeweiligen Beschäftigungsabschnitt
dies zulasten der versicherten Person. repräsentativen Tages-Lärmexposi-
tionspegels7) (LEX,8 h) sowie die bis
Sind konkurrierende Ursachen nicht zum Ende des jeweiligen Beschäfti-
bewiesen, können diese nicht zur Ableh- gungsabschnittes erreichte effektive
nung des Anspruchs herangezogen wer- Lärmdosis sind in dieser Auflistung
den. regelmäßig für drei Jahrzehnte, frühes-
7) LEX,8 h und LpC,peak werden nach der LärmVibrationsArbSchV bzw. TRLV Lärm, Teil 1, ermittelt
und dokumentiert. Zu geeigneten Messverfahren verweist Teil 2 dieser TRLV auf die
DIN EN ISO 9612.
16Grundlagen
tens ab dem Jahr 1990 aufgeführt. Das Gutachten kann seine Aufgabe als
Wenn der Gutachter bzw. die Gutach- Beweisgrundlage nur erfüllen, wenn die
terin für die Diskussion des Ursachen- Beurteilung überzeugend begründet ist.
zusammenhangs dennoch weitere Für diese Beurteilung kommt es nicht
Informationen benötigt, sollte er bzw. auf die allgemeine wissenschaftliche
sie diese beim Unfallversicherungs Auffassung des einzelnen ärztlichen
träger anfordern. Sachverständigen an, sondern auf den
aktuellen medizinischen Erkenntnis-
• Die Ergebnisse der medizinischen stand (vgl. BSG, Urteil vom 9. Mai 2006,
Ermittlungen zur Krankheitsvorge- B 2 U 1/05 R). Soweit sinnvoll und erfor-
schichte und alle verfügbaren audio- derlich, ist der eigene Standpunkt durch
metrischen Befunde, insbesondere einschlägige Fachliteratur zu belegen.
aus der arbeitsmedizinischen Vor-
sorge
2.7 Definition der Minderung
• Bei Nachbegutachtungen auch die als der Erwerbsfähigkeit (MdE)
Folge der Berufskrankheit anerkann-
ten und abgelehnten Gesundheits- Die Minderung der Erwerbsfähigkeit
schäden und die maßgeblichen Vor- (MdE) ist in der gesetzlichen Unfallver
gutachten sicherung der Bewertungsmaßstab für
den Gesundheitsschaden. Als solcher
Die aus Sicht des Gutachters bzw. der ist er von anderen Maßstäben, z. B. des
Gutachterin entscheidungsrelevanten Versorgungsrechts (GdB), des sozialen
Angaben sind ebenso wie die bei der Entschädigungsrechts (GdS) oder privat-
Anamnese erhobenen Angaben der ver- rechtlicher Versicherungsverhältnisse
sicherten Person in das Gutachten auf- (Invaliditätsgrad), streng zu unterschei-
zunehmen. den.
Auf für die Beurteilung bedeutsame Die MdE richtet sich abstrakt nach dem
Abweichungen zur Aktenlage hat der Umfang der sich aus der Beeinträchti-
Gutachter bzw. die Gutachterin aus- gung des körperlichen und geistigen
drücklich hinzuweisen. Soweit erforder- Leistungsvermögens ergebenden ver-
lich begutachtet er bzw. sie die abwei- minderten Arbeitsmöglichkeiten auf
chenden Sachverhalte alternativ. dem gesamten Gebiet des Erwerbs
lebens (§ 56 Abs. 2 Satz 1 SGB VII). Der
Anspruch auf eine Rente setzt daher
nicht voraus, dass der BK-bedingte
Gesundheitsschaden für die versicherte
17Grundlagen
Person zu konkreten wirtschaftlichen Erfahrungssätzen ausgerichtet und
Nachteilen führt. Nicht eine Minderung dann unter Berücksichtigung der indivi-
des Erwerbseinkommens, sondern die duellen Gegebenheiten des Einzelfalls
Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) eingeschätzt werden. Die allgemeinen
soll bemessen und ggf. entschädigt Erfahrungssätze bilden die Grundlage
werden. für eine gleiche und gerechte Bewertung
der MdE in den zahlreichen Parallelfäl-
Rechnerisch ist die individuelle Erwerbs- len der Praxis. Die vorliegende Begut-
fähigkeit vor dem Eintritt der BK mit achtungsempfehlung enthält solche
100 % anzusetzen. Diese Größe stellt allgemeinen Erfahrungssätze.
den Wert dar, auf den das nach Eintritt
der BK verbliebene Ausmaß an Erwerbs- Eine Entschädigung (Rente) kann nur
fähigkeit bezogen werden muss. Aus der gewährt werden, wenn die Erwerbsfähig
Differenz der beiden Werte ergibt sich keit über die 26. Woche nach dem Ver
die MdE. Arbeitsmöglichkeiten, die der sicherungsfall hinaus um wenigstens
versicherten Person wegen ihres 20 % oder infolge mehrerer Arbeitsun-
Gesundheitszustandes bereits vor Ein- fälle/Berufskrankheiten oder anderer im
tritt der BK verschlossen waren, sind Gesetz aufgeführter Entschädigungs-
nicht zu berücksichtigen. fälle jeweils um mindestens 10 % gemin-
dert ist und die Summe der durch die
Die Festsetzung der MdE ist die Anwen- einzelnen Unfälle/Berufskrankheiten
dung eines unbestimmten Rechts verursachten MdE wenigstens 20 %
begriffs auf einen Einzelfall. Es handelt beträgt (§ 56 Abs. 1 SGB VII, sog. Stütz-
sich damit um die Entscheidung einer renten).
Rechtsfrage. Für diese Entscheidung
des Unfallversicherungsträgers ist das In der landwirtschaftlichen Unfallver
ärztliche Gutachten eine wesentliche sicherung gilt abweichend von § 56
Grundlage. Jedoch sind weder die SGB VII grundsätzlich eine MdE von
Unfallversicherungsträger noch die wenigstens 30 % (§ 80 a SGB VII). Für
Gerichte an die MdE-Einschätzung der vorübergehend oder dauerhaft Beschäf-
Gutachterin bzw. des Gutachters gebun- tigte (Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeit-
den. nehmer) in der Landwirtschaft beträgt
die rentenberechtigende MdE, wie allge-
Der Gutachter bzw. die Gutachterin soll mein in der Unfallversicherung, eben-
die MdE als einen Prozentwert vor falls mindestens 20 %.
schlagen. Nach der Rechtsprechung
des Bundessozialgerichts (BSG) soll
der Prozentwert an den allgemeinen
183 Diagnostik (Allgemeines)
Gutachten, die für die Träger der gesetz- • Die Originale der audiometrischen
lichen Unfallversicherung erstattet wer- Befunde sind dem Gutachten beizu
den, müssen den folgenden Gesichts- fügen. Reinton- und Sprachaudio
punkten Rechnung tragen: meter sind jährlich zu warten und
zu kalibrieren (messtechnische
• Bei der Einbestellung zur gutacht Kontrolle). Die gesetzliche Verpflich-
lichen Untersuchung sollte die ver tung hierzu ergibt sich aus dem Medi-
sicherte Person darauf hingewiesen zinproduktegesetz (MPG) und der
werden, dass sie grundsätzlich für Medizinprodukte-Betreiberverord-
einen Zeitraum von mindestens nung (MPBetreibV). Im „Leitfaden zu
14 Stunden vor der Untersuchung messtechnischen Kontrollen von
weder im Arbeitsbereich noch bei der Medizinprodukten mit Messfunktion
Freizeitgestaltung stärkerem Lärm (LMKM, Ausgabe 2.2, Teil 1)“ sind die
(LAeq über 80 dB[A]) ausgesetzt gewe- Anforderungen an die Wartung von
sen sein darf. Stellt sich bei der Vor- Audiometern und Maßnahmen zur
stellung heraus, dass diese Bedin- messtechnischen Kontrolle nieder
gung nicht erfüllt ist, ist ein neuer gelegt.
Untersuchungstermin zu vereinbaren.
• Es ist der Vordruck „Gutachten 3.1 Anamnese
BK 2301 (Lärmschwerhörigkeit)“ zu
verwenden. Gegebenenfalls kann der Da anhand der audiologischen Befunde
Vordruck durch beigelegte Blätter allein ein Nachweis der Lärmschwer
ergänzt werden. Bei besonderen hörigkeit nur bedingt möglich ist, kommt
Fragestellungen kann das Gutachten der Erhebung einer detaillierten Eigen-,
nach Absprache mit dem UV-Träger Familien-, Freizeit- und Arbeitsanamnese
auch in freier Form erstattet werden, besondere Bedeutung zu.
dabei müssen die Gliederung des
Formulargutachtens beachtet und alle Im Rahmen der Familienanamnese
Anlagen beigelegt werden. muss geklärt werden, ob eine familiäre
Belastung hinsichtlich einer erblichen
• Alle angeführten Fragen sind sorgfäl- Schwerhörigkeit vorliegt. Angeborene
tig zu beantworten. Ebenso müssen Hörstörungen, Erkrankungen, Unfälle
alle geforderten Untersuchungen nach oder andere Einwirkungen, die Einfluss
Facharztstandard durchgeführt und auf das Hörvermögen der versicherten
sorgfältig dokumentiert werden. Person gehabt haben können, sind zu
19Diagnostik (Allgemeines)
erfragen. Das Vorerkrankungsverzeich- • Waren die Beschwerden (Schwer
nis ist einzubeziehen. hörigkeit oder Ohrgeräusche) Anlass,
eine Ärztin bzw. einen Arzt aufzusu-
Besonderes Gewicht ist auf die Fragen chen, oder ist die Schwerhörigkeit bei
nach der Entwicklung der Schwerhörig der arbeitsmedizinischen Vorsorge
keit selbst und ihren konkreten Auswir- aufgefallen? Ggf. wann und wo ist die
kungen für die versicherte Person zu versicherte Person zur Ärztin/Fachärz-
legen, z. B.: tin bzw. zum Arzt/Facharzt gegangen?
• Wann (in welchem Lebensalter, nach • Sind wegen der Beschwerden Heil-
wie vielen Jahren der Lärmarbeit) hat maßnahmen eingeleitet worden, z. B.
sich eine Schwerhörigkeit erstmals Verordnung eines Hörgerätes,
bemerkbar gemacht? Behandlung eines Ohrgeräusches?
• Wie hat sich die Schwerhörigkeit Wenn über Ohrgeräusche berichtet wird,
geäußert, z. B. als vorübergehendes ist eine entsprechende Diagnostik
Vertäubungsgefühl nach einer durchzuführen (s. Kap. 3.6).
Arbeitsschicht oder besonderer
Arbeitsverrichtung, als bleibende Bei der Erhebung der Arbeitsanamnese
Schwerhörigkeit, traten Ohrgeräusche sind die Feststellungen und Messergeb-
auf? nisse des Präventionsdienstes von
besonderer Wichtigkeit, ebenso die
• Wie wirkt sich die Schwerhörigkeit Angaben des Arbeitgebers bzw. der
konkret aus, z. B. Einstellen der Arbeitgeberin und die Eintragungen zu
Fernsehlautstärke, Überhören von den gegebenenfalls durchgeführten
Telefon- oder Hausklingel, als Verstän- Vorsorgeuntersuchungen nach der
digungsschwierigkeit unter besonde- ArbMedVV, z. B. hinsichtlich der Anwen-
ren Bedingungen (vermehrtes Nach- dung technischer und persönlicher
fragen, bei Gruppengesprächen wie Schutzmaßnahmen. Hierbei sind Lärm-
z. B. in Besprechungen, bei Einwir- belastungen für das gesamte Arbeits
kung von Störgeräuschen, beim leben zu berücksichtigen. Ergeben sich
Telefonieren, in Unterrichtssituatio- zwischen den Angaben der untersuch-
nen, z. B. Umschulungs- bzw. ten Person und dem Ermittlungsergeb-
Weiterbildungsmaßnahmen oder in nis in der Akte Widersprüche und
anderen Arbeitssituationen)? können diese nicht befriedigend auf
geklärt werden, so sollten sie klar
herausgestellt werden, damit sie durch
weitere Erhebungen seitens des UV-Trä-
20Diagnostik (Allgemeines)
gers überprüft werden können; ggf. sind Die Hörweitenprüfung dient der orientie-
die unterschiedlichen Darstellungen renden Überprüfung der subjektiven
alternativ zu begutachten. Audiometrie.
Bei der beruflichen Tätigkeit können
auch akute Schallschäden durch extrem 3.3 Tonschwellenaudiometrie
hohe Schalldruckpegel (z. B. beim
Abfeuern von Schusswaffen, bei Knall- Das Tonaudiogramm ist ein unentbehr-
und Explosionsereignissen) entstehen. licher Bestandteil des Gutachtens. Es ist
Auch diese sind bei der Arbeitsanam- vor allem zur Differenzialdiagnose und
nese zu erheben. zur Beurteilung des Ausmaßes einer
Schwerhörigkeit wichtig (Abschnitt 4.3.1
Bei der Arbeitsanamnese ist ebenfalls sowie 4.3.2).
zu klären, inwieweit Lärmbelastungen
im Rahmen vorübergehender Auslands- Ziel der tonaudiometrischen Prüfung ist
tätigkeit vorlagen. die Ermittlung der tatsächlichen Hör-
schwelle nach DIN EN ISO 8253-1 in
Ebenso genau ist die Anamnese für den einer entsprechend der Norm schalliso-
nicht beruflichen Bereich zu erheben, lierten Hörprüfumgebung. Die Messung
da hier konkurrierende Einwirkungen ist mehrfach durchzuführen. Weichen
aus dem unversicherten Lebensbereich die Hörschwellen bei mehrfacher Prü-
vorliegen können. Erheblichem nicht fung wesentlich voneinander ab, so
beruflich verursachtem Lärm können sollte hierfür eine Erklärung gefunden
beispielsweise Hobbymusikerinnen/ werden, z. B. Kollabieren des Gehörgan-
Hobbymusiker oder Sportschützinnen/ ges, Aggravation. Werden weiterhin
Sportschützen ausgesetzt sein. stark streuende Angaben gemacht, so
sind die einzelnen differierenden Mess-
werte in das Audiogrammformular ein-
3.2 HNO-ärztliche zuzeichnen oder anzugeben, damit die
Untersuchung Zuverlässigkeit eingeschätzt werden
kann. Für die Beurteilung sind die Werte
Die HNO-ärztliche Untersuchung mit dem geringsten Hörverlust zugrunde
umfasst die vollständige Befunderhe- zu legen. Wird das Tonaudiogramm
bung der Ohren einschließlich der Ohr- durch zu viele differierende Messwerte
mikroskopie sowie der Stimmgabel überfrachtet und dadurch nicht mehr
prüfung nach Rinne und Weber, der beurteilbar, so soll für die Schwellenkur-
Endoskopie der Nasenhöhlen, des ven, die der gutachterlichen Beurteilung
Nasenrachens und des Rachenraumes. zugrunde gelegt werden, ein eigenes
21Diagnostik (Allgemeines)
Tonaudiogramm geschrieben werden 3.4 Tympanometrie
mit dem Hinweis „Beurteilungsaudio
gramm“. Zum Ausschluss oder ggf. zur Differen-
zialdiagnose einer Schallleitungs
Eine Schallleitungskomponente liegt bei störung ist immer eine tympanometri-
der jeweiligen gemessenen Frequenz sche Untersuchung vorzunehmen,
vor, wenn in der Hörverlustskalierung sofern nicht besondere Gesichtspunkte
(dB HV nach DIN EN ISO 389-1) die Diffe- dagegen sprechen (z. B. Trommelfellper-
renz Luftleitungshörschwelle minus foration, Zustand nach Operation). Die
Knochenleitungshörschwelle die mess- Kurven sind dem Gutachten beizufügen.
technisch bedingte Ungenauigkeit von
10 dB übersteigt. Relevant für die Aus-
wertung ist die Schallleitungskompo- 3.5 Differenzialdiagnostik
nente dann, wenn sie in mehr als einer
der gemessenen Frequenzen auftritt Zur Unterscheidung, ob eine cochleäre
(s. Kap. 4.3.2). Bei der Frage, ob eine (Innenohrschwerhörigkeit) oder eine
lärmtypische Hochtonsenke oder ein retrocochleäre Schwerhörigkeit (Hör
nicht lärmtypischer Hochtonabfall nervenschwerhörigkeit) vorliegt, sind
besteht, ist die Luftleitungskurve objektive Testverfahren einzusetzen. Zur
zugrunde zu legen (Brusis, 2010). Objektivierung eines Haarzellschadens
(Innenohrschwerhörigkeit) ist zu prüfen,
Bei hochgradigen Hörverlusten beson- ob otoakustische Emissionen (DPOAE
ders im Tieftonbereich (< 1 kHz) oder und TEOAE) nachgewiesen werden kön-
Taubheit (ein- oder beidseitig) sind die nen. Ist das der Fall, besteht eine Funk-
angegebenen Fühlwerte und die Über- tion der äußeren Haarzellen in dem
hörkurven für Knochen- und Luftleitung betreffenden Cochleabereich. Bei der
in das Audiogramm einzutragen und zu Lärmschwerhörigkeit fehlen typischer-
kennzeichnen. Werden diese zu erwar- weise die OAE im Hochtonbereich. Dem
tenden Messwerte nicht angegeben, so Gutachten ist der OAE-Befundbogen
ist dies ausdrücklich zu vermerken, da beizulegen. Außerdem sind der herstel-
es ein wichtiger Hinweis auf mangel- lende Betrieb und das Modell des Mess-
hafte Kooperation bei der Untersuchung geräts anzugeben. Zu vermerken ist
ist und Anlass dafür sein kann, auch die ferner, bei welchen Frequenzen gemes-
Zuverlässigkeit der anderen Messwerte sen wurde und welche Schlussfolgerun-
in Zweifel zu ziehen. gen aus den Messergebnissen gezogen
werden.
22Diagnostik (Allgemeines)
Als weitere objektive Messverfahren 3.6 Tinnitusdiagnostik
bieten sich an:
Wird neben einem Hörverlust auch über
• Stapediusreflexschwellenmessung belästigende Ohrgeräusche (Tinnitus)
(Metz-Recruitment) geklagt, so müssen diese sorgfältig
durch offene Frageformulierungen ana-
• Hirnstammaudiometrie (BERA) lysiert werden:
Subjektive überschwellige Tests können • Nach Lokalisation (rechtes und/oder
ergänzend durchgeführt werden, wenn linkes Ohr, im ganzen Kopf)
objektive Verfahren keine valide Aus-
sage zulassen. In Betracht kommt z. B. • Nach Klangeindruck (z. B. hoher oder
der SISI-Test. Ein positiver SISI-Test tiefer Ton, Pfeifen, Brummen, Zischen,
spricht für einen Haarzellschaden, ein Rauschen usw.)
negativer SISI-Test deutet jedoch nicht
immer auf eine Hörnervenschwerhörig- • Nach der subjektiv empfundenen
keit hin, auch eine Aggravation kommt Lautheit und dem Maß der Belästi-
in Betracht. gung
Beim SISI-Test ist immer anzugeben, bei • Nach dem Verlauf (langsam entstan-
welchen Frequenzen und Lautstärkepe- den oder plötzlich aufgetreten)
geln der Test durchgeführt wurde. Wer-
den keine der für den Test geforderten Zudem sollte festgestellt werden, ob
Intensitätssprünge von 1 dB wahrgenom- wegen des Tinnitus bereits ambulante
men (SISI-Test 0 %), sollte vermerkt und/oder stationäre Behandlungen
werden, bei welchen größeren Intensi- durchgeführt wurden. Die Testperson
tätssprüngen eine Wahrnehmung ange- sollte von sich aus ihre Beschwerden
geben wird (z. B. 2 dB oder 5 dB). frei formulieren. Diese subjektiven
Beschreibungen müssen durch folgende
Als weitere subjektive Verfahren kom- audiometrische Messungen belegt wer-
men u. a. in Betracht: den:
• Lüscher-Test • Durch Vergleich mit Tönen und/oder
Geräuschen des Audiometers ist die
• Geräuschaudiometrie nach Wahrnehmung des Tinnitus in das
Langenbeck Hörfeld zu projizieren und nach
Frequenzbereich und Lautheit, bezo-
• Békésy-Audiometrie gen auf die gemessenen Hörschwel
23Diagnostik (Allgemeines)
len, im Audiogrammformular einzu prüfungen z. B. dem Tonaudiogramm
tragen.8) oder der offensichtlichen sprachlichen
Verständigungsmöglichkeit der versi-
• Die Verdeckbarkeit des Tinnitus cherten Person mit der Untersucherin
durch Töne und Geräusche muss bzw. dem Untersucher oder einer
durch Aufnahme einer vollständigen Begleitperson zu schlecht aus, so ist
Verdeckungskurve nach Feldmann das bei der Bewertung in geeigneter
ausgemessen werden. Die entspre- Weise zu berücksichtigen.
chenden Messwerte sind in das
Audiogramm einzuzeichnen8). Sollte Der Sprachtest wird monaural über Kopf-
hierdurch die Übersichtlichkeit der hörer mithilfe der Zahlwörter und der
Darstellung gefährdet sein, sind sepa- Einsilber des Freiburger Tests (gemäß
rate Audiogrammformulare zu verwen- DIN 45 621-1 und DIN 45 626-1) durchge-
den. führt. Für die Aufnahme sind digitale
Tonträger entsprechend dem aktuellen
Neben arbeitsbedingten Noxen (bei- Stand der Technik zu verwenden.
spielsweise Lärm, Innenohrtraumen)
kommen für einen Tinnitus auch andere Der Hörverlust für Zahlwörter (in dB)
Ursachen infrage (siehe Tinnitus-Leit orientiert sich nach dem 50-prozentigen
linie der DGHNOKHC). Verständnis. Die Verstehenskurven für
Zahlwörter sind in Lautstärkenstufen
von 5 dB aufzunehmen, wobei so viele
3.7 Sprachaudiometrie Stufen geprüft werden müssen, dass
eine vollständige Kurve von 0 % bis
Der sprachaudiometrische Befund bildet 100 % Verstehen dargestellt wird. Die
in der Regel die wichtigste Grundlage für Verständlichkeit der Einsilber (in Pro-
die Bewertung der MdE. Auch bei Versi- zent) ist in Stufen von 10 dB zu bestim-
cherten, deren Muttersprache nicht men. Hierbei sind die Pegel von 60, 80
Deutsch ist, sollte immer eine sprachau- und 100 dB in jedem Fall einzubeziehen.
diometrische Untersuchung mit dem Alle einzelnen Messwerte sind eindeutig
Freiburger Test versucht werden. Fällt identifizierbar in das Sprachaudio-
das Ergebnis wegen mangelnder Beherr- gramm einzuzeichnen und zu Kurven für
schung der deutschen Sprache im Ver- das Verstehen der Zahlwörter und der
gleich zu anderen Ergebnissen der Hör- Einsilber zu verbinden.
8) Standardisierte Messsymbole sind dem Beitrag „Die Bewertung von Tinnitus in der
gesetzlichen Unfallversicherung“ (Brusis und Michel, 2009) zu entnehmen.
24Diagnostik (Allgemeines)
Wegen der Entscheidung zur Hörgeräte- eine Neurologin/Psychiaterin bzw.
versorgung ist zusätzlich bei 65 dB zu einen Neurologen/Psychiater bei beson-
messen. ders schweren Fällen von Tinnitus) oder
eine stationäre Beobachtung für erfor-
derlich gehalten, so ist hierzu zunächst
3.8 Gleichgewichtsprüfung das Einverständnis des UV-Trägers ein-
zuholen.
Es ist immer eine orientierende Prüfung
auf Spontan- und Provokations-Nystag- Die differenzialdiagnostische Abklärung
mus unter der Leuchtbrille vorzuneh- von Schwerhörigkeiten anderer Ursa-
men. Ergeben sich hierbei Hinweise auf chen ist nicht Gegenstand der Begut-
eine vestibuläre Störung, so ist eine achtung.
weiterführende Vestibularisprüfung
einschließlich einer kalorischen Prüfung
vorzunehmen. Eine weiterführende
Vestibularisprüfung ist auch erforder-
lich, wenn in der Vorgeschichte Schwin-
del angegeben wurde und/oder wenn
das Hörvermögen eine starke Seiten
differenz aufweist.
3.9 Ergänzende Untersuchun-
gen
Ist nach Ziffern 3.1 bis 3.8 eine abschlie-
ßende gutachterliche Beurteilung des
Ursachenzusammenhangs nicht mög-
lich, so können weitere Untersuchungen
angezeigt sein, z. B. mittels bildgeben-
der Verfahren, Simulations-Tests (Hör-
schwellenbestimmung mit akustisch
evozierten Potenzialen). Wird z. B. eine
nochmalige Einbestellung der unter-
suchten Person, die Durchführung einer
Computertomografie (CT) oder einer
Kernspinresonanztomografie (MRT),
eine Zusatzbegutachtung (etwa durch
25Sie können auch lesen