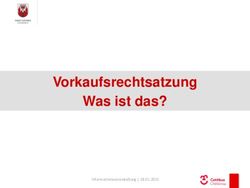Fall 6: Bruno Baulustig und die Baulust
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Professor Dr. Christoph Enders Wintersemester 2013/2014
LEO Baurecht – Fälle und Lösungen
Fall 6: Bruno Baulustig und die Baulust
prozessual: isolierte Anfechtungsklage gegen einen Widerspruchsbescheid; Zulässigkeit und Begründetheit eines
Nachbarwiderspruchs; Verpflichtungsklage auf Erlass eines Widerspruchsbescheides
materiell-rechtlich: Rechtsgrundlage für den Widerspruchsbescheid; Zulässigkeit eines Vorhabens im
unbeplanten Innenbereich; Baugenehmigung mit stillem Dispens
Ausgangsfall
Bruno Baulustig (B) besitzt ein Grundstück mit einem zweigeschossigen Haus in der kleinen
sächsischen kreisangehörigen Gemeinde Alf. Das Grundstück befindet sich in einem Gebiet,
für welches kein Bebauungsplan existiert. Dieses Gebiet ist durch Wohnbebauung geprägt. In
unmittelbarer Umgebung des Grundstücks befinden sich noch mehrere kleine Läden, die von
den umliegenden Bewohnern frequentiert werden, ein kleines Schuhfachgeschäft mit einer
Ein-Mann-Werkstatt, sowie eine Änderungsschneiderei und drei Restaurants.
Da B in seinem gut gehenden Architektenbüro häufig bis spät in die Nacht arbeitet, empfindet
er seinen bisherigen Arbeitsweg in die Innenstadt inzwischen als zu weit. Er beschließt
deshalb, sein Architektenbüro (sechs Angestellte) dadurch in die Nähe seiner Wohnung zu
verlegen, dass er einen zweigeschossigen Anbau seines Hauses plant und hierfür die
Baugenehmigung beantragt. Der Anbau soll auf dem ebenfalls ihm gehörenden
Nachbargrundstück errichtet werden und einen eigenen Eingang erhalten; bis auf ein Zimmer
im Dachgeschoss, in das der Sohn des B einziehen will, soll der Anbau der Unterbringung
seines Architektenbüros dienen; infolge der Großaufträge, die B bearbeitet, ist ein starker und
bis in die Abendstunden währender An- und Abfahrtsverkehr von Klienten und
Rechtsanwälten zu erwarten.
Die beantragte Baugenehmigung wird dem B am 02.01.2012 erteilt; Mitte Januar 2013
beginnt er mit den Bauarbeiten. Am 05.02.2013 ficht nun allerdings der Nachbar Norbert
Nixmach (N) die Baugenehmigung, die ihm seinerzeit nicht bekannt gegeben wurde, obwohl
er im Jahre 2011 am Verfahren beteiligt war, wegen Verstoßes gegen nachbarschützende
Vorschriften mit seinem Widerspruch an. Er müsse ein solches „gewerbliches“ Unternehmen
in dem sonst ruhigen Gebiet schließlich nicht hinnehmen. Daraufhin hebt die Landesdirektion
nach Anhörung des B, der auf seiner Rechtsposition beharrt und nur hilfsweise eine
Abweichung beantragt, die Baugenehmigung auf. Dazu führt sie aus, dass auch eine
ausnahmsweise Abweichung von den gesetzlichen Vorgaben zu Gunsten des B nicht in
Betracht kommt. Der Erhalt eines insgesamt ruhigen Wohngebiets sei insoweit vorrangig.
Nunmehr erhebt B fristgerecht Klage vor dem Verwaltungsgericht: Mit einem Widerspruch
habe er nach so langer Zeit nicht mehr zu rechnen brauchen. Sein Bauvorhaben genieße daher
unabhängig von möglichen Rechtsverstößen Bestandsschutz; jedenfalls müssten ihm die im
Vertrauen auf die Genehmigung getätigten Aufwendungen ersetzt werden. Darüber hinaus sei
schon gar nicht ersichtlich, wie N durch den Anbau gestört werden könne, dieser passe sich
baulich hervorragend an das Hauptgebäude an, und die darin ausgeübte Tätigkeit rufe
gleichfalls keine unzumutbaren Belästigungen für die Nachbarschaft hervor.
Frage: Wie sind die Erfolgsaussichten der Klage zu beurteilen?
1Professor Dr. Christoph Enders Wintersemester 2013/2014
LEO Baurecht – Fälle und Lösungen
Abwandlung
Wie im Ausgangsfall, aber nach einem halben Jahr hat die Widerspruchsbehörde noch immer
nicht über den Widerspruch des N entschieden. Zu diesem Zeitpunkt ist der Anbau bereits
fertig. B will die unsichere Lage beenden. Er erhebt Klage vor dem Verwaltungsgericht, die
Widerspruchsbehörde zum Erlass eines Widerspruchsbescheids zu verpflichten.
Frage: Wäre eine solche Klage zulässig?
Vgl. BVerwGE 94, 151; BVerwG, NVwZ 1996, S. 787; BVerwG, DVBl 1996, S. 1315; BVerwG NVwZ 2001,
1284; VGH Mannheim, ESVGH 43, 142; speziell zum Begriff des Doppelhauses: BVerwG, NVwZ 2000, S.
1055; VGH München, NVwZ-RR 2001, S. 228; Dürr, Das öffentliche Baunachbarrecht, DÖV 1994, S. 841 ff.;
zur Abwandlung: Fallbearbeitung bei Heckmann, JuS 1999, S. 986.
2Professor Dr. Christoph Enders Wintersemester 2013/2014
LEO Baurecht – Fälle und Lösungen
Lösung Fall 6: Bruno Baulustig und die Baulust
Ausgangsfall: Klage des B vor dem VG gegen den Widerspruchsbescheid
A. Zulässigkeit
I. Verwaltungsrechtsweg
Erforderlich ist zunächst, dass der Verwaltungsrechtsweg eröffnet ist. Mangels
aufdrängender Sonderzuweisungen richtet sich dies nach § 40 Abs. 1 Satz 1 VwGO.
Hiernach ist der Verwaltungsrechtsweg in allen öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten
nichtverfassungsrechtlicher Art eröffnet. Die streitentscheidenden Normen entstammen in
diesem Fall dem öffentlichen Baurecht und sind damit öffentlich-rechtlicher Natur. Eine
öffentlich-rechtliche Streitigkeit nichtverfassungsrechtlicher Art liegt vor (da mit B ein
Bürger beteiligt), eine abdrängende Sonderzuweisung besteht nicht.
Der Verwaltungsrechtsweg nach § 40 Abs. 1 VwGO ist eröffnet.
II. Statthafte Klageart
Entscheidend für die Bestimmung der statthaften Klageart ist das Begehren des Klägers.
Im Ergebnis will der B die Baugenehmigung, einen (begünstigenden) VA (vgl. § 35
VwVfG) erstreiten. Die vorliegende Situation unterscheidet sich jedoch insofern von der
Situation der Verpflichtungsklage, als B die begehrte Begünstigung ursprünglich von der
Ausgangsbehörde zugesprochen wurde. Er wurde erst durch den aufhebenden
Widerspruchsbescheid beschwert. Für diesen Fall lässt § 79 Abs. 1 Nr. 2 VwGO die
alleinige „isolierte Anfechtung“ des allein belastenden Widerspruchsbescheids zu; der
ursprüngliche begünstigende VA lebt danach wieder auf (vgl. Schenke,
Verwaltungsprozessrecht, Rdnr. 281a).
Richtige Klageart ist folglich die Anfechtungsklage nach § 42 Abs. 1, 1. Alt. VwGO
(einschränkend Hufen, Verwaltungsprozessrecht, § 14, Rdnr. 18: Das Wiederaufleben des
VA ist nur dann denkbar, wenn man auch dem aufgehobenen VA noch eine latent
fortexistierende „innere Wirksamkeit“ zugesteht, die zumindest bis zum Eintritt der
Unanfechtbarkeit der Aufhebung durch den Widerspruchsbescheid besteht. Dogmatisch
richtiger, zumindest vertretbar ist seiner Ansicht nach in diesem Fall die
Verpflichtungsklage auf die beantragte und durch den Widerspruchsbescheid aufgehobene
Baugenehmigung. Folgt man dieser Ansicht, so müsste man in der Begründetheit zunächst
einen materiell-rechtlichen Anspruch des Bauherrn auf Erteilung der Baugenehmigung
3Professor Dr. Christoph Enders Wintersemester 2013/2014
LEO Baurecht – Fälle und Lösungen
prüfen. Nur sofern dieser besteht, hat B auch Anspruch auf Fortbestehen der ursprünglich
erteilten Baugenehmigung. Der Widerspruchsbescheid wäre dann rechtswidrig.)
III. Klagebefugnis
Nach § 42 Abs. 2 VwGO muss B geltend machen können, durch den
Widerspruchsbescheid in seinen Rechten verletzt zu sein. B ist Adressat des ihn
belastenden (weil die ihn begünstigende Baugenehmigung aufhebenden)
Widerspruchsbescheids. Aus diesem Grund besteht die Möglichkeit, dass er zumindest in
seinem Grundrecht aus Art. 2 Abs. 1 GG verletzt ist (sog. Adressatentheorie). Außerdem
hat B nach § 72 Abs. 1 SächsBO bei Vorliegen der dort genannten Voraussetzungen einen
Anspruch auf Erteilung der Baugenehmigung. Wenn ihm diese nun wieder genommen
wird, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass B in seinem Recht aus § 72 Abs. 1
SächsBO verletzt ist. B ist klagebefugt. (Soweit eine Verpflichtungsklage statthaft ist,
ergibt sich hieraus dann die Klagebefugnis, da die Möglichkeit der Verletzung in einem
subjektiven öffentlichen Recht besteht).
IV. Passive Prozessführungsbefugnis
Fraglich ist, wer passiv prozessführungsbefugt ist. Dies richtet sich nach § 78 Abs. 1 Nr.1
i. V. mit § 78 Abs. 2 VwGO: Die Klage muss gegen den Rechtsträger der Behörde
gerichtet werden, die den Widerspruchsbescheid erlassen hat. Rechtsträger der hier tätig
gewordenen Widerspruchsbehörde, der Landesdirektion, ist der Freistaat Sachsen. Er ist
folglich passiv prozessführungsbefugt.
V. Beteiligtenfähigkeit
B ist als natürliche Person beteiligtenfähig nach § 61 Nr. 1, 1. Alt. VwGO. Die
Beteiligtenfähigkeit des Freistaates Sachsen als juristische Person des öffentlichen Rechts
richtet sich gleichfalls nach § 61 Nr. 1, 2. Alt. VwGO; § 6 Abs. 1 Satz 1 SächsVwOrgG.
VI. Prozessfähigkeit
Die Prozessfähigkeit des B ergibt sich aus § 62 Abs. 1 Nr. 1 VwGO. Der Freistaat Sachsen
wird gemäß § 62 Abs. 3 VwGO, § 58 Abs. 1 Nr. 1 SächsJG i.V.m. § 4 Abs. 1
SächsVertrVO durch den Präsidenten der Landesdirektion gesetzlich vertreten.
4Professor Dr. Christoph Enders Wintersemester 2013/2014
LEO Baurecht – Fälle und Lösungen
VII. Vorverfahren
Ein erneutes Vorverfahren ist nach § 68 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 VwGO entbehrlich, denn
die Widerspruchsbehörde hat bereits entschieden (vgl. Bosch/ Schmidt, Praktische
Einführung, § 26 III 2., S.126; Hufen, Verwaltungsprozessrecht, § 6, Rdnr. 22). Bei einer
Verpflichtungsklage würde dasselbe gelten, vgl. § 68 Abs. 2 VwGO.
VIII. Klagefrist
Laut Sachverhalt ist davon auszugehen, dass B die Klagefrist des § 74 Abs. 1 Satz 1
VwGO eingehalten hat.
IX. Zwischenergebnis
Die Klage des B ist zulässig.
B. Notwendige Beiladung
Nach teilweise vertretener Auffassung gehört die Beiladung nicht zur Prüfung der
„Erfolgsaussichten einer Klage“ des Bauherrn (ihre Prüfung wird daher im Gutachten als
verfehlt betrachtet), sie wird aber vom Gericht (praktisch) geprüft werden müssen, um die
Bindungswirkung zu erreichen.
Nach § 65 Abs. 2 VwGO sind Dritte beizuladen, die an einem Rechtsverhältnis derart
beteiligt sind, dass die Entscheidung auch ihnen gegenüber nur einheitlich ergehen kann.
Gäbe das Gericht der Klage statt, so wäre auch der Nachbar N betroffen, denn der ihn
begünstigende Widerspruchsbescheid müsste aufgehoben werden. N ist folglich derart an
dem Rechtsverhältnis beteiligt, dass die Entscheidung des Gerichts auch ihm gegenüber
einheitlich ergehen muss. Folglich ist N beizuladen.
5Professor Dr. Christoph Enders Wintersemester 2013/2014
LEO Baurecht – Fälle und Lösungen
C. Begründetheit
Die Klage des B wäre begründet, wenn die Aufhebung der Baugenehmigung rechtswidrig
und B hierdurch in seinen Rechten verletzt wäre, § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO.
Im Fall der Verpflichtungsklage nach § 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO, wenn die Ablehnung der
Erteilung rechtswidrig und B dadurch in seinen Rechten verletzt ist. Das ist dann der Fall,
wenn er einen Anspruch auf Erteilung der Baugenehmigung hat.
I. Rechtmäßigkeit der Aufhebung
1. Rechtsgrundlage
Rechtsgrundlage der Aufhebung sind die §§ 68 ff. VwGO.
Anmerkung: Rechtsgrundlage sind also nicht § 1 SächsVwVfZG, §§ 50, 48 Abs. 1 VwVfG
[Rücknahme eines rechtswidrigen VA]. Einerseits handelt es sich bei dem Vorverfahren
und dem möglichen Rücknahmeverfahren um zwei voneinander zu trennende
selbstständige Verwaltungsverfahren. Andererseits ist die Landesdirektion nach § 1
SächsVwVfZG, § 48 VwVfG (Abs. 5 regelt insoweit nur die örtliche Zuständigkeit, vgl.
Kopp/Ramsauer, VwVfG, 6. Aufl. 2000, § 48 Rdnr. 148), § 57 Abs. 1 Satz 2, Satz 2 Nr. 1
SächsBO unzuständig. Nach ganz h. A. wendet sich deshalb auch § 50 VwVfG
ausschließlich an die Ausgangsbehörde (vgl. Ule/Laubinger, Verwaltungsverfahrensrecht,
4. Auflage, 1995, § 64 Rdn. 6; § 61 Rdnr. 4; a. A. Kopp/Ramsauer, VwVfG, 6. Aufl. 2000, §
50 Rdnr. 30; ausführliche Nachweise zum Streitstand bei Remmert, VerwArch 91 [2000],
S. 209 [210, Fn. 6]; Zweifel an § 68 ff.VwGO werden dabei hauptsächlich aus
Kompetenzgründen geltend gemacht, vgl. Pestalozza, in: von Mangoldt/Klein/Pestalozza,
GG, Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 Rdnr. 109, 112, 114, 125 f., 165 ff. ). Die Landesdirektion hat
allenfalls nach Missachtung einer schriftlichen Weisung und Fristsetzung zur Rücknahme
gegenüber dem Landkreis ein Selbsteintrittsrecht, §§ 58 Abs. 1 und 5 Satz 1, 57 Abs. 1 Satz
1 Nr. 2 SächsBO. Eine derartige Weisung ist dem Sachverhalt nach nicht ersichtlich. Es
kann in der vorliegenden Situation außerdem dahinstehen, ob und inwieweit bei der
Aufhebung des VA die Einschränkungen der Vorschriften der §§ 48, 49 VwVfG bzw. der
entsprechenden Regelungen der Landes-VwVfG zu beachten sind (vgl. hierzu bereits Fall
4). Denn hier hat nicht der Widerspruchsführer Widerspruch gegen den aufgehobenen VA
erhoben, sondern ein Dritter, so dass ohnehin die Vorschrift des § 50 VwVfG zur
Anwendung gelangen müsste.
6Professor Dr. Christoph Enders Wintersemester 2013/2014
LEO Baurecht – Fälle und Lösungen
2. Formelle Rechtmäßigkeit
a) Zuständigkeit
Hier hat die Landesdirektion den Widerspruchsbescheid erlassen. Ihre
Zuständigkeit richtet sich nach den §§ 73 Abs. 1 Nr. 1 VwGO. Die Erteilung der
Baugenehmigung liegt gemäß § 57 Abs. 1 Satz 2, Satz 1 Nr. 1 SächsBO
grundsätzlich im Aufgabenbereich des Landkreises als unterer Bauaufsichtsbehörde.
Mangels gegenteiliger Angaben im Sachverhalt kann davon ausgegangen werden,
dass dieser dem B die Baugenehmigung auch erteilt hat. Demzufolge war die
Landesdirektion als nächst höhere Behörde (§ 57 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SächsBO,
obere Bauaufsichtsbehörde) für den Erlass des Widerspruchsbescheids zuständig.
b) Verfahrensfehler
Nach § 71 VwGO soll derjenige, der durch das Widerspruchsverfahren beschwert
wird, vor Erlass des Widerspruchsbescheids gehört werden. B ist selbst der erstmalig
durch die Aufhebung der Baugenehmigung Beschwerte (während N den
Widerspruch geführt hat).
Eine Anhörung ist laut Sachverhalt auch erfolgt.
c) Form
Nach § 73 Abs. 3 Satz 1 VwGO ist der Widerspruchsbescheid zu begründen, mit
einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen und zuzustellen.
3. Materielle Rechtmäßigkeit
Die Aufhebung der Baugenehmigung (im Widerspruchsverfahren) wäre materiell
rechtswidrig, wenn der Widerspruch des N unzulässig oder unbegründet gewesen
ist. Denn: Während im zweiseitigen Rechtsverhältnis Vertrauensschutzgesichtspunkte
(zugunsten des Widerspruchsführers) nicht zum Tragen kommen, steht der
Widerspruchsbehörde mit Rücksicht auf die Dritt-Rechtsposition des B nur eine
eingeschränkte Sachherrschaft über das Verfahren zu (vgl. BVerwGE 65, 313 [318
f.]).
Die Aufhebung wäre daher nur rechtmäßig, wenn der Widerspruch des Nachbarn
zulässig und begründet ist, soweit es auf eine Ermessensentscheidung der
Widerspruchsbehörde ankommt (Ausnahme, Befreiung zugunsten des Bauherrn?), auch
dann, wenn die Widerspruchsbehörde ermessensfehlerfrei zu Gunsten des Nachbarn
7Professor Dr. Christoph Enders Wintersemester 2013/2014
LEO Baurecht – Fälle und Lösungen
entschieden hat. Die Aufhebung wäre in diesem Fall insbes. rechtswidrig, wenn das
(Ausnahme-/Befreiungs-) Ermessen der Widerspruchsbehörde zugunsten des
Bauherrn B auf Null reduziert war (vgl. dazu BVerwGE 117, 50 [54 ff.]) .
a) Zulässigkeit des Widerspruchs des N
Ist ein Widerspruch des N unzulässig, so ist er zurückzuweisen; die
Widerspruchsbehörde ist in diesem Fall nicht berechtigt, zur Sache zu entscheiden.
Die Zulässigkeitsvoraussetzungen sind insofern
Sachentscheidungsvoraussetzungen des Widerspruchsbescheids (Dies gilt selbst
dann, wenn mit dem BVerwG eine Sachherrschaft der Widerspruchsbehörde
angenommen wird, da insoweit ein Dritter – der B – schon eine Rechtsposition
innehat, vgl. Hufen, Verwaltungsprozessrecht, § 9, Rdnr. 7 m. w. N.).
Zulässig ist der Widerspruch des N bei Vorliegen der
Sachentscheidungsvoraussetzungen.
aa) Streitigkeit, für die der Verwaltungsrechtsweg eröffnet wäre
Streitentscheidende Normen sind öffentlich-rechtliche, solche des BauGB und der
SächsBO. Daher liegt eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit nichtverfassungs-
rechtlicher Art vor, der Verwaltungsrechtsweg ist analog § 40 Abs. 1 Satz 1
VwGO eröffnet.
bb) Statthaftigkeit
Der Widerspruch des N wäre gem. § 68 Abs. 1 Satz 1 VwGO vor Erhebung der
Anfechtungsklage statthaft. N müsste sich folglich gegen einen ihn belastenden
VA wenden, vgl. § 42 Abs. 1, 1. Alt. VwGO. Der Widerspruch des N richtet sich
gegen die Baugenehmigung, die dem B erteilt wurde. Diese stellt einen VA
i. S. des § 1 SächsVwVfZG, § 35 VwVfG dar. Der Widerspruch ist demnach
statthaft.
cc) Widerspruchserhebung bei zuständiger Behörde
Mangels weiterer SV-Angaben ist davon auszugehen, dass N sich an die
Ausgangsbehörde, d.h. den Landkreis, oder Widerspruchsbehörde gewandt hat, §
70 Abs. 1 VwGO.
8Professor Dr. Christoph Enders Wintersemester 2013/2014
LEO Baurecht – Fälle und Lösungen
dd) Beteiligtenbezogene Zulässigkeitsvoraussetzungen
N ist nach § 1 SächsVwVfZG i.V.m. § 11 Nr. 1 VwVfG beteiligtenfähig und nach
§ 12 Nr.1 VwVfG handlungsfähig.
ee) Widerspruchsbefugnis
Analog § 42 Abs. 2 VwGO muss N geltend machen können, durch den
angegriffenen VA in eigenen Rechten verletzt zu sein. Da N nicht Adressat der
Baugenehmigung ist (dies war nur der B), ist die Adressatentheorie in diesem
Fall nicht anwendbar.
Auf einen Verstoß gegen § 70 SächsBO kann sich N nicht berufen, da er am
Verfahren beteiligt war.
Als drittschützende Normen, die verletzt sein könnten, kommen hier aber
Normen des Bauplanungsrechts in Betracht, die die Zulässigkeit des Vorhabens
des B regeln. Voraussetzung ist, dass es sich um ein Vorhaben nach § 29 BauGB
handelt:
Nach § 29 Abs. 1 BauGB ist der Anwendungsbereich der §§ 30 ff. BauGB dann
eröffnet, wenn es sich um ein Vorhaben handelt, das die Errichtung, Änderung
oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen zum Inhalt hat. Der
Vorhabenbegriff bezieht sich einmal (Merkmal des Bauens) auf bauliche
Anlagen, die in einer auf Dauer gedachten Weise künstlich mit dem Erdboden
verbunden sind. Zum anderen muss das Vorhaben i. S. des § 29 Abs. 1 BauGB,
die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung, abweichend von §§ 59 Abs. 1,
2 Abs. 1 SächsBO, von einiger bodenrechtlicher Relevanz sein (vgl. dazu
E/Z/B, BauGB, § 29 Rdnr. 24, 28). Diese Voraussetzungen sind bei dem Anbau,
um den es hier geht, erfüllt: dabei kann zunächst offen bleiben, ob es sich um die
Änderung einer bestehenden baulichen Anlage handelt oder eine Neuerrichtung
(eines Doppelhauses) vorliegt. Der Anbau ist schon angesichts seiner Größe, vor
allem aber wegen der ihm zugedachten Funktion (dazu E/Z/B, a.a.O., Rdnr. 29)
geeignet, die in § 1 Abs. 6 (hier etwa: Nr. 1: allgemeine Anforderungen an
gesunde Wohn- u. Arbeitsbverhältnisse) BauGB genannten Belange in einer
Weise zu berühren, die das Bedürfnis nach einer ihre Zulässigkeit verbindlich
regelnden Bauleitplanung hervorruft (Verhältnis Wohnnutzung – störende
gewerbliche/freiberufliche Nutzung).
9Professor Dr. Christoph Enders Wintersemester 2013/2014
LEO Baurecht – Fälle und Lösungen
Für das Baugebiet besteht selbst kein B-Plan, so dass sich die Frage der
bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit und damit die möglichen
nachbarschützenden Normen nach § 34 BauGB richtet (dass das Vorhaben
nicht im Außenbereich liegt, ergibt sich hier daraus, dass umliegend Bebauung
vorhanden ist, die den Eindruck der Geschlossenheit und Zusammengehörigkeit
vermittelt und Ausdruck einer organischen Siedlungsstruktur ist, so dass ein im
Zusammenhang bebauter Ortsteil besteht). Danach muss es sich nach Art und
Maß in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen. Hier könnte die Eigenart
der Umgebung einem der Baugebiete nach BauNVO entsprechen, so dass sich die
Zulässigkeit der Art des Vorhabens nach den § 1 Abs. 2, §§ 2 ff. BauNVO richten
könnte, vgl. § 34 Abs. 2 BauGB:
Damit stellt sich die Frage, ob dem Nachbarn aus dem Gebot des „Einfügens“
hinsichtlich der Art ein eigenes, ein subjektives öffentliches Recht entstehen
kann, ob er sich auf einen möglichen Verstoß hiergegen berufen darf: Nach der
Schutznormtheorie ist dies dann der Fall, wenn die Norm zumindest auch seinen
Rechten zu dienen bestimmt ist und er sich darauf berufen kann (vgl. BVerwG,
DVBl 1999, 101 [102]). Werden Baugebiete nach der BauNVO in einem
Bebauungsplan festgesetzt, so hat diese Festsetzung nach neuerer Auffassung des
BVerwG kraft Bundesrechts nachbarschützende Wirkung, d. h. der Nachbar darf
sich auf die festgesetzte Gebietsart unabhängig davon berufen, ob die mögliche
Abweichung ihn tatsächlich beeinträchtigt (vgl. BVerwGE 94, 151 [155]).
Begründen lässt sich dies damit, dass die genannten Festsetzungen Inhalt und
Schranken des Grundeigentums bestimmen und damit gleichzeitig auf den
Ausgleich möglicher Bodennutzungskonflikte abzielen. „Bauplanungs-
rechtlicher Nachbarschutz beruht damit auf dem Gedanken des wechselseitigen
Austauschverhältnisses. Weil und soweit der Eigentümer eines Grundstücks in
dessen Ausnutzung öffentlich-rechtlichen Beschränkungen unterworfen ist, kann
er deren Beachtung grundsätzlich auch im Verhältnis zum Nachbarn durchsetzen“
(vgl. BVerwG, a.a.O., S. 155; BVerwG NVwZ 1996, 787, 788). Die
Planbetroffenen werden so zu einer rechtlichen Schicksalsgemeinschaft
verbunden.
Aus der Verweisung in § 34 Abs. 2 BauGB hinsichtlich der Art der baulichen
Nutzung auf die Festsetzungen der BauNVO ergibt sich, dass für solche –
10Professor Dr. Christoph Enders Wintersemester 2013/2014
LEO Baurecht – Fälle und Lösungen
„faktisch“ den in der BauNVO geregelten Gebieten gleichenden – Baugebiete der
Bundesgesetzgeber einen entsprechenden Interessenausgleich vorgesehen hat, so
dass sich der Nachbar auch hier auf die Einhaltung der Gebietsart kraft BauGB
berufen darf (vgl. BVerwGE 94, 151 [156]; im Ergebnis ebenso Dürr, DÖV 1994,
841 [848]; nicht nachbarschützend ist demgegenüber das Maß, BVerwG, UPR
1995, 396): Gebietserhaltungsanspruch (BVerwG NVwZ-RR 1999, S. 105;
BVerwG NVwZ 2004, S. 1244).
Im hier zu bearbeitenden Sachverhalt kann das betroffene Gebiet entweder als
(faktisches) Allgemeines Wohngebiet i. S. des § 4 BauNVO qualifiziert werden
oder mit vertretbarer Argumentation auch noch als Reines Wohngebiet i. S. des §
3 BauNVO (allerdings passen insoweit die Restaurants nicht hinein). Damit
richtet sich die Zulässigkeit nach den Normen BauNVO betreffend die Art der
baulichen Nutzung.
§ 13 BauNVO konkretisiert, inwieweit Gebäude und Räume für freie Berufe in
diesem Gebiet zulässig sind. Die Vorschrift zielt darauf ab, dass der (Wohn-)
Gebietscharakter gewahrt bleibt (BVerwGE 68, 324; BVerwG NVwZ 2001, 1284
[1285]). § 13 BauNVO hat insofern an der nachbarschützenden Wirkung der
Gebietsart teil, denn auch er betrifft die Art der baulichen Nutzung (vgl. BVerwG,
NVwZ 1996, 787, 788). Es besteht die Möglichkeit, dass N durch die
Genehmigung des Anbaus in seinem Recht auf Einhaltung der Gebietsart nach §§
3 bzw. 4 i. V. mit § 13 BauNVO verletzt worden ist, denn es kann nicht völlig
ausgeschlossen werden, dass der Anbau insofern den Anforderungen an die
zulässige (gebietsypische) Art der baulichen Nutzung widerspricht.
Anmerkung: Ein Rückgriff auf § 15 Abs. 1 BauNVO erübrigt sich. Der
Nachbarschutz aus der Festsetzung des Baugebietes geht weiter als der Schutz
des Rücksichtnahmegebotes in § 15 Abs. 1 BauNVO, der solche
Beeinträchtigungen voraussetzt. Auf die Bewahrung der festgesetzten Gebietsart
hat der Nachbar einen Anspruch auch dann, wenn das baugebietswidrige
Vorhaben im Einzelfall noch nicht zu einer spürbaren und nachweisbaren
Beeinträchtigung des Nachbarn führt (vgl. BVerwGE 94, 151, 161). Auch die
Ausnahmen nach § 31 BauGB (zu dessen entspr. Anwendung im Bereich des § 34
Abs. 2 BauGB, vgl. Erbguth/Wagner, Bauplanungsrecht, 3. Aufl. 1998, Rdnr. 395)
brauchen nicht hinsichtlich ihrer nachbarschützenden Wirkungen untersucht zu
werden. Ebenfalls muss die tatsächlich spürbare, nachweisbare Beeinträchtigung
durch handgreifliche Betroffenheit oder besondere Intensität der
Beeinträchtigung – anders als bei § 15 Abs. 1 BauNVO – nicht dargelegt werden.)
11Professor Dr. Christoph Enders Wintersemester 2013/2014
LEO Baurecht – Fälle und Lösungen
ff) Verfristung
Die Monatsfrist des § 70 Abs. 1 VwGO, auch die Jahresfrist nach §§ 70 Abs. 2,
58 Abs. 2 VwGO – eine Rechtsbehelfsbelehrung erfolgte nicht – werden nur bei
ordnungsgemäßer Bekanntgabe in Lauf gesetzt, § 43 Abs. 1 VwVfG. Daran fehlt
es. Der Widerspruch des N wäre danach nicht verfristet (vgl. Hufen, § 6, Rn. 34
f.).
Nach überwiegender Ansicht folgen jedoch aus dem nachbarlichen
Gemeinschaftsverhältnis gemäß Treu und Glauben rechtliche
Verhaltenspflichten. Auch ohne Bekanntgabe muss sich daher der Nachbar die –
sichere – Kenntnis oder Kenntnismöglichkeit des Verwaltungsakts, z. B. durch
sichtbare Bautätigkeit, zurechnen lassen. Unternimmt er keine rechtlichen
Schritte, ist das Vertrauen des Bauherrn in den Bestand seiner Genehmigung
geschützt und eine spätere Anfechtung durch den Nachbarn unzulässige
Rechtsausübung. Deshalb gelten §§ 70, 58 Abs. 2 VwGO unmittelbar, so dass ab
Kenntnis bzw. Kenntnismöglichkeit die Jahresfrist zu laufen beginnt (vgl.
BVerwGE 44, 294, 298 ff.; vgl. Hufen, § 6, Rdnr. 49; Bosch/Schmidt, § 26 IV. 2.
a. bb., S. 130). Hier hat N die Baugenehmigung nur wenige Wochen nach
Aufnahme der Bautätigkeit und damit seiner Kenntnisnahmemöglichkeit
angefochten (Seine frühere Beteiligung am Genehmigungsverfahren führt
mangels Mitteilung eines Ergebnisses nicht zu einer hinreichenden
Kenntnismöglichkeit). Die Jahresfrist ist somit nicht ausgeschöpft und das
Widerspruchsrecht noch nicht verwirkt worden.
Exkurs: Gegebenenfalls kann die Aufhebung eines VA auch nach Eintritt der
Bestandskraft begehrt werden.
Eine Aufhebung kann zunächst durch einen Antrag auf Wiederaufgreifen
des Verfahrens nach § 51 VwVfG erreicht werden (sogenanntes
"Wiederaufgreifen des Verfahrens im engeren Sinne"):
• Zulässig ist ein solcher Antrag bei
- Unanfechtbarkeit des VA, § 51 Abs. 1 VwVfG,
- Fehlen groben Verschuldens, § 51 Abs. 2 VwVfG,
- Einhaltung der Antragsfrist, § 51 Abs. 3 VwVfG und
- schlüssiger Darlegung des Wiederaufnahmegrundes
(BVerwG, NJW 1982, 2204; OVG Münster, NVwZ 1986, 51).
• Begründet ist ein solcher Antrag bei
12Professor Dr. Christoph Enders Wintersemester 2013/2014
LEO Baurecht – Fälle und Lösungen
Vorliegen eines Wiederaufnahmegrundes i. S. des § 51 Abs. 1 Nr. 1 -3
VwVfG; Wiederaufnahmegründe sind:
- nachträgliche Änderung der Sach- und Rechtslage,
Beachte: Eine Änderung der höchstrichterlichen
Rechtsprechung ist keine Änderung der Sach-
und Rechtslage i.d.S. (vgl. BVerwG, NJW 1981,
2595; Kopp/Ramsauer, VwVfG, 7. Auflage, § 51
Rdnr. 29 ff. m.w.N.).
- Vorliegen eines neuen Beweismittels und
Beachte: Eine neue Bewertung bereits bekannter
Tatsachen reicht nicht aus. Der neuen Bewertung
müssen auch neue Tatsachen zugrunde liegen.
(vgl. BVerwG, NJW 1990, 199).
- Vorliegen eines Wiederaufnahmegrundes i. S. des § 580 ZPO
• Ist ein Antrag i. S. des § 51 VwVfG zulässig und begründet,
muss die Behörde erneut in der Sache entscheiden, die Gegenstand
des VA war. Für die Frage, welche Entscheidung in der Sache zu
treffen ist oder - bei Ermessensentscheidungen - getroffen werden
kann, kommt es ausschließlich auf das in der Sache anzuwendende
materielle Recht im Zeitpunkt der nunmehr zu treffenden Entscheidung
an (vgl. BVerwG, NJW 1982, 2204; Kopp/Ramsauer, VwVfG, 7.
Auflage, § 51 Rdnr. 18; a. A. wohl: OVG Münster, NVwZ 1986, 134).
Darüber hinaus kann ein Antrag auf erneute Entscheidung auch
unabhängig von den Voraussetzungen des § 51 VwVfG gestellt werden
(sogenanntes "Wiederaufgreifen des Verfahrens i.w.S."); hier steht eine
erneute Entscheidung grundsätzlich im Ermessen der Behörde; etwas
anderes gilt nur dann, wenn infolge einer Ermessensreduzierung auf Null
ausnahmsweise ein Anspruch auf erneute Entscheidung besteht (vgl.
BVerwG NVwZ 2007, 709= Bspr Waldhoff JuS 2008, 266).
• Zulässig ist ein solcher Antrag bei
- Unanfechtbarkeit des VA und
- Vorliegen einer Beschwer des Betroffenen.
• Begründet ist ein solcher Antrag,
wenn infolge einer Ermessensreduzierung auf Null ein Anspruch auf
erneute Entscheidung besteht (vgl. BVerwGE 44, 333, [336]).
• Ist ein Antrag auf Wiederaufgreifen des Verfahrens i.w.S.
zulässig und begründet, muss die Behörde auch hier unter Beachtung
der oben genannten Maßgabe erneut in der Sache entscheiden.
Sowohl gegen eine Ablehnung des Antrags auf Wiederaufgreifen des
Verfahrens als auch gegen eine erneute Entscheidung durch die Behörde
sind die allgemeinen Rechtsbehelfe gegeben (vgl. Kopp/Ramsauer, VwVfG,
7. Auflage, § 51 Rdnr. 53 ff. m.w.N.) Hat die Behörde einen Antrag
abgelehnt oder ohne zureichenden Grund nicht in angemessener Frist
darüber entschieden, so ist streitig, ob der Antragsteller (ggf. nach
Durchführung eines Vorverfahrens)
13Professor Dr. Christoph Enders Wintersemester 2013/2014
LEO Baurecht – Fälle und Lösungen
• sofort Klage auf Verpflichtung der Behörde auf Aufhebung oder
Änderung des VA erheben kann (so: BVerwG, NJW 1982, 2204,
allerdings zu einer nicht im Ermessen der Behörde stehenden
Entscheidung; dem folgend: Kopp/Ramsauer, VwVfG, 7. Auflage, § 51
Rdnr. 53) oder
• zunächst Klage auf Verpflichtung der Behörde auf Wiederaufnahme
des Verfahrens erheben muss (Korber, DÖV 1982, 858 [559]).
gg) Zwischenergebnis
Der Widerspruch des N war zulässig.
b) Begründetheit des Widerspruchs des N
Der Widerspruch des N war auch begründet, sofern die Erteilung der
Baugenehmigung rechtswidrig ist und den N in seinen Rechten verletzt, § 68 Abs. 1
Satz 1 VwGO, § 113 Abs. 1 Satz 1 analog (vgl. Hufen, Verwaltungsprozessrecht, § 9
Rdnr. 8).
Zu beachten ist dabei, dass die Widerspruchsbehörde im Widerspruchsverfahren an
die Stelle der Ausgangsbehörde tritt. Sie kann kraft ihrer Sachherrschaft über das
Verfahren eigene Ermessenserwägungen anstellen und etwaige Ermessensfehler der
Ausgangsbehörde „heilen“. Es darf hier also nicht (nur) darauf abgestellt werden, ob
die „Erteilung der Baugenehmigung durch die Ausgangsbehörde rechtswidrig war“.
Es kommt darauf an, ob die Widerspruchsbehörde die Baugenehmigung aufheben
musste, weil die „Erteilung der Baugenehmigung rechtswidrig wäre“.
Im Grundsatz ist die Entscheidung über die Erteilung der Baugenehmigung nach
§ 72 Abs. 1 SächsBO eine gebundene Entscheidung. Dennoch spielen auch
Ermessenserwägungen eine Rolle: Ist die Baugenehmigung nur unter einer
Ausnahme bzw. einer Befreiung i. S. des § 31 BauGB erteilbar, steht ihr Erlass
im Ermessen der Verwaltung. Damit ist der Widerspruch des Nachbarn auch dann
begründet (und damit die Aufhebung rechtmäßig), wenn trotz Vorliegens eines
(Ausnahme- bzw. Befreiungs-)Tatbestands die Ausgangs-Entscheidung der
Bauaufsichtsbehörde (Erteilung der Baugenehmigung) unzweckmäßig war und die
Widerspruchsbehörde nunmehr ihr Ermessen zu Gunsten des Nachbarn
rechtmäßigerweise ausüben durfte. Das setzt voraus, dass das Ausnahme-
/Befreiungsermessen nicht zugunsten des B reduziert war.
14Professor Dr. Christoph Enders Wintersemester 2013/2014
LEO Baurecht – Fälle und Lösungen
Damit gibt es insgesamt drei Fallkonstellationen: Entweder die Behörde muss
angesichts überragender Interessen ihr Ermessen zu Gunsten des Bauherrn ausüben
(1) (Ermessensreduktion „auf Null“, etwa weil mangels gesetzlich anerkannter
Ablehnungsgründe keine willkürfreie Ablehnung möglich ist, dazu BVerwGE 117,
50 [54 ff.]) oder umgekehrt zu Gunsten des Nachbarn (2), etwa weil
Nachbarrechtspositionen intensiv beeinträchtigt sind. Oder es sind zwar die
tatbestandlichen Voraussetzungen einer Ausnahme oder Befreiung gegeben, ohne
dass eine Ermessenreduktion besteht, so dass eine ermessensfehlerfreie Entscheidung
in die eine wie die andere Richtung möglich ist (3). Gutachtlich ist also zunächst
herauszuarbeiten, ob die Erteilung der Baugenehmigung überhaupt im Ermessen der
Behörde steht, also die tatbestandlichen Voraussetzungen der Ermessensnorm erfüllt
sind, sodann, welche der drei Fallgruppen hier vorliegt. Schließlich wäre bei
Fallgruppe (3) die Fehlerfreiheit der tatsächlichen Ermessensausübung der
Widerspruchsbehörde (im Sachverhalt) zu prüfen.
Mit Blick auf den Gebietserhaltungsanspruch des Nachbarn (Art der baulichen
Nutzung) kommt aber in Fallgruppe (3) eine Ermessensausübung zugunsten des
Bauherrn B nur ausnahmsweise in Betracht, etwa wenn vom seinem Vorhaben nicht
die Gefahr einer späteren Wandlung des Gebietscharakters ausgeht. Zwar ist der
Gebietserhaltungsanspruch von vornherein durch die Möglichkeit der Befreiung nach
§ 31 Abs. 2 BauGB begrenzt. Ihm kommt aber in den meisten Fällen ein nicht
unerhebliches Gewicht zu (vgl. Wortlaut „Grundzüge der Planung“). Die Situation
ist insofern anders als beim Anspruch (des Nachbarn) auf Einschreiten, in der die
bloße Ausnahme-/Befreiungsmöglichkeit ausreicht, einen Einschreitensanspruch des
Nachbarn zu verneinen.
Eines ausdrücklichen Antrags (des Bauherrn) auf Ausnahme oder Befreiung nach
§ 31 BauGB wird es wohl nicht bedürfen, weil die Erteilung von Ausnahme oder
Befreiung nach § 31 BauGB auch im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren zum
Prüfprogramm der Behörde gehört (§ 63 S. 1 Nr. 1 SächsBO, nicht § 63 S. 1 Nr. 2
SächsBO der nicht auf § 67 Abs. 2 Satz 1 und 2 SächsBO, sondern nur auf
umliegende Vorschriften verweist; vgl. Jäde, in: Jäde/Dirnberger/Böhme,
Bauordnungsrecht Sachsen, 41. AL August 2005, § 63 Rn. 31). Die Abweichung
15Professor Dr. Christoph Enders Wintersemester 2013/2014
LEO Baurecht – Fälle und Lösungen
muß aber ausdrücklich zugelassen werden (sonst: Ermessensfehler – Nichtgebrauch
– wegen Verkennung der Notwendigkeit einer förmlichen Abweichung).
Da die Widerspruchsbehörde im vorliegenden Fall nicht zu Gunsten des Bauherrn
entschieden hat, kommt es indes auf die – grundsätzlich denkbare – Situation, dass
sie ohne Ermessensreduzierung zu Gunsten des Bauherrn fehlerfrei entscheiden
kann, nicht an. Die Widerspruchsbehörde hat die Baugenehmigung im
Widerspruchsbescheid aufgehoben; das ist rechtmäßig, wenn das Vorhaben nicht
genehmigungsbedürftig oder nicht genehmigungsfähig und auch eine Ausnahme
oder Befreiung dem B nicht zu erteilen war (dabei tatbestandl. Voraussetzungen und
Ermessen zu prüfen).
aa) Rechtmäßigkeit der Baugenehmigung
(1) Formelle Rechtmäßigkeit der Baugenehmigung
Die Baugenehmigung könnte zum einen formell rechtswidrig sein. Mangels
Angaben im Sachverhalt ist davon auszugehen, dass die Baugenehmigung von
dem nach § 57 Abs. 1 Satz 2, Satz 1 Nr. 1 SächsBO zuständigen Landratsamt
des Landkreises erteilt wurde (s. o. III 1 b aa). Sonstige Verfahrensfehler sind
nicht ersichtlich.
Die Baugenehmigung erging ohne formelle Verstöße.
(2) Materielle Rechtmäßigkeit der Baugenehmigung
Zum anderen müssten die materiellen Voraussetzungen für den Erlass der
Baugenehmigung vorgelegen haben.
(a) Genehmigungsbedürftigkeit des Vorhabens
Das Vorhaben des N müsste zunächst genehmigungsbedürftig sein. Nach §
59 Abs. 1 SächsBO bedürfen die Errichtung, die Änderung, die
Nutzungsänderung und der Abbruch baulicher Anlagen einer
Baugenehmigung.
α Bauliche Anlage
16Professor Dr. Christoph Enders Wintersemester 2013/2014
LEO Baurecht – Fälle und Lösungen
Das Haus muss folglich als bauliche Anlage i. S. des SächsBO zu
qualifizieren sein. Das ist so, denn eine bauliche Anlage ist nach § 2 Abs. 1
Satz 1 SächsBO jede mit dem Erdboden verbundene, aus Bauprodukten
hergestellte Anlage. B beabsichtigt entweder eine Änderung dieses
Gebäudes oder gar die Errichtung eines weiteren Gebäudes (in
geschlossener Bauweise), so dass sein Vorhaben grundsätzlich einer
Baugenehmigung bedarf, soweit nicht § 60 SächsBO greift (hier: –) oder es
sich nicht nur um ein verfahrensfreies oder genehmigungsfreigestelltes
Vorhaben handelt.
β Ausnahme nach § 61 SächsBO – Verfahrensfreiheit
Die Genehmigungsbedürftigkeit könnte nach § 61 SächsBO entfallen. Eine
Ausnahme nach dieser Vorschrift liegt indes nicht vor, insbes. handelt es
sich nicht um Errichtung/Änderung eines Gebäudes nach Nr. 1 der
Vorschrift, auch nicht um eine anforderungsneutrale Nutzungsänderung
nach § 61 Abs. 2 SächsBO.
γ Ausnahme nach § 62 SächsBO – Genehmigungsfreistellung
In Betracht kommt jedoch der Ausnahmetatbestand des § 62 SächsBO,
wonach die Errichtung und Änderung von Vorhaben genehmigungs-
freigestellt ist. Dies gilt nach Abs. 1 für alle Vorhaben, die nicht
Sonderbauten i. S. des § 2 Abs. 4 SächsBO sind. Die
Genehmigungsfreistellung scheitert hier aber daran, dass für das
entsprechende Gebiet gar kein Bebauungsplan existiert, und es damit an
der Voraussetzung nach § 62 Abs. 2 Nr. 1 SächsBO fehlt.
Das Vorhaben ist genehmigungsbedürftig.
(b) Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens
Eine Baugenehmigung ist nach § 72 Abs. 1 SächsBO dann zu erteilen, wenn
dem Vorhaben keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstehen
(die im bauaufsichtlichen Verfahren zu prüfen sind). Der Prüfungsumfang
folgt aus den §§ 63, 64 SächsBO. Nach § 63 SächsBO besteht für
genehmigungsbedürftige Vorhaben, die keine Sonderbauten nach § 2 Abs. 4
SächsBO sind, nur eine eingeschränkte Prüfungspflicht (=Vereinfachtes
Baugenehmigungsverfahren). Um einen Sonderbau, insbesondere ein
17Professor Dr. Christoph Enders Wintersemester 2013/2014
LEO Baurecht – Fälle und Lösungen
Hochhaus handelt es sich bei dem Vorhaben des B nicht (vgl. § 2 Abs. 4
Nr. 1 SächsBO). Die Genehmigung des Anbaus könnte gegen Bau-
planungsrecht, welches auch im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren
zu prüfen ist (vgl. § 63 Satz 1 Nr. 1 SächsBO), verstoßen.
α Vorhaben nach § 29 BauGB: (+) s. o. bei Widerspruchsbefugnis, S. 7 ff.
β Zulässigkeit nach § 34 BauGB
Im Rahmen der Klagebefugnis wurde festgestellt, dass sich das Vorhaben in
einem Gebiet befindet, das im Zusammenhang bebaut ist und daher als
Innenbereich gelten kann, so dass es nach § 34 BauGB zulässig ist, wenn es
sich nach Art und Maß usw. einfügt. Wenn die Umgebungsbebauung einem
der in der BauNVO typisierten Baugebiete entspricht, richtet sich die
Zulässigkeit hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung allein nach § 34
Abs. 2 BauGB i. V. mit den Vorschriften der BauNVO (vgl. Krautzberger,
in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 6. Aufl., § 34 Rn. 46, s. o. bei
Widerspruchsbefugnis, S. 7 ff.).
Die Umgebung könnte hier faktisch einem Gebiet nach § 3 oder § 4
BauNVO entsprechen (s. o.), so dass sich auch die Zulässigkeit hinsichtlich
der Art danach bemisst. Die Umgebungsbebauung weist laut Sachverhalt
überwiegend Wohnbebauung auf. Das könnte auf ein Reines Wohngebiet
nach § 3 BauNVO schließen lassen. Allerdings gibt es neben den kleinen,
die Bewohner versorgenden Läden und nicht störenden Handwerksbetriebe
(Schuh-Werkstatt) auch noch mehrere Restaurants, also Schank- und
Speisewirtschaften nach der BauNVO: Diese sind im Reinen Wohngebiet
auch nicht als Ausnahmen zugelassen (vgl. § 3 Abs. 2 BauNVO), so dass
von einem faktischen Allgemeinen Wohngebiet i. S. des § 4 BauNVO
auszugehen ist. Die Errichtung des Anbaus ist also der Art nach zulässig,
wenn er nach § 4 BauNVO zulässig ist.
Zulässigkeit nach § 34 Abs. 1 Abs. 1 Hs. 1 BauGB, § 4 Abs. 2, § 13 BauNVO
Welche Vorhaben in einem Allgemeinen Wohngebiet zulässig sind, richtet
sich nach § 4 Abs. 1 und 2 BauNVO, wonach dort nur Wohngebäude, der
Versorgung des Gebietes dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften,
18Professor Dr. Christoph Enders Wintersemester 2013/2014
LEO Baurecht – Fälle und Lösungen
nicht störende Handwerksbetriebe und Anlagen für kirchliche, kulturelle,
soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke errichtet werden dürfen.
Für den Anbau des B enthält § 13 BauNVO eine spezielle Bestimmung, die
die Zulässigkeit von Gebäuden und Räumen für freie Berufe regelt.
Nach § 13 BauNVO sind für die Berufsausübung freiberuflich Tätiger und
solcher Gewerbetreibender, die ihren Beruf in ähnlicher Art ausüben, in den
Baugebieten nach den §§ 2 bis 4 BauNVO nur Räume zulässig, in den
anderen Baugebieten dagegen auch Gebäude. Die Architektentätigkeit des B
als freiberufliche Tätigkeit (vgl. § 1 Abs. 2 Satz 2 Var. 18 PartGG) wird von
§ 13 BauNVO erfasst. Sinn und Zweck der Regelung in § 13 BauNVO ist
es, den Gebietscharakter, der bei einem Allgemeinen Wohngebiet nach § 4
Abs. 1 BauNVO überwiegend durch Wohnnutzung geprägt ist, zu erhalten
(hierzu BVerwG NVwZ 2001, 1284). Denn lediglich Wohngebäude sind,
mit Ausnahmen, in einem Allgemeinen Wohngebiet zulässig. Die
Beschränkung auf Räume macht gerade deutlich, dass trotz der
Inanspruchnahme eines Gebäudes für freiberufliche oder gewerbliche
Zwecke der Charakter als Wohngebäude gewahrt werden soll, d. h. die
typische Prägung der Gebäude in den Wohngebieten durch die
Wohnnutzung erhalten werden soll. Davon kann aber jedenfalls dann keine
Rede mehr sein, wenn die Wohnfläche ganz überwiegend wohnfremd
genutzt wird (vgl. BVerwG, NVwZ 1996, 787, 788: näher BVerwG NVwZ
2001, 1284 zur 50%-Grenze). Ein ganzes Gebäude, das nur für
(frei-)berufliche Zwecke genutzt wird, entspricht nicht mehr diesem
Gebietscharakter.
Es ist deshalb auch an dieser Stelle zu klären, ob es sich bei dem Anbau des
B, der für sich betrachtet überwiegend zu wohnfremden Zwecken genutzt
wird, um ein „Gebäude“ – hier i. S. des § 13 BauNVO – handelt oder
lediglich um (zusätzliche) Räume im (erweiterten) Wohnhaus des B.
§ 13 BauNVO definiert nicht, ebenso wenig wie die Baugebietsvorschriften,
auf die er Bezug nimmt, was unter einem Gebäude zu verstehen ist. Dem in
den Vorschriften der §§ 2–9 BauNVO jeweils enthaltenen Zulässigkeits-
katalog lässt sich immerhin entnehmen, dass der Gebäudebegriff als ein
Anwendungsfall des allgemeinen Begriffs der (baulichen) Anlage mit
19Professor Dr. Christoph Enders Wintersemester 2013/2014
LEO Baurecht – Fälle und Lösungen
umfasst wird, auf den insbesondere auch § 29 BauGB abstellt. Mit Blick auf
das anerkannte Phänomen von Doppelhäusern und angesichts der
Tatsachen, dass der Anbau zum ursprünglichen Gebäudes bautechnisch
abgeschlossen ist, einen eigenen Eingang erhält und zudem auf dem
Nachbargrundstück gelegen ist, ist hier davon auszugehen, dass der Anbau
sich nicht als eine „Anzahl von Räumen (im erweiterten ursprünglichen
Gebäude)“ i. S. des § 13 BauNVO, sondern als „eigenständiges Gebäude“
i. S. des § 13 BauNVO zu begreifen ist.
Dafür spricht die in § 22 Abs. 3 BauNVO getroffene Regelung (hier wird
ausdrücklich formuliert: „geschlossene Bauweise“ und „die Gebäude“). Vor
allem aber kennzeichnet seine „funktionale Selbständigkeit“ den Anbau
als eigenes „Gebäude“: Dem unbefangenen Betrachter erscheint der Anbau
als ein „Büro-Gebäude“, das ausschließlich Büros von Freiberuflern
beherbergt und das mit dem daneben liegenden Wohnhaus nur „baulich
ganz besonders eng, i. S. eines Doppelhauses“ verbunden ist (vgl. zum
Ganzen auch BVerwG, NVwZ 1996, 787 f.; VGH München, NVwZ-RR
2001, 228)). Damit sind die Grenzen des § 13 BauNVO überschritten. Es
handelt sich bei dem Anbau nicht mehr um „Räume“ i. S. der §§ 4 Abs. 1
und 2, 13 BauNVO. Das Vorhaben ist damit nicht nach § 34 Abs. 1 Abs. 1
Hs. 1 BauGB, § 4 Abs. 2, § 13 BauNVO zulässig.
Zulässigkeit nach § 34 Abs. 1, Abs. 2; § 31 Abs. 1 und 2 BauGB
Die Widerspruchs-Behörde könnte indessen das Vorhaben des B durch eine
Ausnahme oder Befreiung (§ 31 BauGB mit § 34 Abs. 2 Hs. 2 BauGB)
genehmigungsfähig machen. Sie wäre auch dazu verpflichtet, soweit – auch
bei Rücksicht auf die Nachbarrechtsposition des N – das
Abweichungsermessen zugunsten des Bauherrn B auf Null reduziert ist
(s. o.; hier ist auch ein ausdrücklicher Antrag formuliert worden, auch wenn
die Behörde die Voraussetzungen des § 31 BauGB nach § 63 Nr. 1
SächsBO von Amts wegen zu prüfen hat). Der Ausnahmetatbestand des § 4
Abs. 3 BauNVO scheidet indessen schon deshalb aus, weil § 13 BauNVO
eine spezielle und abschließende Regelung der Zulässigkeit der Nutzungsart
enthält.
20Professor Dr. Christoph Enders Wintersemester 2013/2014
LEO Baurecht – Fälle und Lösungen
[Im Übrigen käme nur eine Ausnahme nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO in
Betracht. Hierfür müsste es sich bei dem Architekturbüro um einen nicht
störenden Gewerbebetrieb handeln. Gewerbe ist jede selbständige,
erlaubte, auf Gewinnerzielung gerichtete und auf eine gewisse Dauer
ausgeübte Tätigkeit, mit Ausnahme der Urproduktion; künstlerischer und
wissenschaftlicher Tätigkeiten und Dienste und persönlicher
Dienstleistungen „höherer Art“, die eine höhere Bildung (Hochschul-,
Fachhochschulausbildung) erfordern (freie Berufe) sowie der bloßen
Verwaltung eigenen Vermögens (vgl. dazu nur Landmann/ Rohmer, GewO,
Einl., Rdnr. 32; Einl, Rdnr. 66 a. E.). Die Tätigkeit von Architekten stellt
als freier Beruf (s. o.) keinen Gewerbebetrieb dar. Der Ausnahmetatbestand
des § 4 Abs. 3 BauNVO ist nicht erfüllt. Das Vorhaben fügt sich daher nicht
unter Berufung auf diese Vorschrift ein.]
Schließlich könnte eine Befreiung i. S. des § 31 Abs. 2 BauGB zu erteilen
sein: Durch § 34 Abs. 2 Hs. 2 BauGB wird der nicht beplante dem
beplanten Innenbereich gleichgestellt. Es muss daher geprüft werden, ob die
Baugenehmigung unter einer Befreiung von der „Regelbebauung“ des
faktischen Baugebietes zu erteilen und daher der Widerspruch des N
zurückzuweisen wäre.
In Betracht kommt hier allein § 31 Abs. 2 Nr. 2 BauGB, soweit die
Abweichung „städtebaulich vertretbar“ ist. In keinem Fall dürfen aber die
„Grundzüge der Planung“ berührt werden: Die Zulassung von
Bürogebäuden im Allgemeinen Wohngebiet verstößt gegen die
Gebietstypik (vgl. § 13 BauNVO) und damit gegen die Grundzüge der
Planung. Außerdem wäre die Befreiung jedenfalls nicht i. S. des § 31
Abs. 2, Hs. BauGB „ … auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen
mit den öffentlichen Belangen vereinbar … “. Der Tatbestand des § 31
Abs. 2 BauGB ist nicht erfüllt. Die Widerspruchsbehörde hat zutreffend
erkannt, dass der erwartete An- und Abfahrt-Verkehr in einem Allgemeinen
Wohngebiet nicht hingenommen werden kann, deshalb eine Befreiung
zulässigerweise abgelehnt.
Anmerkung: Darauf, dass die Ausgangsbehörde hier eine „faktische
Befreiung“ erteilt hat, kommt es nicht an. Insoweit ist die
Genehmigungserteilung allerdings außerdem ermessensfehlerhaft, worauf
21Professor Dr. Christoph Enders Wintersemester 2013/2014
LEO Baurecht – Fälle und Lösungen
sich der Nachbar aufgrund seines Gebietserhaltungsanspruchs berufen
kann.
Zwischenergebnis:
Das Vorhaben des B war danach nach § 34 BauGB unzulässig.
γ Zwischenergebnis
Das Vorhaben des B war damit nicht genehmigungsfähig.
(c) Zwischenergebnis
Die Baugenehmigung darf dem B nicht erteilt werden.
(3) Zwischenergebnis
Die Erteilung einer Baugenehmigung an B wäre insgesamt rechtswidrig.
bb) Rechtsverletzung
Die rechtswidrige Erteilung der Baugenehmigung (unter Befreiung von den
Regelanforderungen) würde den Nachbarn in seinem Gebietserhaltungsanspruch
aus §§ 34 Abs. 2 BauGB, §§ 4, 13 BauNVO (hilfsweise in seinem Anspruch auf
Rücksichtnahme, § 31 Abs. 2 Hs. 2 BauGB) verletzen.
c) Zwischenergebnis
Der Widerspruch des N war damit begründet.
4. Zwischenergebnis
Die Aufhebung der Baugenehmigung durch Widerspruchsbescheid war damit formell
und materiell rechtmäßig.
II. Rechtsverletzung des B
Weil die Aufhebung der Baugenehmigung rechtmäßig war, kann B hierdurch auch nicht in
seinem Recht aus § 72 Abs. 1 SächsBO verletzt sein.
III. Zwischenergebnis
Die Klage des B ist damit unbegründet
D. Ergebnis
22Professor Dr. Christoph Enders Wintersemester 2013/2014
LEO Baurecht – Fälle und Lösungen
Die Klage des B hat keine Aussicht auf Erfolg.
Fallabwandlung: Zulässigkeit der Klage des B
I. Verwaltungsrechtsweg
Erforderlich ist zunächst, dass der Verwaltungsrechtsweg eröffnet ist. Mangels auf- oder
abdrängender Sonderzuweisungen richtet sich dies nach § 40 Abs. 1 Satz 1 VwGO.
Hiernach ist der Verwaltungsrechtsweg in allen öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten
nichtverfassungsrechtlicher Art eröffnet. Die streitentscheidenden Normen entstammen in
diesem Fall dem Baurecht und sind damit öffentlich-rechtlicher Natur. Eine öffentlich-
rechtliche Streitigkeit nichtverfassungsrechtlicher Art liegt vor, der Verwaltungsrechtsweg
nach § 40 Abs. 1 Satz 1 VwGO ist eröffnet.
II. Statthafte Klageart
Entscheidend für die Bestimmung der statthaften Klageart ist das Begehren des Klägers. B
begehrt den Erlass eines Widerspruchsbescheids, den die Behörde bisher unterlassen hat.
Dieser ist ein VA gem. § 1 SächsVwVfZG i.V.m. § 35 VwVfG (vgl. auch 79 Abs. 1 Nr. 1
VwGO) (vgl. VGH Mannheim, ESVGH 43, 142). Statthafte Klageart ist somit die
Verpflichtungsklage gem. § 42 Abs. 1, 2. Alt. VwGO.
III. Klagebefugnis
Nach § 42 Abs. 2 VwGO muss B geltend machen können, durch die Unterlassung des VA
in eigenen Rechten verletzt zu sein. Fraglich ist, welches Recht des B durch den
Nichterlass des Widerspruchsbescheids verletzt sein könnte.
1. § 73 Abs. 1 Satz 1 VwGO
Grundsätzlich gibt es kein einklagbares subjektives Recht auf Erlass eines
Widerspruchsbescheids. Ein solches lässt sich nicht aus § 73 Abs. 1 Satz 1 VwGO,
wonach im Fall der Nichtabhilfe ein Widerspruchsbescheid „ergeht“, herleiten.
§ 68 Abs. 1 Satz 1 VwGO regelt aus kompetenzrechtlichen Gründen (Art. 74 Abs. 1 Nr.
1 GG) das Widerspruchsverfahren nur als Vorverfahren eines Verwaltungsprozesses
und normiert damit nur eine prozessuale Verpflichtung der Behörde. Diesen
prozessualen Charakter teilt die Bescheidungspflicht nach § 73 Abs. 1 Satz 1 VwGO,
womit auf deren Erfüllung kein subjektiv einklagbares Recht i. S. des § 42 Abs. 2
VwGO besteht.
23Professor Dr. Christoph Enders Wintersemester 2013/2014
LEO Baurecht – Fälle und Lösungen
Dies zeigt auch die Regelung des § 75 VwGO, die für den Fall der Untätigkeit der
Widerspruchsbehörde nur bestimmt, dass nach Ablauf der dort genannten Frist der
materielle Anspruch als das Sachbegehren unmittelbar, d.h. ohne Durchführung eines
Vorverfahrens mit der entsprechenden Klage verfolgt werden kann.
Schließlich führt auch die Verletzung einer wesentlichen Verfahrensvorschrift im
Vorverfahren, wenn der Widerspruchsbescheid hierauf beruht, gem. § 79 Abs. 2 Satz 2
VwGO nur zur Aufhebung des Widerspruchsbescheids; ein Verpflichtungsausspruch
gegenüber der Widerspruchsbehörde, einen neuen Widerspruch zu erlassen, erfolgt
nicht. Die dahingehende, nur prozessuale Verpflichtung der Widerspruchsbehörde
besteht aufgrund der weiterhin gegebenen Abhängigkeit des Widerspruchs besteht
aufgrund der weiterhin gegebenen Abhängigkeit des Widerspruchs.
§ 73 Abs. 1 Satz 1 VwGO enthält folglich kein subjektives Recht auf Erlass eines
Widerspruchsbescheids.
(a. A.: Kopp/Schenke, VwGO, 12. Aufl. 2000, vor § 68, Rdnr. 13; : Der Bürger hat im
Hinblick auf den Rechtsschutzzweck des Vorverfahrens und weil im Rechtsstaat den
Verpflichtungen der Verwaltung [„ergeht“] grundsätzlich subjektive Rechte der Bürger
entsprechen, einen mit der Verpflichtungsklage verfolgbaren Anspruch auf Erlass des
Widerspruchsbescheids.)
2. Materieller Anspruch
Zu beachten ist hier jedoch, dass der mit der Klage geltend gemachte Anspruch auf
Erlass eines den Nachbarwiderspruch zurückweisenden Widerspruchsbescheids bei
genauer Sicht nicht der soeben beschriebene und verneinte allgemeine Anspruch auf
Erlass eines Widerspruchsbescheids ist, sondern das rechtstechnische Gewand für den
dahinterstehenden materiellen Anspruch.
Bei Vorliegen der dort genannten Voraussetzungen hat B einen Anspruch auf Erlass der
beantragten Baugenehmigung nach § 72 Abs. 1 SächsBO. Dieser Anspruch ist auf eine
bestandskräftige Baugenehmigung gerichtet, denn nur eine bestandskräftige
Baugenehmigung ist eine vollwertige i.S.v. Art 14 Abs. 1 GG, § 72 Abs. 1 SächsBO.
Das Eintreten der Bestandskraft wurde aber bisher durch die Einlegung des
Nachbarwiderspruchs verhindert. Dieses Manko kann der Bauherr nur mit Erhebung der
hier in Frage stehenden Klage beheben (vgl. VGH Mannheim, ESVGH 43, 142, 144).
24Sie können auch lesen