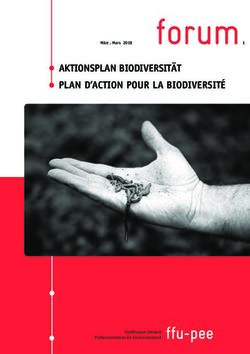"Gegossenes" oder "gepresstes" Glas - Glasrelief mit dem Portrait Louis XIV. von Bernardo Perrotto: Bernardo Perrotto, der jüdische Glasmacher aus ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Pressglas-Korrespondenz 2002-1 Siegmar Geiselberger ergänzt Januar 2021 / Januar 2002 „Gegossenes“ oder „gepresstes“ Glas - Glasrelief mit dem Portrait Louis XIV. von Bernardo Perrotto: Bernardo Perrotto, der jüdische Glasmacher aus Altare, das Geschlecht der Gonzaga und die Glasfiguren aus Orléans und Nevers Zusammenfassung der in Literatur und Internet gefundenen Informationen (Stand 2002-1!) Abb. 2002-1/056 Ausschnitt aus Brockhaus 1894, Karte Norditalien, von unten links im Uhrzeigersinn: Altare, auf der Nordseite der Ligurischen Alpen westlich von Genua, Casale-Montferrato, Mantua, Guastalla, Pisa / Lucca, Genua Altare liegt westlich von Genua auf der Nordseite der Pisa (1017-1290) und Venedig (1261-1381) konkurrie- Ligurischen Alpen und gehörte im Mittelalter zur renden See- und Handelsmacht im Mittelmeer, über- Herrschaft der Markgrafen von Montferrat (heute in nahmen „bicchieri, orinali, pinte, vetri rotondi per Ligurien). Es lag damals in einem waldreichen Gebiet finestre“. [2] Auf der Rückfahrt über das Mittelmeer im Gebirge, isoliert von anderen Dörfern (altare = hoher wurde Soda aus Pflanzenasche aus Ägypten, Syrien, Platz). Nach dem Ende der Einfälle von Ungarn und Katalonien und der Provence gebracht. Die Glasmacher Sarazenen und der Vertreibung der Sarazenen von von Altare schmolzen von Anfang an das Rohglas Sardinien und Korsika begann im 12. Jhdt. im Golf von selbst, im Unterschied zu Venedig, das Rohglas aus Genua eine Zeit ruhiger Stabilität. 1130 bauten Bene- Syrien und Dalmatien bezog bis Jacobo de la Calcara diktiner Mönche auf der Insel Bergeggi eine Kirche. [1] erst 1280 den ersten Glasofen für Fritte in Betrieb nahm. Nach einer Überlieferung begann damit das Glas- [16] Durch den Einfall der Mongolen in Syrien / Meso- machen in Altare. Akten erwähnen 1173 einen Nicola potamien 1259/1260 verfiel die Glasherstellung in Vitrearius und 1178 einen Pietro Vitrearius. [alpidi- Aleppo und Damaskus / Syrien. Charakteristisch für mare 2001] Nach einer anderen Überlieferung begann das Glashandwerk in Altare war seine Ausdehnung im das Glasmachen in Altare erst im 13. Jhdt.. „Es ist 13. Jhdt. Gefertigt wurde farbloses und grünes Glas wahrscheinlich, dass die Glasmacher von Altare ihre [vetro bianco e verde; alpidimare 2001]. Als Gläser Geheimnisse direkt aus dem Vorderen Orient hatten.“ wurden geliefert „anfore pisane, bicchieri, amole, [Bénard 1989, S. 19] Die Händler von Genua, der mit boccali, ampolle da chiesa, bicchieri e calici delle più Stand 25.02.2021 pk-2002-1-2 Seite 37 von 146 Seiten
Pressglas-Korrespondenz 2002-1
svariate qualità, alle phiale per nave, alle tazze, tazzette, „Die Glasmacher aus Altare wanderten zeitweilig
piatti, fiaschi, saliere, ampolle, lampade da nave, da freiwillig aus und bildeten Mannschaften, die sich in
Giudei, alla veneziana, agli scacchi per filatori di seta, Frankreich niederließen, um Glasöfen zu betreiben.
alle rotelle per regolare lo stoppino delle lampade, [Sie nahmen aber auch Glasmacher auf, die aus anderen
articoli di farmochimica“. [4, 5, 6, 7] (Gläser kann man Ländern auswandern mussten.] Altare praktizierte eine
im Museo nella Chiesa S. Sebastiano finden) Im 16. technische Zusammenarbeit, während Venedig nur
Jhdt. breitete sich der Handel mit Glas aus Altare in nach Vorherrschaft im Handel trachtete.“ [Bénard
ganz Italien aus. [8] 1989, S. 19; gremaud 2001] 1569 gingen Glasmacher
von Altare erstmals nach Liège (Nicola Francisci), 1579
Abb. 2002-1/057; Innenstadt von Altare erstmals nach Nevers. [Bénard 1989, S. 19 f.]
Abb. 2002-1/058; Università d‘Altare
Abb. 2002-1/059; Glasfabrik SAV in Altare
Die „Università d’Altare“
Glasmacher wie Lanzarotto Beda arbeiteten im Jahr
1440 unter dem Schutz der Mönche. [3] Die Glasma-
cher bildeten eine Genossenschaft [corporazione] und
sicherten sich ihre Freiheit gegenüber den Herrschaften
der Marchesi del Carretto und der Signori del Monferra-
to. Ihre Gemeinschaft wurde als „Università“ bezeich-
net. Erst 1856 bildeten die Glasmacher eine förmliche
„Cooperative“. Im Unterschied zu Venedig war den
Glasmachern aus Altare das Auswandern erlaubt.
1495-1512 legte die Herrschaft von Montferrat, Gug-
lielmo VII. Paleologos, in den „Statute dell’Arte Am 24. Dezember 1856 gründeten 12 Glasmacher-
Vitrea“ das Recht der Glasmacher auf Selbstregierung Familien aus Altare die „Società Artistico-Vetraria
fest. Jährlich wurden 6 Consuln gewählt. Glasmacher, Altare“ (SAV). Gleichzeitig wurde das Glaswerk der
die das Statut verletzten, z.B. Geheimnisse des Glasma- Familien Berruti, Lodi, Massari, Sarolsi und Bormio-
chens verrieten, wurden schwer bestraft vom Einziehen li geschlossen. Die SAV produzierte Gläser, Schalen,
des Besitzes bis zur Tötung. Glasmachen war auf die Flaschen, Krüge, Töpfe, Gläser für chemische Labors
Zeit zwischen St. Martin (11. Nov.) und St. Johannes u.a. Anfang 1880 war die SAV im früheren Glaswerk
(24. Juni) festgesetzt. Im Sommer wurden die Glasöfen Lodi untergebracht. 1880 wurde ein neues Gebäude
repariert und Vorräte beschafft. [altevitrie eröffnet. 1887 wurde der erste Boetius-Glasofen errich-
2001/glass_univ.htm, alpidimare 2001, Kurinsky 2002; tet. Er hatte Häfen für 6 verschiedene Farben. In den
das Statut von 1512 ist erhalten. Das Statut blieb in 1930-er Jahren wurden die ersten halb-automatischen
Kraft bis 1823, als die „Università“ nach einem Streit Maschinen eingerichtet, die bis 1978 arbeiteten, als die
zwischen Glasmachern und Bauern von König Carlo SAV geschlossen wurde. [Saroldi 2001-2]
Felice von Savoyen aufgehoben wurde. altevitrie www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/
2001/glass_univ.htm] pk-2011-4w-sg-bormioli-altare.pdf
In Lyon, Melun, Nevers, Orléans, Paris, Poitiers, Zum Glasmachen in Altare gab es bereits Ende des 19.
Liège, Antwerpen, Maastricht, Amsterdam und Köln Jhdts. Ausstellungen in Turin (1858), Mailand (1881),
wurden Handels- und Herstellungs-Niederlassungen Palermo (1891) und Turin (1911). [alpidimare 2001]
gegründet und Glas in venezianischer Art verbreitet Heute beschäftigt sich das Instituto per lo studio del
[„cristallino“ di Venezia / „à la façon de Venise“]. Vetro e dell’Arte Vetraria (ISVAV) mit Glas aus
[10, 11; Saroldi 2001-1] Altare. [alpidimare 2001; www.altevitrie.net 2001]
Seite 38 von 146 Seiten pk-2002-1-2 Stand 25.02.2021Pressglas-Korrespondenz 2002-1
Luigi Zecchin, P. M. Bondois, J. Bénard und Die Markgrafen von Montferrat wurden 967 von
J. Barrelet haben ausführliche Biographien über Kaiser Otto I. (reg. 962-973) eingesetzt, später standen
Bernardo Perrotto verfasst. Zecchin, Barrelet und sie auf Seiten der Hohenstaufen. Mehrere von ihnen
Bénard zeigen das Bild eines großen Glasreliefs von zeichneten sich auf Kreuzzügen aus, so Konrad v. M.,
Perrotto mit dem „gegossenen“ Portrait Louis XIV.. der 1192 von Assassinen ermordet wurde, und Bonifati-
Nach Prof. Dr. Theuerkauff, SMPK Berlin, gibt es us, einer der Führer des 4. Kreuzzuges. Wilhelm III.
ähnliche Glasreliefs „von Ludwig XIV. und Charles I. bekam ein Lehen in Galiläa und seine Sippe herrschte
von England in Museen in Paris, Orleans, London und dort noch lange Zeit. Ein Montferrat wurde „König von
Corning“. Thessaloniki“ und ein anderer „Prinz von Jerusalem“.
Von diesem Markgrafen von Montferrat sollen nach
Abb. 2002-1/060; Villa Rosa in Altare einem Kreuzzug jüdische Glasmacher aus Palästina
mitgebracht worden sein. [Bénard 1989, S. 19; zit. n.
Wood 1984] Sie bildeten 800 Jahre lang eine abge-
schlossene Gemeinde in Altare, später „Università
d’Altare“ genannt.
Abb. 2002-1/061; Synagoge von Altare
Wie kamen die Glasmacher nach Altare?
Von dem normannischen Kreuzfahrer Roger II.,
König von Sizilien und Neapel (1097-1154, reg. 1101 /
1130-1154), Neffe von Robert Guiscard und Sohn von
Roger I. und Adelaide von Savoyen, waren beim
2. Kreuzzug 1147 nach seinen Überfällen auf Dalma-
tien, Epirus, Korfu und Korinth sowie Tunis, Tripo-
lis und Kairouan, Glasmacher und Seidenmacher Die jüdischen Gemeinden von Altare
aus Griechenland und Nordafrika nach Sizilien und Casale-Montferrat
geholt worden. Mit den verschleppten Handwerkern
baute Roger II. in Unteritalien eine blühende Industrie 1536 kam Montferrat an Mantua. Unter der Herr-
auf, die später unter Kaiser Friedrich II. (1194-1250, schaft der Markgrafen und Herzöge von Montferrat und
Sizilien 1198-1250) unter staatliche Kontrolle und später der Gonzaga von Mantua gab es in Casale-
unter die Leitung von jüdischen Fabrikanten, Händ- Montferrato (und in Allessandria) eine große, freie,
lern und Bankiers gestellt wurde. Zur Zeit Rogers II. jüdische Gemeinde, die das Zentrum jüdischen Lebens
wetteiferten Palermo und Amalfi mit den Handels- in der Region und einzigartig in Europa war. Nirgends
mächten Genua, Pisa und Venedig. Ackerbau, Seiden- wurden Juden weniger verfolgt und viele hatten Privile-
manufakturen sowie öffentliche Verwaltung und gien, festgehalten in „patente di familiare“. Die Her-
Wissenschaft wurden als die „berühmtesten in ganz zöge der Gonzaga führten Kriege mit Mailand und
Europa“ angesehen. Nach den Niederlagen der Nor- übernahmen von dort jüdische Flüchtlinge. Auch
mannen (1194), der Hohenstaufen (1268) und schließ- sephardische Juden, die im 15. Jhdt. aus Spanien und
lich der Anjou (1282) gegen die Spanier (Peter III. von 1567 unter spanischer Herrschaft der Doria aus Genua
Aragon) zogen viele jüdische Handwerker und vertrieben wurden, ließen sich in Montferrat bzw. als
Händler in die Toscana und von dort nach Bologna, Glasmacher in Altare nieder. Erst 1659 erlaubte Genua
Genua, San Daniele, Venedig und später nach Mont- nach dem Ende der spanischen Herrschaft wieder
ferrat und Savoyen, aber auch zurück nach Theben, jüdischen Glasmachern aus Pisa das Arbeiten in der
Thessaloniki und Konstantinopel in Griechenland. Stadt. [Brockhaus 1894, Bd. 11, S. 1019; hebrewhisto-
[Kurinsky 2002; Brockhaus 1894, Bd. 13, S. 918; ry 2001; Kurinsky 1991; Kurinsky 2002]
Krimm 1982, S. 129] In den Quellen werden die Juden Unter dem Druck der katholischen Kirche wurden die
allerdings meistens als Araber, Syrer oder Palästi- jüdischen Glasmacher endgültig 1597 zur Aufgabe
nenser bezeichnet. ihres Glaubens gezwungen. Viele Glasmacher wander-
Stand 25.02.2021 pk-2002-1-2 Seite 39 von 146 SeitenPressglas-Korrespondenz 2002-1
ten in die Provence, in die Niederlande oder nach Royale des Sciences 1687 für seine Erfindung ausge-
England aus. Einige von ihnen gaben sich als Hugenot- zeichnet, Glas für Spiegel zu gießen [vetro colato su
ten aus, weil beispielsweise die Einwanderung von tavola; alpidimare 2001¸ altevitrie 2001]. Aus dieser
Juden in England verboten war. [Kurinsky 1991 u. Erfindung entstand durch Förderung von König Louis
2002] XIV. (1638, reg. 1643-1715) und Minister Jean Baptiste
Colbert (1619, reg. 1643-1683) 1665 die erste Spiegel-
In Casale-Montferrato gab es eine großartige Synago-
glasmanufaktur in Frankreich [Flachglas 1987, S. 76],
ge, die erst während der Besatzung durch deutsche NS-
später (1692) die Spiegelglashütte St. Gobain, die noch
Truppen 1945 zerstört wurde. Inzwischen ist sie wieder
heute einen der größten europäischen Glas-Konzerne
aufgebaut und als jüdisches Museum eingerichtet. In
beherrscht.
den zerstörten Nebengebäuden wurde nach 1945 die
„geniza“ [Lager für heilige Bücher] mit den vollständi- Abb. 2002-1/063; Parfumflakon mit Silbermontierung,
gen Dokumenten der jüdischen Gemeinde von 1589 bis Wappen der Stadt Orléans, H 9 cm
1933 und viele andere Dokumente der Stadt entdeckt. Bernard Perrot, Orléans, 17. Jhdt.
[Kurinsky 2002] aus Bénard 1989, S. 42 u. 110, Abb. 8
Musée Ariana, Genf
Viele Juden waren Seidenmacher, deren Vorfahren
über Florenz und Bologna nach Norditalien gekommen
waren. Zwei der jüdischen Glasmacher-Familien wur-
den von den Gonzaga durch „patente di familiare“
privilegiert, die Dagnia und die Perrotto. [Kurinsky
1991]
Ein Oduardo Dagnia und seine vier Söhne verließen
Italien und begannen in England Glas in Weald,
Stourbridge, und in Newcastle zu machen. Bernardo
Perrotto folgte seinem Onkel nach Frankreich, wo er
das Gießen von Glas für Spiegel und Fensterscheiben
entwickelte. 1669 bekam Perrotto dafür ein königliches
Patent. Später entwickelte Perrotto Glasgemenge für
opak-weißes Glas („porcelaine en verre „) und rubinro-
tes Glas („rouge des Anciens „). Ein Zweig der Familie
Perrotto ging nach England und spielte eine wichtige
Rolle in der Glasindustrie von Bristol und Stourbrid- Bis dahin hatte es zur Herstellung von Scheiben für
ge. Ein Da Costa ging nach England zu Ravenscroft. Fenster und Spiegel nur drei unzureichende Verfah-
[Kurinsky 1991 u. 2002] ren gegeben: Butzenscheiben, das Aufschneiden von
langen Zylindern, das die venezianischen Glasma-
Abb. 2002-1/062; Flakon mit Sonne [flacon gourde]
bernstein-farbenes Glas, H 13,2 cm
cher entwickelten und das Auftreiben von Kron-
Bernard Perrot, Orléans, 17. Jhdt. oder Mondglas, „verre à plat, par la rotation sur un
aus Bénard 1989, S. 51 u. 110, Abb. 16 pontil d’une masse de verre assez importante, préa-
Musée Ariana, Genf lablement soufflée en forme de vase à large fond plat, le
centre plus épais du plateau sur lequel se voit encore la
trace du pontil.“
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/
pk-2011-1w-sg-jgs-2010-52-loibl-glastechnik-
barock.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/
pk-2009-1w-mauerhoff-hirsch-radeberg.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/
pk-2010-3w-sg-glasmeister-bayern-lothringen.pdf
1330 ließ Philippe de Cacquerey (auch Caqueray,
Caquerel, Caqueret, Caquerez, Cazeray), Herr von St.
Immes (St. Ymes), mit einem Privileg von König
Philippe VI. de Valois (1293, reg. 1328-1350, der erste
Glasmacher aus Altare in Frankreich Valois, unter ihm begann der Hundert-jährige Krieg) in
der Glashütte La Haye (auch La Haye pres Bézu la
In der Königlichen Manufaktur Orléans arbeiteten mit Forêt oder Fontaine-du-Houx) in der Haute Normandie
Privileg des französischen Königs Louis XIV. die im Mondglas-Verfahren Scheiben mit 40-60 cm
beiden Glasmacher Jean Castellan und sein Neffe Durchmesser fertigen («Plats de Verre appelé Verre de
Bernardo Perrotto, 1619 in Altare geboren [Bénard France»). In der Glashütte wurde bis 1805 gearbeitet.
1989, S. erratum u. S. 13]. In Frankreich nannte sich die Die Familie Cacquerey kam wie der König aus dem
Familie Perrot. Perrot wurde von der l’Académie Valois, aus der Gegend von Soissons und Pierrefonds,
Seite 40 von 146 Seiten pk-2002-1-2 Stand 25.02.2021Pressglas-Korrespondenz 2002-1
heute Picardie, wo andere Mitglieder der Familie in den Seit Aristoteles sahen die Alchimisten und Kabbalisten
Wäldern von Retz und Compiègne ebenfalls Glashütten im Stein der Weisen, dem Lapis philosophicum, eine
betrieben. Vorfahren sollen bei der Schlacht von Has- Materie oder ein Auflösungsmittel, nämlich die rote
tings 1066 mitgekämpft und 1191 Richard Coeur de Tinktur des Goldes, die den Urstoff aller Dinge enthalte,
Lion gedient haben. Spätere Caquerels gingen als alles in seine Bestandteile auflösen, alle Krankheiten
Glasmacher nach Rethel, ins Nivernais und in die entfernen, die Menschen verjüngen und unsterblich
Bourgogne. [gremaud 2001; www.uhb.fr/alc/medieval- machen und die unedlen Metalle in Gold und Silber
/mirouen.htm; www.herve.gros.nom.fr/verriers1.htm; verwandeln könne. Diese Vorstellung reicht weit ins
http://sourdeac.multimania.com/H_genealogie/les_cacq Barock hinein und beeinflusste auch die chemischen
ueray.html; Kokanosky 2000] Experimente und empirischen Forschungen von Johann
Kunckel und Johann Friedrich Böttger.
Die zerschnittenen und mit Bleiruten gefassten Mond-
glas-Scheiben waren zum größten Teil in Kirchen und Abb. 2002-1/065; Parfumflakon als Mönch
Prunksälen (z.B. Wladislaw-Saal, Prager Hradschin, bernstein-farbenes Glas, H 11 cm
1490-1502) eingesetzt worden. Für die großen Fenster- Bernard Perrot, Orléans, 17. Jhdt.
und Spiegelflächen der „Galerie des glaces“ (Spiegel- Bénard 1989, S. 51 u. 110, Abb. 15; Musée Ariana, Genf
galerie) im Schloss Versailles (1671-1715) von Louis
XIV. wurden mehr und größere, verspiegelte Glasschei-
ben erforderlich. [Flachglas 1987, S. 18, 24, 25 u. 39]
Versailles wurde 1678-1708 von Jules Hardouin-
Mansart vergrößert, darunter um die Spiegelgalerie.
Gläser nach dem Verfahren von Bernardo Perrotto zum
Gießen von Glas wurden allerdings erst im „Cabinet du
Conseil“ verwendet [Bénard 1989, S. 31], in der Litera-
tur oft ungenau wiedergegeben.
Abb. 2002-1/064; Parfumflakon als Muschel und Sonne
bernstein-farbenes Glas, H 7 cm
Bernard Perrot, Orléans, 17. Jhdt.
aus Bénard 1989, S. 49 u. 110, Abb. 8, private Sammlung
Dass der eine die Voraussetzungen schuf, Hohlgläser
aus Goldrubin herzustellen, und der andere das europä-
ische Porzellan erfand, hängt unmittelbar damit zu-
sammen, dass beide sich ursprünglich als Goldmacher
betätigt hatten. Zur Überzeugung der Alchimisten
gehörte außerdem, dass der Lapis philosophicum - nach
dem zum Beispiel Kunckel am Dresdener Hof gesucht
hatte - rot sei, dass ein Zusammenhang zwischen dem
Gold und der roten Farbe des Karfunkelsteins oder
Rubins bestehe und der Rubin folglich ähnliche wun-
dersame Eigenschaften besitze wie der Stein des Wei-
Der berühmte Bernardo Perrotto sen. [...] Wenn damals über Rubinfluss geschrieben
Perrotto fertigte zuerst in Liège [Lüttich], dann in wurde, dann betraf das ausnahmslos eine rote Glas-
Nevers und später in Orléans in Lampenarbeit aus schmelze zur Herstellung von künstlichen Rubinen.
Glasröhren und -stäben Imitationen von Edelsteinen Dazu brauchte man keine Glashütte, sondern einen
und Figuren aus opak-weißem Glas. Die Berichte von Tonkrug oder -Tiegel, der, nachdem man das Gemenge
Drahotová 1982 und Kerssenbrock 2000 beziehen sich eingelegt und ihn mit einem Deckel und frischem Lehm
auf diese Gläser und auf ihn. luftdicht verschlossen hatte, im offenen Feuer erhitzt
wurde. Das Verschließen war deshalb wichtig, weil
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/ keine Rauchgase an die Schmelze herankommen
pk-2009-3w-kerssenbrock-alchemisten.pdf durften. Nachdem der Inhalt geschmolzen und abge-
kühlt war, bestanden Glas und Tongefäß aus einem
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk- festen Klumpen, den man zerschlug. Man klaubte die
2013-4w-loibl-simony-hugenotten-potsdam.pdf
Glasbrocken heraus und schliff daraus Edelsteine -
„Mit dem Begriff Goldrubin, genauer gesagt mit dem auch künstliche Rubine. Diese Methode eignete sich
Edelstein Rubin, verbindet sich seit alters her die nicht zur Herstellung von Hohlgläsern, und es war ja die
Vorstellung von Heilkraft - hier liegen die Wurzeln der große glastechnische Leistung von Kunckel, dieses
modernen Edelsteintherapie -und Magie. Sie wurde Prinzip so verbessert zu haben, dass ausreichende
später, nachdem man Hohlgefäße aus massivem Gold- Mengen Rubinglasschmelze zur Verfügung standen, um
rubinglas herstellen konnte, auch auf diese übertragen. daraus Prunkgläser zu blasen.“ [Spiegl 2002]
Stand 25.02.2021 pk-2002-1-2 Seite 41 von 146 SeitenPressglas-Korrespondenz 2002-1
„Opalglas erfreute sich in den 1670-er Jahren großer Perrot kann eine Reihe von Erfindungen zugeschrieben
Beliebtheit. Es wurde in Venedig und auch in Frank- werden und ohne Zweifel war er imstande, rotes,
reich hergestellt, wo seine Produktion mit dem Namen transparentes Glas [red translucent] herzustellen. Ein
des bekannten Glasmachers Bernard Perrot verbunden Privileg, das 1668 Perrot von Louis XIV. gewährt
ist. Nach einem überlieferten Bericht führte Mme. wurde, erwähnt, dass „il a acquis la connoissance de [...]
Perrot 1686 den siamesischen Gesandten durch die teindre le verre en couleur rouge transparente interieu-
Glashütte und zeigte ihm vollendete Imitationen orienta- rement et dans sa substance, invention qui auroit été
lischen von Porzellan, Email- und Kristallgläsern, usitée par les anciens, mais qui seroit perdue et n'auroit
Achat-, Opal-, Rubin- sowie Lapislazuliglas und zuletzt été retrouvée jusqu'à present“. [Bondois, Paul, Les
Nachahmungen verschiedenster Edelsteine. Aufgrund verreries nivernaise et orléanaise au XVIIe siècle, in:
dieses Berichts werden die als Tafelschmuck dienenden Revue d’histoire économique et sociale 20, 1932, S. 84]
opakweißen Glasfiguren auf farblosen, mit Rubintupfen Dieses rote Glas der Alten [„verre rouge des anciens“]
im gekniffenen Dekor verzierten Sockeln Bernard steht für das kupferrubin-farbene Glas der Fenster
Perrot zugeschrieben. 1671 bzw. 1686 erhielten seine mittelalterlicher Kathedralen.
Konkurrenten Paul bzw. sein Sohn Nicolas Massolay
(Mazzolao) in Orleans, ein Mitglied der Venezianer Abb. 2002-1/067; Glasfigur einer Mohrin
Familie Mazzola, ebenfalls das Privileg zur Herstel- opak-weißes Glas in Holzrahmen
vielleicht Bernard Perrot, Orléans, 17. Jhdt.
lung von Porzellan-Nachahmungen; er produzierte bis Skulpturensammlung / Museum Byzant. Kunst, SMPK
zum Jahre 1729 opak-weiße Gläser zuerst in Orleans,
dann in Paris und Rouen. Während des ganzen ersten
Drittels des 18. Jhdts. machte man weiße Hochzeitsbe-
cher mit volkstümlich gemaltem Emaildekor insbeson-
dere in der Normandie und in Lothringen. Gleichzeitig
gab es eine Produktion von bemalten, mit Palmetten-
Motiven verzierten Milchgläsern, die auf die Hütte von
Nicolas Massolay zurückgehen dürften. An die franzö-
sischen Vorbilder lehnte sich die Herstellung von Opal-
und Milchglas in den südböhmischen Hütten der
1670-er und 1680-er Jahre an.“ [Drahotová 1982, S. „Die Beschreibung „interieurement et dans sa sub-
153 f.; Bénard 1989, S. 28 f., 55 f. u. 94 f.] [SG: 1666 stance“ bedeutet einfach die Tatsache, dass das Glas
kam mit Förderung Louis XIV. der Glasmachermeister nicht eine bemalte, farbig emaillierte Oberfläche hat,
Jean Baptiste Mazzolay aus Venedig (Murano). Unter sondern dass die Farbe Bestandteil des Glases selbst
der Schirmherrschaft der Zisterzienser von Clairvaux, ist. Ein Artikel im „Mercure Galant“ 1689 bezieht sich
den Eigentümern, gründete er die „Manufacture wieder auf das „Rot der Alten“ [Rouge des Anciens],
Royale en Cristaux de Bayel“ mit einem Adelsbrief fügt aber hinzu, dass Perrot außerdem Glas „en couleur
von Louis XIV. und einem Privileg für Herstellung und de rubis“ machte. [Troisième partie du voyage des
Vertrieb in Chaumont und Paris. PK 2001-5, S. 6] Ambassadeurs de Siam en France (...); Mercure Galant,
Dezember 1686, S. 85] Dies war wie es scheint kein
Abb. 2002-1/066; Becher mit Wappentieren
einfaches Goldrubinglas, sondern Teil einer riesigen
farbloses Glas, H 7,6 cm
Bernard Perrot, Orléans, 17. Jhdt. Breite von Glasfarben, die Edelsteinen ähnlich
aus Bénard 1989, S. 52 u. 110, Abb. 17 waren. Mit diesem Glas sollten die Glasobjekte Perrots
Musée Ariana, Genf aus Porzellanglas [porcelain glass] dekoriert werden,
die „diejenigen aus Asien so gut imitierten“ [„imitate so
good those from Asia“]. Perrot könnte deshalb kleine
Mengen goldrubin-farbenes Glas gemacht haben,
aber nichts was den mitteleuropäischen Glasgefäßen
aus Rubinglas vergleichbar war.“ [Kerssenbrock
2000, S. 385 f.]
Abb. 2002-1/068; Köpfe
opak-weißes und opak-schwarzes Glas, H 6 cm
Nevers oder Orléans, Anfang 18. Jhdt.
Barrelet 1964, S. 265, Abb. 13 u. 14, Smlg. Barrelet, Paris
„Die Glasproduktion in Frankreich wurde stark von
Italien beeinflusst. Der italienische Glasmacher aus
Altare Bernardo Perrotto ging mit seinem Wissen
über die Herstellung der verschiedenen Arten farbi-
gen Glases zuerst nach Liège, später nach Nevers
und 1662 nach Orléans.
Seite 42 von 146 Seiten pk-2002-1-2 Stand 25.02.2021Pressglas-Korrespondenz 2002-1
Wer hat das Glasgießen erfunden? wurde jedoch das Recht zur Nutzung der Erfindungen
Der betrogene Bernardo Perrotto von Perrotto auch anderen Glasmachern gewährt. Es
ist klar, dass der Minister der Finanzen Jean Baptiste
Nach Brockhaus 1894, Bd. 8, S. 48, wurde das Gießen
Colbert, der als Begründer der Industrie in Frank-
von Glas 1688 von Louis Lucas de Néhou in Paris
reich betrachtet wird, andere befähigte Glasmacher aus
erfunden. Auch nach Flachglas 1987, S. 92-93 wurde
Altare und Venedig eingeladen hatte, um ihnen ihre
nach der Encyclopédie von d’Alembert und Diderot
Geheimnisse zu entlocken [to do them out of their
1773 das Glasgießen für Glasspiegel von Louis Lucas
secrets] und um eine französische Glasmanufaktur
de Néhou in Paris erfunden. Nach anderen Quellen war
aufzubauen, was tatsächlich geschah.“ [tiscali 2001]
der Erfinder Abraham Thévart. Vor allem italienische
Quellen schreiben die Erfindung Perrotto zu. SG: Dieses Rätsel kann man auflösen:
Thévart war kein Glasmacher, sondern Advokat. Bei Perrotto hat das Gießen von Glas auf Metallflächen
diesem Projekt war er einer der Unternehmer: Loibl entwickelt, das zeigen eindeutig die „Medaillons“ mit
2010: „Der erfolgreiche Erfinder Nehou suchte einen Portraits von Louis XIV.: sie haben auf der Sichtseite
Geldgeber und Antragsteller für ein königliches ein Relief und sind auf der unsichtbaren Unterseite mehr
Privileg und fand den Pariser Bürger und Advokaten oder weniger eben und glatt. Glasplatten für Fenster
Abraham Thévart 1688 [Frémy 1909, S. 72, 77, 82, und Spiegel müssen auf beiden Seiten völlig eben
94, 265]. […] und glatt sowie gleich dick sein und möglichst ohne
Blasen! Das Privileg, das Perrotto vom König bekom-
„Ein Glasmacher in Orléans, Bernard Perrot, erfand
men hat, bezog sich auf das Verfahren von Portraits, es
1688 das Gießen von Glas auf eine Metall-Platte
hatte nichts mit Tafelglasplatten für Fenster und
[le verre coulé sur une plaque de métal]. Dieses Verfah-
Spiegel zu tun! Die Portraits von Perrotto waren auch
ren wurde nach der Mitte des 18. Jhdts. von der Manu-
nicht so groß, wie es für Fenster und Spiegel für das
facture Royale de Saint-Gobain übernommen.“
Schloss Versailles notwendig war!
[csantilli 2001]
Für das Schloss in Versailles brauchte man 1684 … vor
„Eine wichtige Erfindung wurde Ende des 17. Jhdts. in
allem riesige Fenster und Spiegel: Fassade und Spie-
Frankreich gemacht, durch einen Glasmacher in
gelsaal 17 große Fenster und Spiegel, 2513 Fenster und
Orléans, Bernard Perrot, der Neffe eines Glas-
357 Spiegel, alle großen Flächen wurden durch recht-
machers aus Nevers, der 1647 aus Altare gekommen
eckige Scheiben mit Bleiruten zusammen gesetzt.
war. Perrot besaß 1668 auch ein Privileg für rotes
Emaille auf Glas [privilège d’émaillage en rouge du Selbstverständlich hätte man das Verfahren von Perrotto
verre]. Er hatte die Idee, eine Glasmasse auf eine auch auf Glasscheiben für Fenster und Spiegel weiter
Metallplatte zu gießen, die ein Motiv trug, z.B. das entwickeln können. Dass er das getan hat, ist in der
Bild Louis XIV. [de couler une masse de verre bien Literatur bis jetzt nicht bewiesen worden! Dass er das
affiné sur une plaque de métal portant un motif en gedacht, gewünscht und behauptet hat, ist verständlich
creux, par exemple l’effigie de Louis XIV], was ihm … aber offenbar haben andere vor ihm oder gleichzeitig
1688 ein neues Privileg einbrachte.“ [gremaud 2001] von vorne herein ein ähnliches Verfahren für Fenster
und Spiegel entwickelt und damit die riesigen Mengen
„Perrotto zeichnete sich in Frankreich aus, wo er
an Fenstern und Spiegeln im Schloss Versailles
während der Regierung von Louis XIV. 1647 zusam-
ausgeführt … dass auch sie von Colbert mit der Manu-
men mit seinem Onkel Castellano die „Manufacture
faktur in Saint-Gobain „betrogen“ wurden, ist in der
Royale des Glaces et des Miroirs“ betrieb. Nach einer
Literatur gesichert! Perrotto bekam wenigstens eine
15 Jahre langen gemeinsamen Arbeit verließ er seinen
stattliche Rente …
Onkel und erhielt am 13. Juli 1662 2 Privilegien zum
Betrieb einer eigenen Glashütte in Orléans. In dieser „Tatsächlich wurde unter der Protektion des Sohnes
Glasfabrik [factory] verbesserte er das Glasmachen von Colbert, dem Marquis de Seignelay, die „Manu-
durch Gießen von einfachem und verarbeitetem Glas facture Royale des Glaces“ der Leitung von Nicolas
[casting both plain and wrought glass].“ [tiscali 2001] du Noyer in der Normandie übergeben und ein anderer
Glasofen wurde von Richard Lucas de Néhou betrie-
„In den Berichten der Académie Royale des Sciences
ben. Beide brauchten sowohl Lizenzen als auch
de Paris finden wir diese Notiz: 2. April 1687. M.
Finanzmittel. Colbert fand eine diplomatische Lösung
Perrot, Glasmeister der königlichen Glashütte in
durch den Zusammenschluss der beiden Unternehmen
Orléans [maitre de la verrerie royale] zeigte uns eine
am 23. September 1667. Das Unternehmen von
neue Anwendung seiner Künste, d.h. das Gießen von
Thévart hatte einen harten Start. Der Ausschuss bei der
Kristall und Glas in Scheiben [casting of crystal and
Herstellung war beträchtlich und die Geldgeber waren
glass into sheets] so, dass er sie hohl [?] wie Kameen
nicht zufrieden. Die Kosten wurden durch die Verlage-
machte [thus making them hollow like cameos]. Jede
rung der Glasfabriken [glassworks] zum Schloss von
Art von Form kann hergestellt werden - Ornamente,
Saint-Gobain in der Picardie verringert, wo die Kosten
Waffen, Inschriften usw. [any kind of shape can be
der Glasmacher, der Rohmaterialien und des Heizmate-
represented - ornaments, arms, inscriptions, etc.] Die
rials niedriger waren, es wurden Steuererleichterungen
Académie gewährte ihm ein Zertifikat. Für diese Erfin-
und andere Begünstigungen gewährt.“ [tiscali 2001]
dung bekam er 2 Patente am 7. Dezember 1668 und am
22. September 1672, später verlängert für weitere 10
Jahre. Rund 2 Monate nach seiner letzten Konzession
Stand 25.02.2021 pk-2002-1-2 Seite 43 von 146 SeitenPressglas-Korrespondenz 2002-1
„Dem jüdischen Flüchtling aus Venedig Abraham Gießen dem „Bernard Perrot, Directeur de la Verre-
Thévart wurde eine königliche Lizenz zum Glasma- rie d’Orléans“ zugeschrieben.“ [tiscali 2001]
chen gewährt, unterschrieben von Louis XIV. und
SG: Diese Anerkennung muss sich aber nicht auf
seinem Minister Colbert. Dieses Privileg - heute im
Fenster und Spiegel im Schloss Versailles beziehen!
Museum der Compagnie St. Gobain zu sehen - erlaubte
In Orleans wurden diese Fenster und Spiegel nicht
Thévart die Gründung einer Manufaktur nahe dem
hergestellt! Was alles in Orleans hergestellt wurde, ist
Chateau of St. Gobain. Die berühmten Spiegel von
nirgends zu finden! Es könnte aber sein, dass neben den
Versailles machte Thévart. Nach ihm übernahm sein
Portraits die opak-farbigen Figuren gemeint sind …
[vermutlich christlicher] Schwiegersohn Lucas de
Néhou die Leitung.“ [Kurinsky 1991]
Abb. 2002-1/070
Glasrelief [Médaillon], Portrait von Louis XIV.
Abb. 2002-1/069 «Cristal moulé en creux, de forme ovale»
Glasrelief [Médaillon], Portrait von Louis XIV. (1638-1715) [Kristallglas geformt in Hohlform, ovale Form]
«Cristal moulé en creux, de forme ovale» Bernard Perrot, Orléans, um 1680
[Kristallglas geformt in Hohlform, ovale Form] Sammlung Corning Museum of Glass
H 37 cm, B 30,5 cm
Bernard Perrot, Orléans, um 1680 «Le Roi Soleil est en buste, de profil à droite, portant une
Bénard 1989, Einband cuirasse métallique sur laquelle retombent une cravatte
lavallière et les boucles de la perruque.» [Der Sonnenkönig
Nach Bénard 1989, S. 44, gibt es in Frankreich 3 erhaltene ist als Büste dargestellt, trägt einen metallenen Brustpanzer
Glasreliefs von Louis XIV.: (Kürass), darüber eine Halsbinde / Kravatte und die Locken
Musée Historique de l‘Orléanais der Perücke]
Compagnie de Saint-Gobain
e
Privatsammlung M Savot, Orléans
„Am 1. May 1695 wurden die Unternehmen von
Bagneux und Thévart verboten [suppressed] und die „Das Gießen von Scheiben für Spiegel wurde in Frank-
„Manufacture Royale des Glaces de France“ unter reich von Abraham Thévart um 1688 entwickelt und
der Leitung von François Plastrier wurde mit einer führte zur Gründung der Glaswerke St. Gobain, die der
Lizenz auf 30 Jahre in Saint Gobain eingerichtet. hauptsächliche Hersteller bis zum Ende des 18. Jhdts.
Bernardo Perrotto wurden seine Lizenzen für das wurden, bis es auch in England eingeführt wurde. Bis
Gießen von Glas entzogen und seine Werkzeuge und 1691 wurden Scheiben von bis dahin nie da gewesener
Produkte wurden eingezogen. Seine Proteste und Größe hergestellt. Bei dieser Methode wurde Glas auf
Klagen blieben ungehört. Als einzige Anerkennung Metalltische gegossen, mit Rollen eben ausgebreitet,
erhielt Perrotto eine lebenslange Rente von 500 Lire, abgekühlt, geschliffen und poliert. Die Verzerrung des
später erhöht auf 800 Lire, bis er am 10. November Bildes, die man oft in frühem Tafelglas beobachten
1709 starb. Nicht nur wurde ihm verwehrt, den Nutzen kann, auch wenn es vollkommen flach und eben ist,
aus seinen Erfindungen zu ziehen, er wurde in französi- wird durch die unvollkommene Mischung des Rohmate-
schen Veröffentlichungen nicht einmal erwähnt und rials verursacht. Das mechanische Rühren geschmolze-
seine Erfindung wurde entweder Thévart oder De nen Glases wurde erst 1798 von Guinand eingeführt
Néhou zugeschrieben. Erst 1890 wurde durch Henry und 1805 verbessert. Chance bekam 1838 ein briti-
Havard [12; Bénard 1989, S. 15] das Glasmachen durch sches Patent für den Prozess, aber dieser wurde erst 10
Jahre später allgemein angewandt.“ [Seeley 2001]
Seite 44 von 146 Seiten pk-2002-1-2 Stand 25.02.2021Pressglas-Korrespondenz 2002-1
„Lucas de Nehou (1641-1728) wurde im Herrenhaus de die die Fabrikation von Spiegeln beherrschten, ihr
la Houque (Manche, Basse Normandie) geboren. Er war Geheimnis entlocken. [...] verlegte Nicolas du Noyer
ein Neffe von Richard, Sieur de Nehou, der die Fabri- sein Unternehmen an einen besser geeigneten Platz in
kation von Spiegeln beherrschte, die bis dahin ein Tourlaville. 1666 verpflichtete Colbert die «Compag-
italienisches Monopol war. Lucas de Nehou wurde nie Royale de Paris», mit dem Glasmacher [gentil-
vom Marquis de Seiqueley protegiert und war der homme verrier] Richard Lucas de Néhou Verbindung
erste, dem in Frankreich von König Louis XIV. erlaubt aufzunehmen, der ein königliches Privileg für Tourla-
wurde, farbloses Glas [verre blanc] zu fertigen. Dieses ville besaß [...].
Privileg behielt er sein ganzes Leben lang. 1655 be-
Richard Lucas de Néhou übernahm den Dienst als
herrschte er die Technik der Herstellung von
Direktor der «Compagnie Royale des Glaces». Die
Spiegeln [glaces à miroir]. 1688 leitete er eine neue
Familie Lucas lernte alle Prozesse der Fabrikation der
Manufaktur für große Spiegel mit mehr als 40 x 60 cm,
Venezianer zu beherrschen und die «Manufacture
wobei das Glas gegossen statt geblasen wurde [coulant
Royale» fertigte alle optischen Gläser, die im Obser-
le verre au lieu de le souffler]. 1693 wurde das Unter-
vatorium von Paris gebraucht wurden, das Colbert
nehmen in „Manufacture Royale“ umbenannt und in
1671 mit Gian Domenico Cassini gründen ließ. 1673
Saint-Gobain eingerichtet. Dort blieb Lucas de Nehou
konnte Colbert mit Stolz sagen: «Nos glaces sont
Direktor bis zu seinem Tod 1728.“ [http://lyc-lucas-de-
maintenant plus parfaites que celles de Venise».
nehou.scola.ac-paris.fr/historiq.htm#CV]
[Unsere Spiegel sind besser als die Spiegel aus Vene-
„Jean Baptiste Colbert (Finanzminister unter Louis dig] Louis Lucas de Néhou widmete sich weiteren
XIV.) machte grundsätzliche Anstrengungen, Spiegel Verbesserungen, bis mit den Ergebnissen eine blühende
herstellen zu lassen [...] um das Handelsdefizit mit nationale Industrie geschaffen wurde. Die ersten 4
Venedig zu verringern. Auf Anordnung von Colbert großen Spiegel wurden dem König Louis XIV.
gründeten die Glasmacher [gentilshommes verriers] übergeben. Sie sind in der «Galerie des glaces» in
Nehou aus der Normandie in Tourlaville bei Cherbourg Versailles eingebaut.
eine Manufacture Royale des Glaces. Sie entwickelten
Um 1750 beschäftigte die «Manufacture Royale de
schnell Spiegel guter Qualität und die Venezianer
Tourlaville» rund 500 Personen, Arbeiter, alte Solda-
waren gezwungen, in ihre Heimat zurück zu kehren.
ten, Frauen und Kinder. 200 Pferde zogen die Karren.
Louis-Lucas de Nehou entwickelte die Technik des
Um 1806 fertigte die Fabrik vor allem Fensterscheiben
Gießens von Glas und befreite so die französische
und Flaschen [verres à vitres et des bouteilles]. 1829
Produktion vollständig vom venezianischen Mono-
schliffen und polierten die übrig gebliebenen 160
pol.“ [www.alphaverre.ch/Histoire_00.html]
Glasmacher die rohen Spiegel anderer Unternehmen.
„Der Forst von Brix erstreckte sich im Tal des Flusses Aber nach Perioden unterschiedlichen Gedeihens und
Trottebecq, von Cherbourg bis Brix und Valognes, über Niedergangs wurde die Manufaktur endgültig 1830
ein großes Gebiet der Normandie aus, in dem nach dem geschlossen und das übrig gebliebene Personal nach
Journal des Gilles de Gouberville viele Glashütten Saint-Gobain beordert. 1831 berichten die Annalen von
arbeiteten. Das Journal des Gilles de Gouberville Manche: «La Manufacture de glaces de Tourlaville
berichtet auch, dass es 1560 in einem kleinen Dorf n’existe plus». 1834 wurde die alte Fabrik zusammen
südlich von Tourlaville, über dem Fluss Trottebecq und mit 72 Hektar Land für 108.350 Gold-Francs verkauft.“
angrenzend an den Forst von Brix, eine kleine Glashütte [http://perso.wanadoo.fr/la-glacerie/historique.htm]
gab, von der das Dorf den Namen „La Verrerie“
bekam. Später arbeitete die Glasmacherfamilie Bellevil- Abb. 2002-1/075; Glasfabrik Saint Gobain
le in der Glashütte bis 1616. Danach ging die Glashütte
an die Glasmacherfamilie Caqueray. In der Mitte des
17. Jhdts. leitete Antoine de Caqueray das Unterneh-
men. Bei seinem Tod 1653 erhielt Richard Lucas,
Sieur de Néhou, von Louis XIV. ein Privileg zur
Gründung einer Fabrik für Spiegel, Fensterscheiben
und Kristall [glaces, cristaux, verre à vitres; «toutes
sortes de cristaux, verres à vitres et à lunettes»]. Die
Rohmaterialien weißer Sand, Farnkraut, Seegras, Salz
und Kaolin [sable blanc, fougères, varech, sel, Kaolin]
waren vorhanden. Der Transport der Spiegel wurde
vom Hafen Cherbourg aus über das Meer betrieben
und von Le Havre nach Paris auf der Seine. „1665 gründete Colbert, einer der Minister von Louis
Richard Lucas de Néhou entwickelte und fertigte die XIV. eine königliche Spiegelglasfabrik. 1695 schloss
ersten farblosen Fensterscheiben [premiers verres sich die Fabrik mit einem zweiten Unternehmen zu-
blancs], die im Val-de-Grâce in Paris eingebaut wur- sammen, das 1692 auf dem Gelände des Schlosses
den. 1665 ließ Colbert durch Nicolas du Noyer die Saint-Gobain, Aisne, gegründet wurde und sich auf
«Manufacture Royale des glaces à miroir» in der große Spiegel spezialisiert hatte. Das neue Unterneh-
Vorstadt Saint-Antoine von Paris gründen. Colbert men vervollkommnete den Prozess des Glasgießens
wollte den Glasmachern aus Venedig und Murano, auf einem Tisch, erfunden 1688 ...“ [www.saint-
gobain-vitrage.com/us/histoire.html]
Stand 25.02.2021 pk-2002-1-2 Seite 45 von 146 SeitenPressglas-Korrespondenz 2002-1
„Gegründet 1665 durch Louis XIV. auf Betreiben von landen. Colbert schuf neue Industrien (Tapisseries de
Colbert, der das Monopol von Venedig bekämpfen Beauvais, des Gobelins, Glaces de Saint-Gobain,
wollte, bekam die „Compagnie des glaces de Saint- Draperies à Abbeville et Sedan, Soieries de Lyon), er
Gobain“ das Privileg zur Fabrikation von Flachglas erhöhte mit seinen Maßnahmen das Nationalprodukt
und Spiegeln. Sie wurde eine „Manufacture Royale“ und den Außenhandel. Bei Colberts Tod war Frankreich
und exportierte nach ganz Europa. Anfang des 19. Jhdts. die erste Kolonialmacht der Welt.
ermöglichte die Nutzung von industriell hergestelltem
Seit 1668 förderte Colbert als Staatssekretär der Marine
Soda [soude] - erfunden von Gay-Lussac - eine neue
die Macht Frankreichs auf den Weltmeeren durch den
Ausdehnung. Saint-Gobain baute 1822 bzw. 1830 unter
Aufbau einer Schiffsbauindustrie für eine Kriegsflotte
der Leitung von Gay-Lussac eine eigene Herstellung in
und den weiteren Ausbau von Häfen. 1669 machte der
Charlesfontaine und Chauny auf. 1830 wird Saint-
König Colbert verantwortlich für die königlichen
Gobain eine Aktiengesellschaft. 1843 wird Gay-Lussac
Bauten und die Förderung von Wissenschaften und
Präsident von Saint-Gobain.“ [www.bibliotheque.-
Künsten („surintendant des Bâtiments du roi, arts et
polytechnique.fr/associations/gaylussac/pages/-
manufactures“).
GlacesGL.html]
Der älteste Sohn von Colbert, Jean Baptiste Marquis
Auch mit der „alten“ aufgegebenen Glashütte von Saint
de Seignelay (1651-1690), folgte 1683 seinem Vater als
Gobain hatte die Glasmacher-Familie Cacquerel
Staatssekretär der Marine und 1689 als Sekretär des
Verbindungen. Ein italienischer Glasmacher, Nach-
Staates. Er soll an der Gründung des Glaswerks Saint-
komme von Jacques Dorlodo, der 1476 in Vendresse
Gobain beteiligt gewesen sein. [Zusammenfassung aus
und Omont (Ardennes) gearbeitet hatte, Marc de Dordo-
britannica CD 2000 und Brockhaus 1894]
lot, Herr von Gloriettes (Louvergny) und von Essarts
bei Rethel heiratete Louise de Cacquerel. Zusammen
Abb. 2002-1/071
mit Glasmachern der Familien Beauvais, Thyzac und Kind auf einem Fass (Bacchus)
Brossard zogen sie 1639 in den Forst von Saint Go- opak-weißes und rubinrotes Glas, H 18,5 cm
bain. Ihre Erben Jean und Jeanne Dordolot wurden vom Bernard Perrot, Orléans, 17. Jhdt.
König Louis XIII. als Adelige [gentilhommes] bestätigt aus Bénard 1989, S. 56 u. 110, Abb. 20
Musée de la Céramique, Rouen
und erhielten 1604 das Recht auf eine Glashütte in Flins
bei Fère, wo sie mit Jean Cacquerel und Maubry
Colnet zusammen arbeiteten. [Kokanosky 2000]
Jean-Baptiste Colbert und der Merkantilismus
Jean Baptiste Colbert (geb. 1619 in Reims - gest. 1683
in Paris) stammte aus einer bürgerlichen Familie. 1651
wurde er von Kardinal Mazarin (1602-1661, reg.
1642-1661) mit der Verwaltung seiner persönlichen
Angelegenheiten und Finanzen beauftragt. Colbert
wurde dabei reich und Baron von Seignelay. Bei
seinem Tod empfahl Mazarin Colbert dem jungen
König Louis XIV. Colbert reformierte als erstes die
aus dem Mittelalter hergekommene Besteuerung
und stärkte damit die Finanzen des Königs und des
Staates. Er betrieb den Sturz von Nicolas Fouquet, bis
dahin „surintendant des finances“. Colbert wurde
Intendant der Finanzen, 1665 wurde er „Contrôleur
Général des Finances“. Zur Stärkung der Macht
Frankreichs und seiner Position gegen die Nieder-
lande im Welthandel betrieb er die Reorganisation
von Fertigung und Handel. Dies bedeutete einerseits
die Herstellung von Waren mit hoher Qualität, ander-
seits den Ausbau von Straßen, Kanälen und Häfen
sowie den Aufbau einer Handelsflotte und die Erobe-
rung von überseeischen Kolonien. Dazu förderte
Colbert die Zuwanderung von ausländischen Hand-
werkern, förderte private Industrien mit Privilegien
und ließ staatliche Manufakturen gründen. 1664
wurden die französischen Compagnie des Indes orienta-
les und die Compagnie des Indes occidentales gegrün-
det, 1669 die Compagnie du Nord und 1673 die Com-
pagnie du Sénégal, später andere Handelsunternehmen
für das östliche Mittelmeer und das nördliche Europa.
Der Wettbewerb mit Einfuhrzöllen und staatlicher
Förderung führte 1672-1678 zum Krieg mit den Nieder-
Seite 46 von 146 Seiten pk-2002-1-2 Stand 25.02.2021Pressglas-Korrespondenz 2002-1
Abb. 2002-1/072; Kind mit Tablett und Fußschale Abb. 2002-1/074
opak-weißes und farbloses Glas, H 17 cm Figur eines Chinesen / Siamesen
Bernard Perrot, Orléans, 17. Jhdt. opak-weißes, rubinrotes u. farbloses Glas, H 22 cm
aus Bénard 1989, S. 57 u. 111, Abb. 21, private Sammlung Bernard Perrot, Orléans, 17. Jhdt. (1686?)
aus Barrelet 1964, S. 263
Musée des Arts Décoratifs, Paris, Sammlung Carnot
Abb. 2002-1/073; Frauenbüste mit Leuchtermanschette
opak-weißes und farbloses Glas, H 11 cm
Bernard Perrot, Orléans, 17. Jhdt.
aus Bénard 1989, S. 61 u. 111, Abb. 27
Musée National Adrien-Dubouché, Limoges
Stand 25.02.2021 pk-2002-1-2 Seite 47 von 146 SeitenPressglas-Korrespondenz 2002-1
Anmerkungen 11 J. Habets, Venetiaanse glasfabrieken
te Maastricht (1640-1700),
SG: Die Hugenotten mit ihren erfolgreichen
in „De Maasgouw 6“, 1888, p. 1012
Manufakturen waren von Louis XIV. und
P. Doppler, Glasblazers te Maastricht in 1667,
Colbert durch die Kriege gegen die Hugenotten
in „De Maasgouw 41“, 1921, p. 14
von 1562 - 1598 längst in mehrere Staaten in
J. Brouwers, Een glasblazerij te Smeermaas (1656),
Europa vertrieben worden … Für die Politik von
in „Limburg“ 49, 1970, p. 267
Colbert waren sie immer noch verboten:
O. Drahotova, L’art du verre in Europe,
unter Louis XIV. : Dragonaden und Edikt von
Parigi 1983, p. 104
Fontainebleau 1685. Deshalb mussten zum
J. M. Baart, Una vetreria di tradizione italiana
Aufbau der Wirtschaft in FR vor allem Tuch- /
ad Amsterdam, in „Archeologia e storia della
Seidenmacher und Glasmacher aus dem katho-
produzione del vetro preindustriale“,
lischen Venedig und dem jüdischen Altare
a.c. di M. Mendera, Atti del Convegno Internazio-
geholt werden, z.B. Thévart und Perrotto.
nale, L’attività vetraria medievale in Valdelsa
[Colle di Val d'Elsa], Firenze 1991, pp. 423-425
1 A. Ferretto, Documenti intorno alle relazioni tra
Alba e Genova, in Bibl. della Società Storica Sub. www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/
a cura di F. Gabotto, Pinerolo, 1906, XXIII, pk-2001-5w-minisci-kristall-toskana-schmid-1845.pdf
vol I., doc. I, p.1 12 Histoire de l’Académie Royale des Sciences,
F. Noberasco, L’isola di Liguria e la badia di Paris 1733, Tome II, p.20 Ms. Perrot
Sant’Eugenio, in „Atti della Società Savonese di E. Gerspach, op.cit., p. 213
Storia Patria“, Savona, 1830, vol. XII, p.163 Henry Havard, Dictionnaire de l’ameublement et
C. Varaldo, Il patrimonio terriero dell’Abbazia di de la décoration, Paris 1890, T. IV, col. 1561
S. Eugenio „De Insula Liguria“, in „Italia Benedet- E. Fremy, Histoire de la manifacture royale des
tina“, II, Liguria Monastica, Cesena, 1979, p. 315 glaces de France, Paris 1909
2 A. S. G., N. De Porta, 23-4-1288 P. M. Bondois, Les Verreries nivernaise et
3 F. Podestà, Il porto di Genova, orlèanaise au XVII siècle - Jean Castellan et
Genova, 1913, pp. 326-327 Bernard Perrot, Paris 1932, pp. 2-7
4 S. Fossati, T. Mannoni, Lo scavo della Vetreria L. Zecchin, Bernardo Perrotto, vetraio altarese,
Medievale di Monte Lecco, Estratto dal „Giornale economico“,
in „Archeologia medievale“, II, 1975 Venezia 1950, pp. 35-36
5 A.S.S., L. Rusca, 9-6-1371; 23-2-1375 J. Barrelet, Un virtuose de la Verrerie au temps
6 G. Malandra, I vetrai di Altare, de Louis XIV: Bernard Perrot,
Savona 1983, p. 99 in Connaissance des Arts, 78, agosto, 1958
7 M. Badano Brondi, Storia e tecniche del vetro J. Barrelet, op.cit. p. 83
preindustriale. Dalla Liguria a Newcastle, A. Gasparetto, Il vetro di Murano dalle origini,
Genova 1999, p. 31 Venezia, 1958, pp. 170-171
8 Cfr. G. Malandra, op.cit. 13 W. A. Thorpe, A History of English and Irish
A. Mallarini, L’Arte Vetraria Altarese, Glass, London 1929, I, pp. 142-195
Albenga 1995 14 H. Newmann,The Dictionary of Glass,
9 Statuta Artis Vitreae Loci Altaris London 1977, pag. 192
- 15 febbraio 1495 15 W. A. Thorpe, op. cit., I, pp. 119-124
La pergamena originale si trova Gasparetto, op. cit., p. 109
nell’Archivio di Stato di Torino, Monferrato, 16 Kurinsky, Samuel, Jüdische Glasmacher in
Feudi, mazzo 5, fasc. 2 Venedig,
10 Cfr. A. Boutillier, La Verrerie et les gentilshom- www.hebrewhistory.org/factpapers/-
mes verriers de Nevers, Nevers 1885 29venzia.htm#ch1
H. Schuermans, Les medailles en verre d’Altare,
in „Révue Belge de numismatique, Liegi 1885 SG: alle Links 2002!
E. Gerspach, L’art de la Verrerie, Parigi 1885
F. Pholien, La verrerie au pays de Liège,
Liegi 1899
J. Barrelet, La verrerie en France de l’époque
Gallo-Romaine à nos jours, Parigi 1953
R. Chambon, L’histoire de la Verrerie en Belgique
du IIème siècle à nos jours, Bruxelles 1955
G. R. Villequey, Verre et verriers de Lorraine,
Parigi, 1971
J. Philippe, Histoire et art du verre, Liège 1982
Seite 48 von 146 Seiten pk-2002-1-2 Stand 25.02.2021Pressglas-Korrespondenz 2002-1
SG: Zeittafel zu Bernardo Perrotto:
1565 Lodovico Gonzaga-Nevers holt Glasmacher aus 1678- Versailles wird von Jules Hardouin-Mansart, dem
Altare und italienische Fayencemacher nach Nevers 1708 Großneffen von François Mansart, vergrößert,
1569 Glasmacher von Altare gingen erstmals nach Liège darunter die Spiegelgalerie
(Nicola Francisci) [Bénard 1989, S. 19, 20] Gläser nach dem Verfahren von Bernardo Perrotto
1579 Glasmacher von Altare gingen erstmals nach Nevers. zum Gießen von Glas werden erst im „Cabinet du
[Bénard 1989, S. 19] Conseil“ verwendet [Bénard 1989, S. 31]
1612 Antonio Neri veröffentlicht in Florenz „L‘Arte vitraria“ 1679 Antonio Neri, „L‘Arte vitraria“, wird von Johann
1627 Maria Gonzaga-Nevers holt Glasmacher aus Altare Kunckel aus dem Lateinischen (Merret 1662-1668)
nach Nevers, darunter Giovanni Castellano ins Deutsche übersetzt und in Leipzig veröffentlicht
1630 Jean Bonhomme übernimmt die beiden Glashütten [Bénard 1989, S. 97]
der Glasmacher von Altare in Liège 1688 Bernardo Perrotto bekommt ein Patent für das
die beiden Söhne von Jean Bonhomme fertigen Glas Gießen von Glas [Bénard 1989, S. 13]
in Liège, Huy, Antwerpen, Brüssel, Bois-Le-Duc, 1693 Abraham Thévart beginnt das Gießen von Glas
Maastricht, Mézieres u. Verdun [Bénard 1989, S. 20 in der Manufacture Royale des glaces de Saint-
1619 Bernardo Perrotto wird in Altare als Sohn von Fran- Gobain [Bénard 1989, S. 30]
cesco Perrotto geboren [Bénard 1989, S. erratum] 1695 Beschlagnahme der Mittel der Fabrikation von
1651 Bernardo Perrotto erneuert seinen Vertrag mit seinem Bernardo Perrotto durch die Manufacture Royale des
Onkel Jean Castellan in Nevers [Bénard 1989, S. 13] glaces de Saint-Gobain [Bénard 1989, S. 13 u. 30]
1656 die Rechte von Bernardo Perrotto und seinem Onkel 1696/ Bernardo Perrotto bekommt eine staatliche Pension
Jean Castellan an der Glashütte Nevers werden 1702 von 500 Livre, ab 1703 von 650 Livre
erneut bestätigt [Bénard 1989, S. 13 u. 21] [Bénard 1989, S. 13 u. 30]
1662- Antonio Neri, „L‘Arte vitraria“, wird von Christopher um Paul Massolay stirbt
1668 Merret ins Englische und ins Lateinische übersetzt 1700 [Bénard 1989, S. 95]
und 1668 in Amsterdam veröffentlicht 1702 Marie Clouet, die Frau von Bernardo Perrotto stirbt
[Bénard 1989, S. 97] [Bénard 1989, S. 15]
1662 Bernardo Perrotto bekommt das Recht zur Gründung 1709 Bernardo Perrotto stirbt in Orléans „im Alter von 71
einer Glashütte in Orléans, die Glashütte wird von Jahren“ lt. Kirchenbuch [Bénard 1989, S. erratum]
seinen Nachfolgern bis 1754 betrieben 1710 die Privilegen von Bernardo Perrotto werden für seine
Perrotto fertigt „Rouge des anciens“, „émaux sur Neffen Jean Perrotto und Jaques Jourdan erneuert
cuivre“, „porcelain de verre“, „statuettes en verre [Bénard 1989, S. 15]
blanc de lait“, Perrot führt das Blasen in Formen 1710 in Fay-aux-Loges im Wald bei Orléans wird von den
wieder ein, er entwickelt das Gießen von Glas Perrottos eine 2. Glashütte geründet:
[Bénard 1989, S. 13, 17 u. 55] La Cour Saint-Jacques [Bénard 1989, S. 15 u. 32 f.]
1666 Bernardo Perrotto wird Franzose und geadelt 1720 die Glashütte von Perrotto und seinen Nachfolgern in
(Seigneur de Beauvoir à Olivet) [Bénard 1989, S. 13] Orléans wird aufgegeben [Bénard 1989, S. 94]
1666 Bernardo Perrotto bekommt ein Monopol 1726 die Glashütte von Jean Castellan und seinen Nach-
„sur la Loire“ auf 30 Jahre [Bénard 1989, S. 13] folgern in Nevers geht bankrott [Bénard 1989, S. 23]
1672 Jean Castellan stirbt [Bénard 1989, S. 23] 1730 Nicolas Massolay stirbt [Bénard 1989, S. 95]
1672 das Privileg für Bernardo Perrotto wird um 20 Jahre 1738 Verkauf der Glashütte La Cour Saint-Jacques in
verlängert, es wird auf ganz Frankreich ausgedehnt, Fay-aux-Loges [Bénard 1989, S. 15]
aber ohne Monopol „sur la Loire“ 1740 Brand der Glashütte La Cour Saint-Jacques in
[Bénard 1989, S. 13] Fay-aux-Loges [Bénard 1989, S. 15]
1668 Bernardo Perrotto bekommt ein Patent für das 1741 Wiederaufbau der Glashütte La Cour Saint-Jacques
Gießen von Spiegelglas („coulage des glaces“) in Dauberterie Fay-aux-Loges (Clos de la Coquinière)
[Bénard 1989, S. 13] [Bénard 1989, S. 15]
1671 Paolo Mazzolao de la Motta (Paul Massolay) aus 1752 Antonio Neri, „L‘Arte vitraria“, wird von Baron
Venedig bekommt das Recht zur Gründung einer d‘Holbach ins Französische übersetzt und in der
zweiten Glashütte in Orléans Encyclopédie veröffentlicht [Bénard 1989, S. 97]
[Bénard 1989, S. 28, 94 f.] 1754 die Glashütte von Bernardo Perrotto in
1671 Bernardo Perrotto bekommt ein Patent für das Fay-aux-Loges bei Orléans wird von seinen Nachfol-
1672 Gießen von Glas gern aufgegeben [Bénard 1989, S. 13, 15, 17, 94]
1673 [Bénard 1989, S. 13]
Abb. 2002-1/075; Spiegel-Herstellung nach dem Verfahren der Glasfabrik Saint Gobain
Stand 25.02.2021 pk-2002-1-2 Seite 49 von 146 SeitenSie können auch lesen