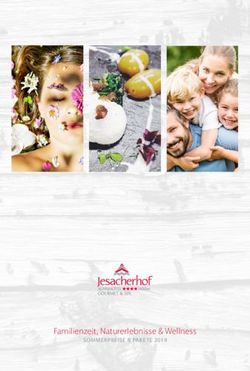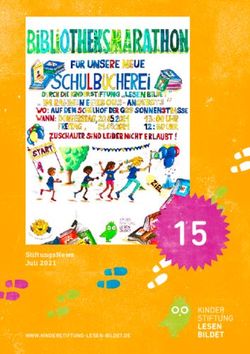Im Kanton Aargau steigt die Zahl der Schülerinnen und Schüler in Sonderklassen an
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Obligatorische Bildung schälen war das Ziel einer des Departements Bil-
dung, Kultur und Sport des Kantons Aargau in
Auftrag gegebenen Studie, deren Ergebnisse nun
vorliegen. Die Studie wird im Folgenden vorge-
stellt.
Einzelne Schulen unter der Lupe
Priska Sieber
Um ein Maximum an relevanten Informatio-
Im Kanton Aargau steigt die nen zu gewinnen, wurden mittels offener Er-
Zahl der Schülerinnen und hebungsverfahren in ausgewählten Gemeinden
Fallstudien durchgeführt. Die Wahl der Fall-
Schüler in Sonderklassen an
gemeinden wurde aufgrund statistischer Analy-
sen getroffen. Auswertungen von Zahlen der
Eine aktuelle Studie über die Situation der Aargauer Schulstatistik haben einen positiven
Einschulungs- und Kleinklassen im Kanton Zusammenhang der Aussonderungsquoten und
Aargau bringt zu Tage, dass im Bildungs- dem Anteil fremdsprachiger Schülerschaft re-
system des Kantons Aargau einiges im Argen spektive dem Angebot an Einschulungs- und
liegt. So ist etwa das Beurteilungssystem längst Kleinklassen einer Gemeinde ergeben. Für die
veraltet, die Zuweisungsprozesse von einer Fallstudien wurden sieben Gemeinden ausge-
grossen Beliebigkeit geprägt und die Diskussi- wählt, die sich entlang der drei genannten Di-
on um Schulentwicklung nur marginal ein mensionen unterscheiden (vgl. Tabelle S. 16).
Thema. Die Autorin stellt die Studie vor und Es wurden je zwei Fälle aus den Eckfeldern ,
präsentiert Empfehlungen, wie mit den stei- und der Tabelle 1 ausgewählt. Zusätzlich
genden Schülerzahlen in Sonderklassen um- wurde ein Fall des relativ häufigen Musters «An-
gegangen werden könnte. teil Fremdsprachige tief, EK hoch & KK tief» ge-
wählt (Fall ). Damit war es möglich, z.B. Fragen
folgender Art zu beantworten: Warum hat die
Stetig anwachsende Zuweisungen in Sonder- Gemeinde so wenige Sonderklassenkinder, ob-
klassen sind nicht nur im Kanton Aargau zu be- wohl dort überdurchschnittlich viele fremdspra-
obachten. Als Gründe dafür werden in der Fach- chige Kinder zur Schule gehen? Was genau pas-
literatur z.B. die zunehmende Heterogenität der siert in , wo nur wenige fremdsprachige Kinder
Schülerschaft genannt, aber auch die Bildungs- zu integrieren sind, trotzdem aber viele Kinder
expansion, die den Leistungs- und Erfolgsdruck der Sonderklasse zugewiesen werden?
hebt und damit – insbesondere in selektiven Bil- Die Fragestellungen für die Fallstudien wur-
dungssystemen – die Tendenz zur Aussonderung den aufgrund einer explorativen Vorstudie, aus
erhöht. Allerdings ist die Sonderklassenquote im den Erkenntnissen der Literatur und aufgrund
Kanton Aargau im schweizerischen Vergleich re- der Sichtung diverser Reglemente und Verord-
lativ hoch (vgl. Abbildung S. 15). nungen des Kantons Aargau abgeleitet. So inter-
Zudem zeigte eine Studie aus dem Jahre 2000 essierten beim Besuch der Schulen etwa folgende
(Kronig; Haeberlin; Eckhart) auf, dass im Aargau Bereiche:
– im Vergleich zu allen anderen Kantonen – die • Wie werden Schülerinnen und Schüler (mit
relative Überweisungsquote1 fremdsprachiger Lernschwierigkeiten) beurteilt?
Kinder in Sonderklassen am höchsten ist. Die für • Wie gestaltet sich der Zuweisungsprozess in
den Kanton Aargau spezifischen Faktoren der eine EK und eine KK?
hohen Zuweisungsquoten in Einschulungs- • Welche Funktion und welchen Stellenwert
klassen (EK) und Kleinklassen (KK) herauszu- haben EK und KK?
14 SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR HEILPÄDAGOGIK 1/2003• Wie funktioniert die Zusammenarbeit? Im Widerspruch
• Wie werden die an der Schule zur Verfügung zum Volksschulgedanken
stehenden Ressourcen beurteilt? Die Studie zeigt auf, dass die Schulen im Kan-
• Welche auf die Schülerschaft abgestimmten ton Aargau durch den sich wandelnden Kontext
lokalen Anpassungen wurden getroffen? überfordert sind. Dazu trägt die mangelnde An-
• Welche Aspekte beeinflussen das Einrichten passung des Aargauer Bildungssystem an die zu-
neuer EKs und KKs? nehmende Heterogenität der Schülerschaft bei.
• Besteht an der Schule eine Diskussion über Die Schulen reagieren deshalb mit Aussonderung
die Einführung der Integrativen Schulungsform? von für sie schwierigen (überproportional häufig
fremdsprachigen) Schülerinnen und Schüler in
In den sieben gewählten Gemeinden wurden EKs und KKs. Im Kanton Aargau wird diese
insgesamt 60 rund einstündige Einzel- und Option häufig gewählt, weil
Gruppeninterviews mit total 91 Personen durch- 1. sie (im Gegensatz zu anderen Massnahmen)
geführt (Kindergarten-, Primar-, Real-, Einschu- verfügbar ist – die EK- und KK-Pensen werden
lungsklassen-, Kleinklassen- und Sprachheillehr- aufgrund der von den Schulen definierten und
personen, Lehrkräfte für Deutsch für Fremdspra- gemeldeten Schülerzahlen vom Kanton bewil-
chige, Schulpfleger und Schulpflegerinnen, El- ligt;
tern und Schulpsychologinnen und -psycho- 2. sie für die Regelklassenlehrkräfte eine Entlas-
logen). Die Interviews wurden inhaltsanalytisch tung bewirkt;
ausgewertet und sowohl zu Einzelfällen verdich- 3. Schülerinnen und Schüler aufgrund subjekti-
tet als auch Fall vergleichend analysiert und im ver Kriterien der Kindergartenlehrpersonen und
Hinblick auf idealtypische Muster reduziert. Lehrkräfte und ohne Beizug einer Fachinstanz
einer EK oder KK zugewiesen werden können;
Abbildung: Anteil Schülerinnen und Schüler in Abteilungen mit besonderem Lehrplan, Schuljahr 1999/2000
(Quelle: Bundesamt für Statistik)
SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR HEILPÄDAGOGIK 1/2003 15Tabelle: Wahl der Fallstudien2 (* nur Gemeinden mit mehr als 100 Primarschülerinnen und -schülern)
4. die meisten Lehrkräfte einen positiven Glau- Ergebnis der Studie
ben an Separation haben – sie sind davon über- Konkret identifiziert die Evaluation fünf
zeugt, dass die Kinder in einer EK respektive einer Problembereiche, die verantwortlich für die an-
KK besser gefördert werden können als in der wachsenden Zuweisungsquoten in Einschu-
Regelklasse; lungs- und Kleinklassen im Kanton Aargau sind:
5. die meisten Lehrkräfte und Schulpsycho- So die Beurteilung, die Zuweisungspraxis, das
loginnen und -psychologen die Ursachen für Angebot an Sondermassnahmen, der Umgang
schulische Schwierigkeiten der Schülerinnen und mit Heterogenität und die Ressourcen. Zu diesen
Schüler nicht der Schule zuweisen, sondern sie Bereichen werden schliesslich Empfehlungen ab-
bei der Persönlichkeit des Kindes oder dessen gegeben.
Umfeld lokalisieren.
Die Fallstudien in den sieben Gemeinden zei- Undifferenzierte Beurteilung
gen insgesamt auf, dass sich die Zuweisungs- Die Beurteilung, ob ein Kind dem ordentli-
praktiken in den einzelnen Schulen stark unter- chen Unterricht nicht zu folgen vermag (und so-
scheiden. Die Unterschiede werden geprägt mit als lernbehindert eingestuft wird) und des-
durch die Einstellung und Kompetenz der Lehr- halb in einer EK oder KK unterrichtet werden
person, durch den Kontext und die Struktur der muss, hängt zu einem beträchtlichen Teil von der
Schule, durch das lokal vorhandene Angebot an Beurteilungspraxis der Lehrkräfte und Kinder-
Sondermassnahmen, durch die in der Schule de- gartenlehrpersonen ab. Kindergartenlehrpersonen
finierten Abläufe, durch den jeweiligen Ansatz etwa tendieren – je nach Klientel – zu einem
des zugeteilten Psychologischen Schuldienstes Überschonungsansatz3 . So werden in gewissen
und durch die zusätzlich mobilisierten Ressour- Gemeinden Kinder bereits für eine EK-Zuwei-
cen. So dienen beispielsweise die Kleinklassen in sung in Betracht gezogen (z.T. auch von Seiten
den Gemeinden aus , um u.a. Schülerinnen der Eltern), wenn sie durch Therapien belastet
und Schüler vom Selektionsdruck der 5. Primar- sind, noch langsam und verträumt sind oder sich
klasse zu entlasten. Die unterschiedlichen Prakti- noch nicht so konzentrieren können wie andere
ken in den einzelnen Gemeinden führen zu einer Kinder in der Gruppe. Für eine Zuweisung in
gewissen Beliebigkeit. Die damit verbundene eine KK sind bei Kindern, die bereits repetiert
Ungerechtigkeit widerspricht dem grundsätzli- haben, oft ungenügende Noten eine ausreichen-
chen Anspruch der Kinder auf gleiche Förderung. de Begründung. Dabei ist zu beachten, dass der
16 SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR HEILPÄDAGOGIK 1/2003Kanton Aargau eines der älteste Promotions- lichkeit des Kindes oder dessen Umfeld lokali-
reglemente der Schweiz besitzt und schon mehre- siert, anstatt die Probleme auch im schulischen
re Anläufe gestartet wurden, dieses den allgemei- Handeln zu sehen.
nen Entwicklungen anzunähern und die Beurtei- Im Falle eines Beizugs einer Fachstelle für die
lung lehrplankonform zu gestalten (vgl. Vögeli- Beurteilung der Schülerinnen und Schüler ist
Mantovani 1999). Solange jedoch vorwiegend dieser geprägt durch eine grosse Diversität der
am Klassendurchschnitt orientierte schriftliche Zugänge der einzelnen Psychologischen Schuldienste
Prüfungen als Mass für Schulerfolg gelten, wird (PSD). Sie unterscheiden sich bezüglich Art und
immer ein mehr oder weniger grosser Anteil an Zeitpunkt des Einbezugs der Beteiligten, der
Schülerinnen und Schüler als lernbehindert defi- Abklärungsverfahren, der Berichterstattung und
niert (und je nach Kontext ganz andere Schüler- welche Art von Massnahmen bevorzugt empfoh-
innen und Schüler). Insbesondere fremdsprachi- len werden. Die Massnahme «Einschulungs-
ge Kinder haben so weniger Chancen auf Schul- klasse» oder «Kleinklasse» scheint allgemein von
erfolg. Seiten der PSD häufig empfohlen zu werden,
aufgrund der Zahlen insbesondere für fremdspra-
Empfehlung chige Schülerinnen und Schüler. Zudem fehlt ein
Im Bildungssystem des Kantons Aargau ist systematisches Kontrolling dieser im Kanton
eine Anpassung des Beurteilungssystems ange- Aargau privat, kommunal oder regional geführ-
zeigt. Dieses muss in Richtung Lernzielorien- ten Instanz.
tierung, Ganzheitlichkeit und Kommunikation
als Zielgrössen formuliert sein und den Lehrkräf- Empfehlungen
ten sollten entsprechende Instrumente zur Verfü- Um die Beliebigkeit des Zuweisungsprozesses
gung gestellt werden. Zudem muss die Zuwei- zu reduzieren, sind Anpassungen in verschiede-
sung in eine Kleinklasse von den Noten ent- nen Bereichen anzustreben. Erstens sind die Zu-
koppelt werden (vgl. unten). weisungsprozesse stärker auf den Einbezug und
die Kooperation aller Beteiligten auszurichten.
Denkbar ist etwa das Einrichten einer periodisch
Beliebigkeit der Zuweisungspraxis stattfindenden Beurteilungs- und Zuweisungs-
Auch wenn formal – und wie in den kantona- konferenz, an welcher z.B. ein qualifiziertes Team
len Reglementen vorgesehen – die Schulpflege von Lehrkräften, die Schulleitung, eine Vertre-
über eine Zuweisung in eine EK oder KK ent- tung des Psychologischen Schuldienstes und eine
scheidet, liegt die Hauptverantwortung der Zuwei- Vertretung der Schulpflege über die Beurteilun-
sung bei den Kindergartenlehrpersonen respektive gen und die verschiedenen Gesichtspunkte der
bei den Lehrkräften. Sie ermöglichen und beurtei- vorgeschlagenen Massnahmen befinden. Wich-
len, ob ein Kind dem Unterricht in der Regel- tig ist zudem die periodische Überprüfung und
klasse nicht zu folgen vermag (vgl. oben). Gelingt allfällige Anpassung der getroffenen Massnah-
es den Kindergartenlehrpersonen respektive den men. Zweitens muss die Arbeit der PSD vom
Lehrkräften, die Eltern von der Richtigkeit einer Kanton gesteuert werden. Es muss ein differen-
EK- respektive einer KK-Zuweisung zu überzeu- zierter Leistungsauftrag erteilt und die Tätigkeit
gen, ist weder ein Fachstellenbericht für die Zu- der PSD einem strengen Qualitätsmanagement
weisung notwendig4 , noch sehen die Schul- unterworfen werden. Allgemein muss die Belie-
pflegen einen Bedarf, den Vorentscheid zu über- bigkeit der Zuweisungsprozesse eingedämmt
prüfen. Die Zuweisung basiert in diesen Fällen werden, einerseits durch eine Generalisierung der
vorwiegend auf der Sicht der Lehrkraft, die nicht Zuweisungsstrukturen und anderseits mittels
in jedem Fall alle Gesichtspunkte ausgewogen Vorgaben bezüglich des diagnostischen Systems.
beurteilt. Auffallend häufig werden die schuli-
schen Schwierigkeiten der Kinder bei der Persön-
SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR HEILPÄDAGOGIK 1/2003 17Kaum Alternativen zu Sonderklassen Damit integrative Schulformen erfolgreich
Welche Art von Massnahmen für Schüler- sind, ist es notwendig, dass eine Mehrheit der
innen und Schüler ergriffen werden, die dem or- beteiligten Lehrkräfte an einer Schule die Integra-
dentlichen Unterricht nicht zu folgen vermögen, tion von Schülerinnen und Schülern mit Lern-
hängt u.a. vom Angebot an Massnahmen und den schwierigkeiten unterstützt. Die vorliegende
Einstellungen der Lehrkräfte und Schulpsycholo- Untersuchung zeigt, dass diesbezüglich im Kan-
ginnen und -psychologen ab. Im Kanton Aargau ton Aargau noch viel Informationsarbeit zu leis-
besteht für Schülerinnen und Schüler mit Lern- ten ist, da der positive Glaube an Separation vor-
schwierigkeiten ein z.T. nur beschränkt verfügba- herrscht. Es muss in dieser Hinsicht ein Kultur-
res Angebot an Stützunterricht und Therapien. wandel in den Schulen initiiert werden. Die Un-
Im Gegensatz dazu ist an den meisten grösseren terstützung in der Lehrerschaft wird gefördert,
Gemeinden ein beinahe beliebig ausbaubares An- wenn die Integrative Schulungsform unter für die
gebot an EK und KK vorhanden. Es müssen einzig Schulen attraktiven Bedingungen (kleine Klas-
Schülerinnen und Schüler definiert werden, die sen, genügend Ressourcen zum Aufbau der nöti-
dem ordentlichen Unterricht nicht zu folgen ver- gen Kooperationsstrukturen) eingeführt wird.
mögen und die entsprechenden Zahlen dem
Departement Bildung, Kultur und Sport einge-
reicht werden, wo sie von einer Einzelperson in Schulentwicklung als Fremdwort
Pensen umgerechnet werden. Die Zuweisung in In den untersuchten Schulen, die dem An-
eine EK oder KK geschieht somit oft aufgrund stieg der Aussonderungsquoten in EKs und KKs
fehlender Alternativen oder individueller Interes- trotz zunehmender Heterogenität der Schüler-
sen. In den meisten Gemeinden im Kanton Aar- schaft Einhalt gewähren konnten (die beiden
gau fehlt insbesondere die Möglichkeit der integrier- Gemeinden aus und neulich auch eine Ge-
ten Beschulung in tragfähigen Regelklassen mit heil- meinde aus , vgl. oben), sind ausnahmslos (auf
pädagogischer Unterstützung, obwohl wissen- Eigeninitiative und mit zusätzlichen Ressourcen)
schaftlich erwiesen ist, dass die integrative Schu- Schulentwicklungsprozesse in Gang gekommen:
lung für Kinder mit Lernschwierigkeiten v.a. be- stufenübergreifende und institutionalisierte Zu-
züglich der Leistungsentwicklung grosse Vorteile sammenarbeit, Einbezug der Eltern, Diskussion
aufweist (vgl. z.B. Bless 1995). über gemeinsame integrative Leitideen, Beizug
von Fachleuten etc. So weist auch die pädago-
Empfehlungen gische Literatur zum Wandel in Richtung sprach-
Da jeweilige sonderpädagogische Massnah- licher, kultureller und sozialer Heterogenisierung
men in der Regel genutzt werden, wenn sie vor- eindeutig nach, dass Schulentwicklung ein unab-
handen sind, ist von Seiten des Kantons zu defi- dingbarer Faktor für die traditionell auf Homoge-
nieren, welche sonderpädagogischen Massnah- nität ausgerichteten Schulen in einem sich verän-
men bezüglich des Bildungsauftrags der Schule dernden Umfeld ist (vgl. EDK 2001). Wird die
als förderlich erachtet werden. Dabei sollte der Herausforderung nicht angenommen – was in
Schwerpunkt auf integrativen Formen liegen, den meisten Schulen des Kantons Aargau der Fall
weil sie einerseits am leistungsförderlichsten wir- zu sein scheint – sondern im Klagen über das
ken, anderseits davor bewahren, dass durch die Umfeld verharrt, drohen die Schulen in Lethargie
zunehmende Delegation von Lernfragen nach zu verfallen und/oder Überforderungssymptome
aussen ein Kompetenzverlust der Regelklassen- zu zeigen und u.a. mit Aussonderung zu reagie-
(lehrkräfte) einher geht. Insgesamt muss seitens ren.
des Kantons ein übergreifendes sonderpädagogi-
sches Konzept erarbeitet werden, das Frühförde-
rung, schulische Massnahmen, Therapieange-
bote und ausserschulische Angebote koordiniert.
18 SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR HEILPÄDAGOGIK 1/2003Empfehlungen Es ist unbestritten, dass durch die zunehmen-
Um den kompetenten Umgang mit Hetero- de Multikulturalität und Heterogenität der Schü-
genität zu fördern – damit Abweichungen von lerschaft in einem auf Homogenität ausgerichte-
einer engen Norm nicht ausgesondert werden – ten Bildungssystem5 für alle Beteiligten ernst zu
müssen Schulentwicklungsprozesse in Gang ge- nehmende Probleme entstehen. Einzelnen Schu-
setzt, Kooperationen aufgebaut und die Ausein- len und Klassen sind jedoch durch die jeweilige sozi-
andersetzung mit Integration gefördert werden. ale Zusammensetzung der Schülerschaft unter-
Dazu sind Weiterbildung, Zeitgefässe und Bera- schiedlich belastet und es bestehen deshalb unter-
tung notwendig. schiedliche Ausgangs- und Arbeitsbedingungen.
So hat je nach Kontext die Belastung(swahrneh-
mung) der Lehrkräfte unterschiedlich stark zuge-
Unterschiedliche soziale Belastungen nommen. Zuweisungen in Kleinklassen haben
Die Aussonderung in EKs und – noch stärker somit oft auch eine Entlastungsfunktion für die
– in KKs ist im Kanton Aargau in hohem Masse Regelklassen.
abhängig vom Anteil fremdsprachiger Kinder in Sehr unterschiedlich sind auch die Bedingun-
den einzelnen Schulen. Je mehr fremdsprachige gen an den Kindergärten in den verschiedenen
Kinder integriert werden müssen, umso eher werden Gemeinden, nicht nur aufgrund der sozialen Be-
Kinder in EKs und KKs ausgesondert, im Kanton lastung, sondern auch aufgrund der lokalen Fi-
Aargau ausgeprägt häufig fremdsprachige Schü- nanzierung. Insbesondere in einem sozial hetero-
lerinnen und Schüler. Damit entfernt sich die genen Kontext erfüllen die Kindergärten jedoch
Schule Aargau nicht nur vom Volksschulgedan- ausgesprochen wichtige Funktionen, welchen
ken: Alle Kinder sind unabhängig ihrer Her- aufgrund der lokal sehr unterschiedlich vorhan-
kunft, ihres Geschlechts oder ihrer Religion glei- denen Ressourcen nicht überall erfüllt werden
chermassen zu fördern. Sie verpasst es gleichzei- können.
tig, ein beträchtliches Leistungspotential auszu-
schöpfen, das Fremdsprachige im Kontakt mit Empfehlungen
Deutschsprachigen besser entwickeln können. In Zukunft sind dringend ausgleichende
Massnahmen zu realisieren, die sich am Ausmass
der sozialen Belastung der Schulklassen orientie-
ren. Solange die Staatsbeiträge an die Finanzie-
SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR HEILPÄDAGOGIK 1/2003 19rung des Unterrichts über die Zahl der Schüler- Klasse!) zusätzlich in Schulzüge mit verschiedenen Anforde-
innen und Schüler in Regelklassen und Sonder- rungen.
klassen geregelt ist, bestehen an einem Teil der Literatur
Schulen durch die kontextuellen Bedingungen Bless, G.: Zur Wirksamkeit der Integration: Forschungs-
sehr grosszügige Bedingungen, während in ande- überblick, praktische Umsetzung einer integrativen
ren Schulen die Aufgaben stark belastend und Schulform, Untersuchungen zum Lernfortschritt.
Bern: Haupt, 1995
kaum mehr in einem befriedigenden Masse EDK (Hrsg.): Leistungsförderung und Bildungschancen.
bewältigbar sind. Es muss ein sozial indexiertes Qualitätssicherung in sprachlich, kulturell und sozial
Finanzierungsmodell entwickelt werden, das u.a. heterogenen Klassen und Schulen. EDK-Schriftenreihe
auch den Kindergärten ausreichend Ressourcen Studien+Berichte, Bern: EDK, 2001
Kronig, W.; Haeberlin, U.; Eckhart, M.: Immigrantenkinder
bereit stellt. und schulische Selektion: Pädagogische Visionen, theo-
Ein sozial indexiertes Finanzierungsmodell retische Erklärungen und empirische Untersuchungen
lässt den Schulgemeinden die Möglichkeit offen, zur Wirkung integrierender und separierender Schul-
wie sie die Sondermassnahmen organisieren wol- formen in den Grundschuljahren. Bern: Haupt, 2000
Vögeli-Mantovani, U.: Mehr fördern – weniger auslesen. Zur
len. Daher sollte es in Übereinstimmung mit ei-
Entwicklung der schulischen Beurteilung in der
nem sonderpädagogischen, integrativ ausgerich- Schweiz. Trendbericht Nr.3. Aarau: Schw eizerische
teten Konzept erfolgen und die lokale Schulent- Koordinationsstelle für Bildungsforschung, 1999
wicklung fördern (siehe oben).
Schlussempfehlung Autorin
Priska Sieber, Forschungsbereich
Die durch die Studie heraus gearbeiteten Schulqualität und Schulentwicklung
Problembereiche stehen nicht unabhängig von- (FS&S), Pädagogisches Institut,
einander. Bei der Umsetzung der Empfehlungen Universität Zürich,
und der Entwicklung entsprechender Massnah- Scheuchzerstrasse 21, 8006 Zürich;
E-Mail prsieber@paed.unizh.ch
men müssen deshalb die Wechselwirkungen zwi-
schen den einzelnen Bereichen berücksichtigt
werden.
Anmerkungen
1) Anzahl der Immigrantenkinder in den Sonderklassen
im Verhältnis zur Anzahl der Immigrantenkinder in den
Regelklassen der Primarschule (vgl. Kronig et al. 2000, S. 14
und S. 18)
2) Mit «hoch» sind Werte über dem kantonalen Durch-
schnitt gemeint, mit «tief» Werte darunter.
3) Bei geringer Befürchtung, das Kind könnte es in der
Regelklasse nicht ganz einfach haben, wir die Zuweisung in
eine EK vorgeschlagen.
4) Es gibt Lehrkräfte, die Abklärungen beim PSD zu mei-
den versuchen. «Wir hatten immer den Eindruck, dass er
[der PSD] dem Wunsch der Eltern folgt und zuwenig neutral
beurteilen kann, wo so ein Kind hinkommt. ... Das ist
dermassen aufwändig, dass ich sagen muss, da ist die Energie
falsch eingesetzt.» (Lehrkraft) «Seine Fachkompetenz ge-
nügt einfach nicht. ... Ich gehe nur dann auf ihn zu, wenn ich
es nicht umgehen kann.» (Lehrkraft)
5) Ein systembedingter Homogenisierungsdruck entsteht
durch die Einteilung der Schüler/innen in Jahrgangsklassen
und auf der Oberstufe (im Kanton Aargau bereits ab der 5.
20 SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR HEILPÄDAGOGIK 1/2003Sie können auch lesen