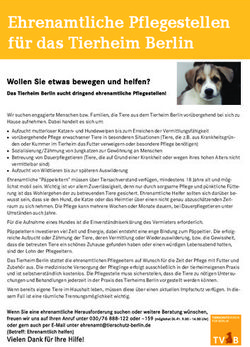Kängurus Seehunde Pinguine Mähnenspringer Schimpansen - Kl 8d: VVeerrhhaalltteennssbbeeoobbaacchhttuunnggeenn iimm ZZoooo NNeeuuwwiieedd
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Verhaltensbeobachtungen im Zoo Neuwied
Kl 8d:
Kängurus
Seehunde
Pinguine
Mähnenspringer
Schimpansen
03. Juni 2008
Kl.8 WHG Zoo 1Verhaltensbeobachtungen im Zoo Neuwied
Kl 8d:
15
Kängurus
21
Seehunde
22
Pinguine
25
Löwen
29
Schimpansen
Ablaufplan (Beobachtungszeitraum im Protokoll jeweils 15 Min)
09:30 10:30 11:30
Gruppe 1 Kängurus Seehunde Pinguine
Gruppe 2 Mähnenspringer Schimpansen Kängurus
Gruppe 3 Seehunde Pinguine Mähnenspringer
Gruppe 4 Schimpansen Kängurus Seehunde
Gruppe 5 Pinguine Mähnenspringer Schimpansen
Kl.8 WHG Zoo 2Methoden der Datenaufnahme
Zwei der in der Ethologie gebräuchlichsten Methoden:
a. Die Focusmethode:
Bei dieser Vorgehensweise wird ein Tier während der
ausgewählten Stichprobenzeit (15 Minuten lang)
ununterbrochen beobachtet, z. B. man notiert nun
entweder jedes Verhalten, welches das Tier zeigt
bzw. von anderen Tieren erfährt oder nur das
Auftreten ganz bestimmter, für die Arbeit bedeut-
samer Verhaltenskategorien. Nacheinander können
in täglich wechselnder Reihenfolge mehrere oder alle
Tiere der Gruppe unter Beobachtung gestellt werden.
b. Die Scanmethode
Bei der Scanmethode wird eine ganze Gruppe
während der Stichprobenzeit in regelmäßigen
Intervallen abgetastet und das Verhalten jedes
Individuums notiert. Als Intervalle empfehlen sich
Zeiten zwischen 15 Sekunden und 15 Minuten. Es
wird also zum Beispiel jeweils zur zweiten Minute
das Verhalten notiert, das die einzelnen Tiere
gerade eben zeigen. Am besten geht man die
Individuen der Reihe nach durch, links oder rechts
beginnend. Man sollte sich bei dieser Methode auf
einige wenige Verhaltenskategorien beschränken, das gestaltet die Durchführung etwas einfacher.
Zeitmessung
Die absolute Dauer einer Verhaltenskategorie wird mit einer Stoppuhr gemessen und zur Beobach-
tungsdauer in Beziehung gesetzt. Es werden Zeitintervalle von gleicher Dauer festgelegt. Wenn das
beobachtete Verhalten in einem Zeitintervall beobachtet wird, wird dieses markiert.
Kontaktaufnahme
Bei der Beobachtung der Löwen, Seehunde und Schimpansen
wollen wir versuchen, die Kontaktaufnahme mit der Fokusmethode
genauer zu untersuchen. In den Mittelpunkt unserer Beobach-
tungen stellen wir jeweils das größte männliche Tier, markieren mit
einer Strichliste, wie oft Kontakt zu den anderen Tieren
aufgenommen wird und stellen dies in einem Pfeildiagramm (s.
Abb.) dar.
Kontaktaufnahme Häufigkeit
1-2
1-3
1-4
1-5
Dauer der Beobachtung: 10 Min
Literatur:
• Info Flyer Zoo Neuwied 2008
• Zooführer Zoo Neuwied 2008
• Klaus, Ralf-Dietmar: Methoden der Verhaltensforschung, Zooschule Köln
• Verändert und ergänzt nach R. Stenke, P.K. Beyer: Beobachtungen und Untersuchungen im Tierpark, in Praxis der
Naturwissenschaften Biologie 3/41, 1992
• Chatfield, C.: Analysing Sequences of Behavioural Events. J. theor. Biol. 29, 1970, 427ff
• Faßnacht, G.: Systematische Verhaltensbeobachtung, UTB 889, München, Basel, 1979
• Gattermann, R.: Verhaltensbiologisches Praktikum. Jena 1990
• Krull, Hans-Peter: Beobachtungs- und Protokollmethoden für Verhaltensbeobachtungen, Zooschule Krefeld
Kl.8 WHG Zoo 3Das Graue Riesenkänguru (Macropus giganteus) ist eine Beuteltierart
aus der Familie der Kängurus (Macropodidae). Nach dem Roten
Riesenkänguru ist es der zweitgrößte Vertreter dieser Gruppe).
Das Graue Riesenkänguru lebt in einem kleinen Faimlienverband,
angeführt von einem starken Männchen, das die Gruppe durch
Boxen mit den Vorderbeinen und sprunghaftem Treten mit den
Hinterbeinen gegen Rivalen und Feinde verteidigt. Auf der Flucht
erreichen Großkaugurus eine Geschwindigkeit von bis zu 80 km/h
und können Hindernisse durch bis zu 13 m weite und bis zu 3 m
hohe Sprunge überwinden. Einmal an das Leben im Zoo gewöhnt,
machen diese scheuen Tiere aber nicht mehr von ihrer Sprungkraft
Gebrauch und lassen sich auch in großen Gehegen hinter relativ
niedrigen Zäunen gut halten. Der Zoo Neuwied verfügt über die zur
Zeit größte zusammenhangende Herde von Grauen Riesen-
kängurus außerhalb Australiens. Wie alle Beuteltiere haben auch
die Kängurus eine besondere Art der Fortpflanzung entwickelt
Nach einer Tragzeit von ca. 39 Tagen wird ein nur 2-3 cm langes,
nacktes Jungtier geboren Es kriecht aus eigener Kraft am Bauch-
fell der Mutter hoch bis in den Beutel Die Zitze, an der es zur Ruhe
kommt, schwillt in seinem Mund so stark an, dass es für einige Zeit
fest daran verbunden bleibt. Nach dieser Beuteltragezeit geht das
Jungtier im Beutel ein und aus, bevor es völlig selbständig wird.
Zeichne das Verbreitungsgebiet ein:
Kl.8 WHG Zoo 4Beobachte die Tiergruppe für 15 Minuten. Datum:03.06.2008; Uhrzeit:
Beobachtete Tiergruppe:
Anzahl der Tiere / Geschlecht:
Trage in die Tabelle jede Minute ein, wie viele Tiere die angegebenen Verhaltensweisen
ausführen. Ergänze, wenn nötig, in der Tabelle weitere Tätigkeiten. Interpretiere die Werte
und vergleiche sie mit den anderen Beobachtungsgruppen!
Zeit (Min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ruhen
Fortbewegung
Nahrungsaufnahme
Körperpflege
Kontaktaufnahme
Berührung
Summe
Weitere Fragen:
• Ist eine Rangordnung unter den Tieren feststellbar (ranghöchstes Tier ≡ α - Tier;
rangniedrigstes Tier ≡ Ω - Tier)
• Kennen sich die Tiere „persönlich“ (individualisierter Verband)?
• Kennen sich die Tiere „nicht persönlich“ (anonymer Verband)?
Foto der Tiergruppe:
Kl.8 WHG Zoo 5Das Graue Riesenkänguru (Macropus giganteus) Beobachtete Tiergruppe: 41 Tiere, nur zum Teil als Gruppe erkennbar Verbreitungsgebiet: Gehegeskizze: Kl.8 WHG Zoo 6
Beobachtungen / Auswertung
Ruhen Fortbewegung
10:45 -11:00 10:45 - 11:00
8
8
7
7
6 6
Anzahl der Tiere
Anzahl der Tiere
5 5
4 4
3 3
2 2
1
1
0
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Zeit [Min]
Zeit [Min]
Abb. 1 Abb. 2
Nahrungsaufnahme
10: 45 - 11:00
8
7
6
Anzahl der Tiere
5 Abb. 3
4
3
2
1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Zeit [Min]
Abb. 4
• Ruhe, Bewegungsanteile deutlich ausgeglichener als bei den anderen
untersuchten Tierarten (Abb. 1& 2)
• Nahrungsaufnahme erfolgt über den ganzen Zeitraum verteilt >Pflan-
zenfresser (Abb. 3).
• Kontaktaufnahme und Berührungen häufiger >Rudelverhalten (Abb. 4)
• Hoher Körperpflegeanteil (> warm, Landtiere, Parasiten)
Kl.8 WHG Zoo 7Der Seehund (Phoca vitulina) ist eine in allen nördlich-gemäßigten
Meeren verbreitete Robbe aus der Familie der
Hundsrobben. Seehunde leben fast ausschließlich im
Wasser an Meeresküsten und Flussmündungen mit
Sand- und Felsufern. Sie sind hervorragend an das
Wasserleben angepasst. Die Beine sind als
Schwimmflossen ausgebildet. Ohren, Augen und Na-
senöffnung befinden sich auf der Kopfoberseile. Dies
bedeutet, dass das Tier beim Schwimmen nur wenig
aus dem Wasser ragt und damit weniger Wasser-
widerstand erzeugt.
Seehunde jagen bei Flut und ruhen bei Ebbe. Sie
sind befähigt über 30 Minuten zu tauchen und kön-
nen dabei eine Tauchtiefe von bis zu 100 m errei-
chen. Seehunde sind vorwiegend Einzelgänger und
halten sich nur zur Paarungszeit in Herden an Land
auf. Nach einer Tragzeit von elf Monaten (inklusive
Keimruhe) wird im Mai - Juni ein Jungtier geboren,
das dank einer sehr nahrhaften Muttermilch bereits
nach wenigen Wochen selbständig ist. Das Seehundbecken im Zoo Neuwied - Fertigstellung 1995 -
entspricht den neuesten Erkenntnissen moderner Seehundhaltung.
Zeichne das Verbreitungsgebiet ein:
Kl.8 WHG Zoo 8Beobachte die Tiergruppe für 15 Minuten. Datum:03.06.2008; Uhrzeit:
Beobachtete Tiergruppe:
Anzahl der Tiere / Geschlecht:
Trage in die Tabelle jede Minute ein, wie viele Tiere die angegebenen Verhaltensweisen
ausführen. Ergänze, wenn nötig, in der Tabelle weitere Tätigkeiten. Interpretiere die Werte
und vergleiche sie mit den anderen Beobachtungsgruppen!
Zeit (Min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ruhen
Fortbewegung
Nahrungsaufnahme
Körperpflege
Kontaktaufnahme
Berührung
Summe
Weitere Fragen:
• Ist eine Rangordnung unter den Tieren feststellbar (ranghöchstes Tier ≡ α - Tier;
rangniedrigstes Tier ≡ Ω - Tier)
• Kennen sich die Tiere „persönlich“ (individualisierter Verband)?
• Kennen sich die Tiere „nicht persönlich“ (anonymer Verband)?
• Analyse Kontaktaufnahme: Beobachtungszeit 10 Minuten.
Kontaktaufnahme Häufigkeit
1-2
1-3
1-4
1-5
Foto der Tiergruppe:
Kl.8 WHG Zoo 9Der Seehund (Phoca vitulina) Zusammenfassendes Protokoll Anzahl der Tiere / Geschlecht: 4, schwer bestimmbar Verbreitungsgebiet Gehegeskizze: Kl.8 WHG Zoo 10
Beobachtungen / Auswertung
Abb. 1
Abb. 2
Abb. 3
• Hoher Bewegungsanteil in der Zeit bis 11:00h, danach vermehrt Ruhephasen (Mittag, Î
Temperatur) , gegen 10:00 Uhr erfolgte die Fütterung (Î Appetenzverhalten)
Abb.1&2, Zeiträume A und B
• Fressen und Verdauung erfolgt in Bewegung (Abb 1 & 2, Zeitraum B)
• Während der Ruhephasen erfolgt häufiger Kontaktaufnahme (Abb.3, Zeitraum C).
Kl.8 WHG Zoo 11Die Humboldt-Pinguine (Spheniscus humboldti) sind eine Art in
der Gattung der Brillenpinguine (Spheniscus). Sie gehören - wie
ihr Name bereits aussagt - zur Familie der Pinguine (Sphenis-
cidae) und wurden nach Alexander von Humboldt benannt, der
die Tiere als erster westlicher Beobachter beschrieb. Kleine
Kolonien dieses Pinguins gibt es an der Westküste Südamerikas,
wo sie in den kalten und fischreichen Regionen des Humboldt-
stromes leben.
Humboldtpinguine sind sehr gute Schwimmer. Sie jagen in
Tiefen zwischen 10 und 20 Metern nach Fischen, Tintenfischen
und Krebsen. Dabei können sie kurzfristig Geschwindigkeiten
von etwa 40 Kilometer pro Stunde erreichen. Humboldtpinguine
werden durchschnittlich 10 Jahre alt. Im Zoo, in dem sie nicht
eigenhändig jagen müssen und auch nicht von Haien oder
Schwertwalen gefressen werden, können diese Vogel auch bis
zu 20 Jahre alt werden. Pinguine gelten im Allgemeinen als sehr
„frosttaugliche" Vögel, deren Heimat die Antarktis ist. Humboldt-
pinguine findet man jedoch an der Westküste Südamerikas und
dort am häufigsten im Küstengebiet von Peru. Grund dafür ist der
kalte Humboldtstrom, der an Perus Küste entlang fließt. So
können Pinguine auch in den Tropen leben und ihre Küken
großziehen. Beim Bebrüten des Geleges, wie auch bei der
Aufzucht der Jungen, wechseln sich die beiden Altvögel ab. Die Jungen schlüpfen nach etwa 39
Tagen aus ihren Eiern und tragen anfänglich ein dickes, wolliges Federkleid, das später zu einem
wasserfesten Gefieder wird. Schon nach 3 Monaten können sich die Jungvögel alleine versorgen.
Ursprünglich nisteten die Humboldtpinguine in Guanohöhlen, durch deren Abbau müssen die
geselligen Tiere aber in Felsgrotten brüten und gehören zu einer bedrohten Tierart.
Zeichne das Verbreitungsgebiet ein:
Kl.8 WHG Zoo 12Beobachte die Tiergruppe für 15 Minuten. Datum:03.06.2008; Uhrzeit:
Beobachtete Tiergruppe:
Anzahl der Tiere / Geschlecht:
Trage in die Tabelle jede Minute ein, wie viele Tiere die angegebenen Verhaltensweisen
ausführen. Ergänze, wenn nötig, in der Tabelle weitere Tätigkeiten. Interpretiere die Werte
und vergleiche sie mit den anderen Beobachtungsgruppen!
Zeit (Min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ruhen
Fortbewegung
Nahrungsaufnahme
Körperpflege
Kontaktaufnahme
Berührung
Summe
Weitere Fragen:
• Ist eine Rangordnung unter den Tieren feststellbar (ranghöchstes Tier ≡ α - Tier;
rangniedrigstes Tier ≡ Ω - Tier)
• Kennen sich die Tiere „persönlich“ (individualisierter Verband)?
• Kennen sich die Tiere „nicht persönlich“ (anonymer Verband)?
Foto der Tiergruppe:
Kl.8 WHG Zoo 13Die Humboldt-Pinguine (Spheniscus humboldti) Zusammenfassendes Protokoll Anzahl der Tiere / Geschlecht: 16, Geschlecht schwer bestimmbar Gehegeskizze Verbreitung / Namensgebung Sie wurden nach Alexander von Humboldt benannt, der die Tiere als erster westlicher Beobachter beschrieb. Kleine Kolonien dieses Pinguins gibt es an der Westküste Südamerikas, wo sie in den kalten und fischreichen Regionen des Humboldtstromes leben. Kl.8 WHG Zoo 14
Beobachtungen / Auswertung Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3 Kl.8 WHG Zoo 15
Abb. 4
• Die Bewegung der Tiere erfolgt hauptsächlich im SCHWARM.
Der Schwarm verlässt das Wasser bzw. geht in das Wasser in fast
geschlossener Formation (Abb1 & Abb 2 Zeiträume A und B).
• Nach der Fütterung der Tiere kurz nach 10:00 Uhr setzt die Phase der
Ruhe und Körperpflege ein (Abb1 & Abb 2 & Abb 3 & Abb 4, Zeiträume B und C).
• Den Zeitraum, in dem die Verdauung der Tiere aktiv ist, verbringen sie
meist an Land (Abb1 & Abb2 , Zeitraum C ).
Kl.8 WHG Zoo 16Der
Mähnenspringer
(Ammotragus lervia),
auch als
Mähnenschaf,
Berberschaf oder Aoudad
bekannt, ist eine in der
Sahara beheimatete Art der
Ziegenartigen. Seine Ver-
breitung reicht von der West-
küste Marokkos bis zum Nil.
Gestaltlich steht der Mäh-
nenspringer zwischen Scha-
fen und Ziegen. Er hat im
Schnitt eine Kopfrumpflänge
von 150 cm, eine Schulter-
höhe von 1 m und ein Ge-
wicht von 50 kg (Weibchen)
bzw. 120 kg (Männchen). Das Fell ist beigebraun bis rötlichbraun gefärbt; am Vorderhals und an den
Vor-derbeinen wachsen beson-ders lange Haare, die beim Bock als Mähne bis auf den Boden reichen
können. Die kräftigen Hörner werden bei Böcken 85 cm lang und sind bei Weibchen nur etwas kürzer.
Der Lebensraum des Mähnenspringers sind felsige Wüstengebiete wie zum Beispiel das Ahaggar-
Massiv im Süden Algeriens. Hier suchen die Tiere nach der spärlichen Vegetation. Sie können
wochenlang ohne Wasser auskommen und leben dann nur vom Tau und von den pflanzeneigenen
Säften. Wenn sie allerdings Wasserstellen finden, trinken sie ausgiebig und baden sogar, wenn dies
möglich ist. Die Hitze ihres Lebensraums zwingt Mähnenspringer zu einem nachtaktiven Leben.
Mähnenspringer leben in kleinen Gruppen. Diese bestehen aus Weibchen mit ihren Jungen, die von
einem einzelnen Bock geführt werden. Dieser erkämpft sich das Recht zum Führen der Herde gegen
Konkurrenten, die sich zu einem Duell stellen müssen, bei denen die Tiere mit den Hörnern
aufeinander prallen. In der Sahara werden Mähnenspringer von jeher von den Einheimischen (z.B.
den Tuareg) gejagt, da sie wichtige Lieferanten von Fleisch, Fellen, Leder und Sehnen sind. Durch die
veränderten Jagdmethoden mit Schusswaffen sind die Bestandszahlen in den letzten Jahrzehnten
drastisch zurückgegangen, weshalb die Art von der IUCN als gefährdet geführt wird. Die ägyptische
Unterart Ammotragus lervia ornata gilt seit den 1970ern in der freien Wildbahn als ausgestorben,
allerdings gibt es noch eine Zuchtgruppe im Zoo von Gizeh. Der Name Ammotragus kommt aus dem
Griechischen und bedeutet wörtlich "Sandziege". Die Bezeichnung "Mähnenspringer" wurde von
Bernhard Grzimek eingeführt, der den zuvor gebräuchlichen Namen "Mähnenschaf" für unpassend
hielt; inzwischen hat sie sich im deutschsprachigen Bereich allgemein durchgesetzt, anders als
manche wieder verschwundene Benennungen wie "Mähnenziege" oder "Afrikanischer Tur". Der vor
allem im englischen Sprachraum gebräuchliche Name "Aoudad" kommt aus einer Berbersprache.
Kl.8 WHG Zoo 17Zeichne das Verbreitungsgebiet ein:
Beobachte die Tiergruppe für 15 Minuten. Datum:03.06.2008; Uhrzeit:
Beobachtete Tiergruppe:
Anzahl der Tiere / Geschlecht:
Trage in die Tabelle jede Minute ein, wie viele Tiere die angegebenen Verhaltensweisen
ausführen. Ergänze, wenn nötig, in der Tabelle weitere Tätigkeiten. Interpretiere die Werte
und vergleiche sie mit den anderen Beobachtungsgruppen!
Zeit (Min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ruhen
Fortbewegung
Nahrungsaufnahme
Körperpflege
Kontaktaufnahme
Berührung
Summe
Weitere Fragen:
• Ist eine Rangordnung unter den Tieren feststellbar (ranghöchstes Tier ≡ α - Tier;
rangniedrigstes Tier ≡ Ω - Tier)
• Kennen sich die Tiere „persönlich“ (individualisierter Verband)?
• Kennen sich die Tiere „nicht persönlich“ (anonymer Verband)?
• Analyse Kontaktaufnahme: Beobachtungszeit 10 Minuten.
Kontaktaufnahme Häufigkeit
1-2
1-3
1-4
1-5
Kl.8 WHG Zoo 18Der Mähnenspringer (Ammotragus lervia), auch als Mähnenschaf Beobachtete Tiergruppe: 15: ♂ 1, ♀ 10, Jungtiere 4 Verbreitungsgebiet: Kl.8 WHG Zoo 19
Beobachtungen / Auswertung Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3 Kl.8 WHG Zoo 20
Abb. 4
Abb. 5
• Bewegungsanteil in Zeitraum A am größten ( Abb. 1&2 )
• Nahrungsaufnahme erfolgt über den gesamten Beobachtungszeitraum
>Pflanzenfresser (Abb. 3)
• Körperpflegeanteil relativ gering
• Häufige Kontaktaufnahme, Anzahl der Tiere, die Kontakt aufnehmen bleibt
mehr oder weniger konstant > Jungtiere mit Bindungen zu den Muttertieren
(Abb. 5)
• ♂ Tier dominant, selten Kontakt mit Jungtieren
Kl.8 WHG Zoo 21Der Gemeine Schimpanse, auch Gewöhnlicher Schimpanse
oder einfach nur Schimpanse genannt (Pan troglodytes), ist
eine Primatenart aus der Familie der Menschenaffen (Homi-
nidae). Zusammen mit dem Bonobo (Zwergschimpansen)
bildet er die Gattung der Schimpansen (Pan). Er ist robuster
gebaut als der Bonobo und hat ein größeres Verbreitungs-
gebiet, das sich über weite Teile des mittleren Afrikas er-
streckt.
Fast alle Primären (Herrentiere) sind Bewohner der warmen
Klimazonen und meistens gute Kletterer. Die Systematik unter-
scheidet zwischen den Halbaffen und den echten Affen.
Letztere sind gekennzeichnet durch eine hohe Entwicklung des
Gehirns und einen gegenüberstellbaren Daumen. Die Finger
tragen, mit Ausnahme der Krallenaffen (z B Lisztäffchen),
plane Nägel. Die echten Affen werden nochmals in die aus
Afrika und Asien stammenden Altweltaffen, gekennzeichnet
durch eine schmale Nasenscheidewand, und die in Amerika
beheimateten Neuweltaffen mit einer breiten Nasenscheide-
wand unterteilt. Zu den Altweltaffen zählen auch die Men-
schenaffen und der Mensch. Der Mensch stammt allerdings nicht von den Affen ab, sondern hat
lediglich mit ihnen gemeinsame Vorfahren. Die menschenähnlichsten Affen sind die Schimpansen. Sie
verständigen sich durch Gestik, Mimik Körperhaltung und Lautgebung. Ihre Hände sind zu vollendeten
Greiforganen ausgebildet, z.B. zur Nahrungsaufnahme, zum Nestbau, zur sozialen Körperpflege oder
zum Halten von Werkzeugen (Steinen und Asten). Sie bewegen sich am Boden und im Geäst gleich
gut, übernachten aber in Schlafnestern in Bäumen; sie leben in lockeren Gemeinschaften ohne feste
Paarbildung. Jungtiere werden sehr lange gesäugt, so dass nur alle 3 bis 4 Jahre mit einer Geburt pro
Weibchen zu rechnen ist.
Zeichne das Verbreitungsgebiet ein:
Kl.8 WHG Zoo 22Beobachte die Tiergruppe für 15 Minuten. Datum:03.06.2008; Uhrzeit:
Beobachtete Tiergruppe:
Anzahl der Tiere / Geschlecht:
Trage in die Tabelle jede Minute ein, wie viele Tiere die angegebenen Verhaltensweisen
ausführen. Ergänze, wenn nötig, in der Tabelle weitere Tätigkeiten. Interpretiere die Werte
und vergleiche sie mit den anderen Beobachtungsgruppen!
Zeit (Min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ruhen
Fortbewegung
Nahrungsaufnahme
Körperpflege
Kontaktaufnahme
Berührung
Summe
Weitere Fragen:
• Ist eine Rangordnung unter den Tieren feststellbar (ranghöchstes Tier ≡ α - Tier;
rangniedrigstes Tier ≡ Ω - Tier)
• Kennen sich die Tiere „persönlich“ (individualisierter Verband)?
• Kennen sich die Tiere „nicht persönlich“ (anonymer Verband)?
• Analyse Kontaktaufnahme: Beobachtungszeit 10 Minuten.
Kontaktaufnahme Häufigkeit
1-2
1-3
1-4
1-5
Foto der Tiergruppe:
Kl.8 WHG Zoo 23Der Gemeine Schimpanse, auch Gewöhnlicher Schimpanse Beobachtete Tiergruppe: 4: ♂ 2, ♀ 2 Verbreitungsgebiet: Skizze des Geheges: Kl.8 WHG Zoo 24
Beobachtungen / Auswertung
Abb. 1
Abb. 2
Abb. 3
• Dominanz des ältesten Männchens
• Steht einzeln zum Schutz der Gruppe (wechselt öfter den Standort) (Abb. 2)
• Kein Kontakt zum Führungsmännchen (Abb. 3)
• Seltener Kontakt unter dem ♂ und ♀ heranwachsenden Tieren (Abb. 3)
Kl.8 WHG Zoo 25Sie können auch lesen