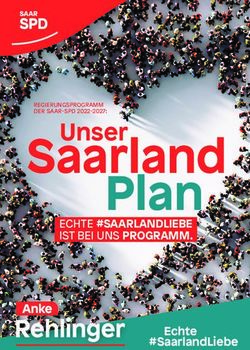Lernen & - Lernen & Lehren
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Schwerpunktthema
Technikerschulen – Fachschulen für Technik
lernen
&
lehren
Elektrotechnik • Informationstechnik
Metalltechnik • Fahrzeugtechnik
Didaktikansätze für Technikerschulen
Jörg-Peter Pahl/Friedhelm Schütte
Berechnungen an Profilen – ein Beispiel aus dem Fachschulunterricht
Roland Koch
Innovative Lernumgebung – Fertigungsautomation und handlungsorientiertes
Lernen in der Fachschule „Mechatronik“
Florian Beier/Thomas Kohlmeier HEFT 116 • 29. JAHRGANG • 4/2014 • 9,75 €
Praxisorientierter Unterricht für Maschinenbautechniker/-innen in der Fachschule
Thomas Schmitz
Effizienzwettbewerb für Fahrzeuge im Fokus von Projektarbeiten in
der Fachschule für Technik
Bernd Klein
Projektarbeit als Instrument des Lernens und der Weiterentwicklung von Schule
– Ein Beitrag aus einer Fachschule „Technik und Gestaltung“
Hartmut Maume/Klaus Prütz/Thomas Deckert/Birgit Ramm/Maik Jepsen
H 65063 HECKNERBerufsbildung als
Aufklärung
Traditionen der aufklärenden
Pädagogik bewahren
Gottfried Adolph erinnert Lehrer und Ausbilder tech-
nischer Berufe mit seinen Kommentaren und Essays
– regelmäßig erschienen in der Zeitschrift „lernen Gottfried Adolph
und lehren“ – daran, die Traditionen der aufklärenden Berufsbildung als Aufklärung
Pädagogik zu bewahren. Kommentare und Essays
Berufsbildung, Arbeit und
Der Autor schlägt eine Brücke zwischen der fachlichen Innovation, Band 5
Diskussion und der aufklärerischen Berufspädagogik 2011, 312 S., 19,90 € (D)
ISBN 978-3-7639-4879-6
und regt zum Nachdenken und Reflektieren an. Best.-Nr. 6004189
Diese neue, aktualisierte Ausgabe wurde um 30 Essays
und Kommentare von 2002 bis 2009 erweitert.
wbv.de
W. Bertelsmann Verlag
service@wbv.de | wbv.de | wbv-journals.de | wbv-open-access.deInhalt
SCHWERPUNKT:
TECHNIKERSCHULEN – FACHSCHULEN FÜR TECHNIK
134 Editorial: Technikerschulen im Wandel
Michael Tärre
Schwerpunkt
136 Didaktikansätze für Technikerschulen
Jörg-Peter Pahl/Friedhelm Schütte
Praxisbeiträge
142 Berechnungen an Profilen – ein Beispiel aus dem Fachschulunterricht
Roland Koch
146 Innovative Lernumgebung – Fertigungsautomation und handlungsorientiertes Lernen
in der Fachschule „Mechatronik“
Florian Beier/Thomas Kohlmeier
153 Praxisorientierter Unterricht für Maschinenbautechniker/-innen in der Fachschule
– dargestellt an einem Beispiel aus der Technischen Mechanik
Thomas Schmitz
159 Effizienzwettbewerb für Fahrzeuge im Fokus von Projektarbeiten in der Fachschule für Technik
Bernd Klein
163 Projektarbeit als Instrument des Lernens und der Weiterentwicklung von Schule
– Ein Beitrag aus einer Fachschule „Technik und Gestaltung“
Hartmut Maume/Klaus Prütz/Thomas Deckert/Birgit Ramm/Maik Jepsen
Forum
170 „Lernfeldgespräche“ – Erfahrungsaustausch der Praktiker/-innen an berufsbildenden Schulen
(Teil 2)
Eckehard Heydt/Uta Kuhbach/Andreas Lindner/Peter Stengel
172 Europaweite Durchlässigkeit in der Berufsbildung – ECVET und dessen Umsetzung in der Praxis
am Beispiel des Leonardo-Innovationstransferprojekts „TRIFT“
Folene Nannen-Gethmann
Ständige Rubriken
I–IV BAG aktuell 04/2014
II Einladung zur Mitgliederversammlung 2015 der BAG Elektro-, Informations-, Metall- und
Fahrzeugtechnik e.V.
176 Verzeichnis der Autorinnen und Autoren
U3 Impressum
& LEHREN | ELEKTROTECHNIK • INFORMATIONSTECHNIK • METALLTECHNIK • FAHRZEUGTECHNIK
LERNEN
ISSN 0940-7340 | HEFT 116| 29. JAHRGANG | 4/2014EDITORIAL
Editorial: Technikerschulen im Wandel
mittleren Managements in Handwerk und Industrie
bei.
Der zunehmende Trend zur Wissensgesellschaft mit
ständigen Veränderungen im Beschäftigungs- und
Gesellschaftssystem sowie die damit verbundenen
Herausforderungen an Flexibilität und Mobilität
der Berufstätigen zeigen, dass die Fachschulen als
Weiterbildungsinstitutionen gegenwärtig stärker als
bisher gefordert sind, auf die verschiedenen Anfor-
MICHAEL TÄRRE derungen des Beschäftigungs- und Gesellschaftssys-
tems flexibel zu reagieren. Schon heute sind nach-
frageorientierte Weiterbildungsangebote mit ihren
Technikerschulen sind seit ihrer Entstehung eng mit besonderen Details, also den sehr differenzierten
der technischen Entwicklung verbunden. Mit dem und eng angelegten Aufgabenstellungen, häufig nur
Aufkommen der Industrie und der industriellen von temporärer Aktualität. Die Ziele und Inhalte der
Revolution erfuhr das technische Bildungswesen Technikerschulen sind durch die ständigen, nicht nur
erhebliche Veränderungen. Berufliche Weiterbildun- technischen, Veränderungen bei zunehmender Kom-
gen wurden zunehmend erforderlich. In Deutschland plexität und Kompliziertheit, insbesondere bei den
waren Entstehung und institutioneller Ausbau durch innovativen Berufen, ständig zu reflektieren, zu ak-
die Reform gymnasialer und technischer Bildungs- tualisieren und zu realisieren.
gänge in den 1890er Jahren in Preußen bestimmt.
Der mit einer solchen qualitativ hochwertigen beruf-
Dabei erfolgte im Rahmen der Reform auch eine ein-
lichen Weiterbildung vergebene Abschluss „Staatlich
deutigere Abgrenzung der technischen Schulen in
geprüfter Techniker/Staatlich geprüfte Technikerin
eine „niedere“ und eine „höhere“ Form. Eine Unter-
in der Fachrichtung ...“ wird den anspruchsvollen In-
scheidung in „niedere“ oder „höhere“ Fachschulen
halten nicht mehr gerecht, da er sich darüber hinaus
wurde bei den kaufmännischen Fachschulen nicht
auch sprachlich kaum von den Abschlüssen der Be-
getroffen. Bei den technischen Schulen wurde dage-
rufsfachschulen abhebt.
gen die stärkere „Entwissenschaftlichung“ der „nie-
deren“ Fachschule gefordert und auch durchgesetzt. Wie aber könnten Zukunftsperspektiven für eine
Es ging um die Weiterbildung von und zu Berufsprak- innovative und flexible berufliche Weiterbildung
tikern, die in den hierarchisierten Arbeitsprozessen an der Fachschule zukünftig aussehen? Bei den
eingesetzt werden konnten. verschiedenartigen Prognosen zur künftigen Leis-
tungsfähigkeit der Technikerschule, wie sie heute
Diese Differenzierung erfuhr mit dem Preußischen
bei Diskussionen formuliert werden, wird allgemein
Ministerialerlaß vom 8. April 1916 eine verbindliche
anerkannt, dass die berufliche Erwachsenen- und
Regelung. Die damaligen niederen und höheren Ma-
Weiterbildung in der Folge wissenschaftlicher und
schinenbauschulen (Fachschulen) waren einerseits
gesellschaftlicher Entwicklungen den Anforderungen
durch die Ansprüche der Industrie und gesellschaft-
beruflicher Praxis sowie der Wissensgesellschaft in
liche Selektionen bestimmt. Andererseits erlangten
Zukunft schneller und besser gerecht werden muss.
sie aber auch immer größere Anerkennung. Nach
Damit werden zugleich hohe Qualifikationsanforde-
mehr als vier Jahrzehnten wurden die „höheren“
rungen erkennbar.
Fachschulen zu Fachhochschulen und etwas später
die „niederen“ zu Fachschulen für Technik bzw. zu Von den gesellschaftlichen Mächten sind deshalb
Technikerschulen umgewandelt. Zusammenfassend schon vor einigen Jahren rahmengebende Impul-
lässt sich bezogen auf die zeitliche Entwicklung fest- se eingebracht worden. Im Mai 2007 hat die Wirt-
halten, dass sich die Technikerschulen als wichtige schafsministerkonferenz in einem Beschluss festge-
nicht-akademische Weiterbildungseinrichtung etab- stellt, dass „eine Reihe hochwertiger, im Wege der
lierten. Sie trugen mit ihrem praxisorientierten Kon- beruflichen Bildung erworbener Qualifikationen mit
zept wesentlich zur Qualifizierung des unteren und akademisch erworbenen Qualifikationen gleichwer-
134 lernen & lehren | 4/2014 | 116EDITORIAL
tig sind“. Daher sei es gerechtfertigt, Abschlussbe- Betrachtet man das Anforderungsprofil der Ni-
zeichnungen einzuführen, die diese Gleichwertigkeit veaustufe 6 des Deutschen Qualifikationsrahmens
auch dokumentieren bzw. zertifizieren. Als Beispie- (DQR) genauer, so wird unmittelbar deutlich, dass
le wurde auf den „Bachelor Professional“ und den Technikerschulen auf dieses Qualifikationsniveau
„Master Professional“ verwiesen. Die Forderung ausgerichtet sind: „Über Kompetenzen zur Planung,
entspricht der Position der Kammerorganisationen,
Bearbeitung und Auswertung von umfassenden fach-
die in den Bezeichnungen einen wichtigen Beitrag
lichen Aufgaben- und Problemstellungen sowie zur
für die Aufwertung der beruflichen Bildung sehen.
eigenverantwortlichen Steuerung von Prozessen in
Erwartungsgemäß und umgehend protestierte der
Teilbereichen eines wissenschaftlichen Faches oder
Senat der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), der
die Abschlussbezeichnungen als akademische Ab- in einem beruflichen Tätigkeitsfeld verfügen. Die An-
schlüsse geschützt wissen will. Auch der Deutsche forderungsstruktur ist durch Komplexität und häufige
Gewerkschaftsbund (DGB) und die Bundesverei- Veränderungen gekennzeichnet.“ (BMBF 2013, DQR-
nigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) Handbuch). Das ist aber auch die Niveaustufe für
nahmen gegenüber dem Vorstoß eine reservierte bis den Bachelor-Abschluss. Damit wird über den DQR
ablehnende Haltung ein. bereits attestiert, dass über berufliche Bildungswege
Die Wirtschaftsministerkonferenz hat des Weiteren Kompetenzniveaus erreicht werden, die bisher – bei
am 7./8. Juni 2006 in Erfurt zur Aufwertung der be- formaler Betrachtung – dem Wissenschaftsbereich
ruflichen Bildung beschlossen, dass der Arbeitskreis vorbehalten waren. Die Technikerschule hat sich
„Berufliche Bildung“ beauftragt wird, einen Vor- nicht nur dadurch – sondern schon seit langem – von
schlag zur internationalen Verständigung über die
der Einordnung als „niedere“ Schule gelöst.
deutschen Abschlüsse in der nicht-akademischen
beruflichen Weiterbildung zu erarbeiten. Der Auftrag Berücksichtigt man die bildungspolitischen Ent-
zu einer Tischvorlage wird von der Wirtschaftsminis- scheidungen und Vorgaben des DQR, die Entwick-
terkonferenz damit begründet, dass die „deutschen lungen im Beschäftigungssystem und den Trend zur
Absolventen (...) zunehmend mit Absolventen über-
Wissensgesellschaft sowie die damit verbundene
wiegend semi-akademisch oder akademisch aus-
gerichteter Bildungssysteme anderer Staaten, die Vielzahl spezifischer, langfristig zu leistender Aufga-
häufig mit den dort vielfach leichter erreichbaren ben, so wird der organisatorische und institutionelle
Bachelor-Abschlüssen ausgestattet sind“ (Beschluss- Ausbau der Technikerschule immer zwingender. Eine
Sammlung der Wirtschaftsministerkonferenz 2006, Reformierung bzw. Anpassung des Weiterbildungs-
Punkt 3.2 der Tagesordnung), konkurrieren. „Da- bereichs ist vor allem deshalb notwendig, weil für
durch entsteht eine potenzielle Beeinträchtigung die Zukunft entscheidend sein wird, mit welchem
ihrer Wettbewerbschancen. Hinzu kommt, dass die
Wissen Studierende der Technikerschulen sich auf
gegenwärtigen Bezeichnungen der deutschen Wei-
terbildungsabschlüsse international kaum bekannt einen Beruf vorbereiten, der ihnen, wenn es notwen-
bzw. nicht lesbar sind; die internationale Fachkräfte- dig ist, die Möglichkeit eröffnet, im angestammten
mobilität wird gehemmt.“ (ebd.) Berufsfeld oder perspektivisch in andere Felder oder
Zu den anspruchsvollen Weiterbildungsabschlüssen, Branchen im europäischen Raum zu wechseln.
insbesondere in den Hochtechnologiebereichen, Es ist sinnvoll, dass die Lehrkräfte und ihre Organi-
die im Niveau den Vergleich mit Bachelor- oder so- sationen weitere Anstöße zur Entwicklung der Tech-
gar Masterabschlüssen an Berufsakademien und nikerschulen geben. Sie stehen am besten in der
Fachhochschulen nicht scheuen müssen, zählen die
Diskussion über den sozio-technischen Wandel der
Technikerschulen. Allerdings beruht die Annahme
Technikerberufe der zugehörigen Berufsfelder. Für
der Gleichwertigkeit weitgehend auf Einschätzungen
die Lehrenden an der Technikerschule stellt sich be-
bzw. dem Vergleich von curricularen Vorgaben. Be-
lastbare Daten aufgrund von Vergleichsstudien lie- reits heute und insbesondere zukünftig die Aufgabe,
gen dazu bislang kaum vor. Diese wären aber auch dass Perspektiven für die Schulentwicklung auch an
notwendig, um besser einordnen zu können, wie die der beruflichen Weiterbildungseinrichtung disku-
verschiedenen Weiterbildungsabschlüsse im Hin- tiert werden sollten. Neue Anforderungen durch den
blick auf das Niveau akademischer Abschlüsse ein- Wandel der Arbeitswelt stellen dabei eine besondere
zustufen sind. Herausforderung dar.
lernen & lehren | 4/2014 | 116 135SCHWERPUNKTTHEMA „TECHNIKERSCHULEN – FACHSCHULEN FÜR TECHNIK“
Didaktikansätze für Technikerschulen1
Praxis- und Theorieentwicklung der Didaktikansätze
der Technikerschulen basieren auf Grundlegungen,
die als Reaktion auf den sozio-technischen Wandel
schon zum Ende des neunzehnten Jahrhunderts aus-
gelöst wurden. Die in der Folgezeit bis hin zur Gegen-
wart erfolgten Veränderungen sind von den Akteuren
schulischer Berufsbildung begrüßt worden, weil sich JÖRG-PETER PAHL FRIEDHELM SCHÜTTE
damit eine Institution etabliert hat, die berufliche
Weiterbildung in der Schule ermöglichte. Aber dennoch muss gegenwärtig und zukünftig weiterhin an
einem in sich geschlossenen curricularen und didaktischen Theorieansatz gearbeitet werden, um die
Vermittlungspraxis an den Fachschulen für Technik besser zu fundieren.
TECHNIKERSCHULEN ALS GEGENSTAND ner weitergehenden beruflichen Qualifikation mit
DIDAKTISCHER REFLEXION staatlicher Abschlussprüfung führt. Eintrittsvoraus-
setzung sind eine einschlägige Berufsausbildung
Wie alle anderen Fachschulen sind die vor mehr als
und Berufsausübung im Technikbereich. Die Diffe-
einhundert Jahren aus den niederen Maschinenbau-
renzierung der Fachschulen für Technik umfasst eine
schulen („Werkmeisterschulen“) hervorgegangenen
Vielzahl von Fachrichtungen. Dabei ist eine nicht
Technikerschulen Institutionen der beruflichen Er-
einheitlich verwendete Begrifflichkeit festzustellen.
wachsenen- und Weiterbildung. Auffallend ist: Diese
Innerhalb Deutschlands differieren die Bezeichnun-
Ausbildungseinrichtung wird von der Gesellschaft in
gen. So gibt es beispielsweise in Bayern neben den
ihrer Bedeutung nicht angemessen wahrgenommen.
Das vielfältige Bildungsangebot ist für die interes- Fachschulen für Technik so genannte Fachakademi-
sierte Öffentlichkeit kaum überschaubar. en, deren Besuch einen gehobenen Schulabschluss
voraussetzt. Auch sind die Adressaten einiger Län-
Anders ist es bei Berufstätigen, die bereits eine derpläne Schüler/-innen und andernorts hingegen
gewerblich-technische berufliche Erstausbildung Studierende. Die Technikerschule ist in allen sech-
absolviert haben und einige Jahre im Beschäfti- zehn Bundesländern präsent (ZÖLLER 2013; PAHL
gungssystem tätig sind. Sie interessieren sich für 2010, S. 126 ff.).
die Technikerschule mit ihren Weiterbildungsmög-
lichkeiten, weil wegen der damit erreichbaren Qua- Seit ihrer Gründung in den 1890er Jahren hat sie sich
lifikation das berufliche Fortkommen und die Fach- institutionell verselbstständigt, ist durch Gesetze
lichkeit gesichert werden können. Meist schon in und Rechtsverordnungen funktional organisiert und
der Endphase der beruflichen Erstausbildung, kurze hat eine eigene Curriculumstruktur entwickelt. Tech-
Zeit nach dem Abschluss der Ausbildung oder eini- nikerschulen sind eine spezifische Form der berufli-
ge Jahre später ventilieren sie, welche Angebote des chen Erwachsenen- und Weiterbildung (KREBS 1992).
unübersichtlichen Weiterbildungsmarktes für sie von Curricular stellen sie sich den technologischen Her-
Interesse sein könnten und welche Qualifikation den ausforderungen (SCHÜTTE 1996), sozial befördern sie
beruflichen Status dauerhaft befördert. den individuellen Aufstieg, beruflich garantieren sie
Mobilität.
Die Fachschule wird als eine Einrichtung der beruf-
lichen Aus- und Weiterbildung wahrgenommen, die Sind die Technikerschulen noch zeitgemäß – ist ihr
über die i. d. R. zweijährigen Bildungsgänge zu ei- didaktischer Ansatz noch zukunftsfest?
136 lernen & lehren | 4/2014 | 116SCHWERPUNKTTHEMA „TECHNIKERSCHULEN – FACHSCHULEN FÜR TECHNIK“
ARBEITS- UND TECHNIKDIDAKTIK ALS EIN Für das in den aktuellen Plänen geforderte Unter-
KERNSTÜCK DER TECHNIKERSCHULE richtskonzept wird somit das Ziel einer umfassenden
beruflichen Handlungskompetenz formuliert. Hier-
Makrodidaktische Grundlegungen bei ist zu unterscheiden zwischen Lernen und Stu-
In der Technikerschule sollen die Kenntnisse, Fä- dieren für Handeln einerseits sowie Lernen und Stu-
higkeiten und Fertigkeiten erlernt werden, die zur dieren durch Handeln andererseits. Dadurch, dass
Ausübung eines gehobenen Berufes im unteren und das Konzept der Handlungsorientierung mit einer
mittleren Management erforderlich sind. Der makro- Berücksichtigung von Arbeits- und Geschäftsprozes-
didaktische Rahmen erwächst aus den curricularen sen in vielen Curricula verankert ist und außerdem
Ansprüchen an den Bildungsgang sowie der Forde- über das Prinzip der Wissenschaftsorientierung auch
rung nach selbstständigem Arbeiten und Lernen der Wissensziele angestrebt werden, ergeben sich Vor-
Studierenden. teile für die spätere betriebliche Tätigkeit.
Für einen didaktischen Ansatz der Technikerschule Didaktikansätze der Erwachsenen- und Weiterbil-
bilden der angestrebte Technikerberuf mit dem dafür dung in ihrer Bedeutung für die Technikerschule
benötigten Arbeits- und Technikwissen sowie die In-
Schon seit längerem zeigt sich in der Erwachsenen-
teressen der Studierenden die zentralen curricularen
und Weiterbildung, dass neuere didaktische Modelle
und didaktischen Bezugspunkte. Für die einzelnen
immer schneller entstehen, wobei zugleich die Ler-
Bildungsgänge sind – soweit möglich – spezifische
nenden bzw. Studierenden stärker in den Mittelpunkt
didaktische Ansätze zu entwickeln. Didaktisch be-
gerückt werden. Dabei sollen Aspekte wie eine stär-
deutsam ist, dass sie die beruflichen und lebenswelt-
kere Orientierung an den Interessen und Lernvoraus-
lichen Erfahrungen der Erwachsenen
setzungen aufgegriffen werden.
berücksichtigen.
Erwachsene lassen sich Daraus folgt: Erwachsene lernen
Auf die berufsfachlichen Arbeits- und nicht gern belehren an Technikerschulen aus ande-
Geschäftsprozesse wirkt eine Rei- ren Gründen, Motiven und mit
he von Momenten, die von den gesellschaftlichen anderem Engagement als Jugendliche an Berufsschu-
Bedingungen über den Absatzmarkt bis hin zu ge- len und Berufsfachschulen. Sie fordern sinnvolle und
setzlichen Bestimmungen reichen. Aus diesen Ar- umsetzbare Inhalte, positive Herausforderungen, Le-
beitsabläufen sind berufliche Handlungsfelder her- bens- und Berufsnähe, Bezug zu ihrer Lebenserfah-
auszukristallisieren, die didaktisch und methodisch rung und Lern-, Studien- und Arbeitsumgebungen,
zu handlungsorientierten Lernsituationen aufberei- in denen sie sich wohlfühlen. Für die erwachsenen
tet werden müssen. In der Auseinandersetzung mit Studierenden an der Technikerschule ist das Lernen
den Lernsituationen können die Studierenden der ein selbstgesteuerter, biographisch beeinflusster
Technikerschulen dann berufliche Handlungskom- Prozess. Lernen und Studieren werden also nicht
petenz erwerben. Bei der Auswahl berufstypischer lediglich als eine Reaktion auf Lehre verstanden.
arbeits- und technikbezogener Lern- und Studienin- Erwachsene lassen sich in der Regel nicht gerne be-
halte sollte neben dem Kriterium der Relevanz des lehren oder aufklären. Um unter dieser Prämisse als
jeweiligen Lerninhalts zugleich das berufsfachliche Lehrkraft an der Technikerschule den Studierenden
Handeln betrachtet werden. gerecht zu werden, braucht es grundlegendes didak-
Die Lern- bzw. Studienziele müssen also neben der tisches und methodisches Wissen darüber, wie Er-
Theorievermittlung ebenso auf die Ebene der prakti- wachsene sich Wissen erschließen und Kompetenzen
schen Fertigkeiten für die zukünftige Tätigkeit gerich- aneignen können.
tet sein, sodass die Absolventinnen und Absolventen Curricular und inhaltlich kann unter Berücksichti-
nach dem Studium an der Technikerschule möglichst gung von Selbstorganisation sowie Erfahrungen der
problemlos zurück in das Beschäftigungssystem beruflichen Erwachsenen- und Weiterbildung für die
gelangen, um dort Führungsaufgaben im mittleren Technikerschulen konzeptionell Neues entstehen.
Management zu übernehmen. Deshalb wird in den
Arbeit, Technik und Bildung als didaktische Referenz-
neueren Landeslehrplänen der Fachschulen für Tech-
bereiche
nik handlungs- und berufsorientiertes Lernen und
Studieren ausdrücklich gefordert und in Projekten Für eine berufliche Erwachsenen- und Weiterbil-
praktiziert (siehe dazu die Beiträge in diesem Heft). dungsstätte wie die Technikerschule sollten didak-
lernen & lehren | 4/2014 | 116 137SCHWERPUNKTTHEMA „TECHNIKERSCHULEN – FACHSCHULEN FÜR TECHNIK“
tische Ansätze für Fächer, Module oder Lerngebiete Insgesamt sollen dadurch die Berufsarbeit und de-
darauf gerichtet sein, eine optimale Verknüpfung der ren Gestaltungsmöglichkeiten (RAUNER 1995) besser
Ansprüche der Studierenden, der gesellschaftlichen berücksichtigt werden. Damit lassen sich neben dem
Interessen und der Anforderungen des Beschäfti- erforderlichen Fachwissen über den Umgang mit
gungssystems auf die zu leistende Arbeit und die Be- beruflichen Gegenständen auch Arbeits-, Arbeits-
herrschung des Sachgebietes „Technik“ anzustreben. prozess- und Erfahrungswissen entwickeln bzw.
Durch das Bezugswissenschaftsproblem und didak- weiterentwickeln. Darüber hinaus geht es für se-
tische Diskussionen der letzten zwei Jahrzehnte ist miakademische Berufe darum, die Arbeit nicht nur
deutlich geworden, dass die Sachgebiete bzw. Sach- selbstständig planen und durchführen, sondern auch
systeme zusammen mit der zugehörigen Arbeit unter organisieren, kontrollieren, bewerten und gestalten
dem Berufsbildungsaspekt betrachtet werden müs- zu können. Um solche umfassenden Lern- und Stu-
sen (Abb. 1). Damit werden auch die Arbeits- oder dienziele verwirklichen zu können, sind die hierfür
Geschäftsprozesse unter dem Bildungsaspekt in ih- notwendigen didaktischen Ausgangsbedingungen zu
rer Komplexität und Mehrdimensionalität erfasst und verbessern. Es müssen zum Teil andere bzw. zusätz-
in die zu generierenden Konzepte integriert. In dem liche wissenschaftliche Bezüge hergestellt werden,
Relevanzbereich von Arbeit, Sachgebiet „Technik“ um damit das Bezugwissenschaftsproblem zu min-
und Bildung sind die didaktischen Entscheidungen dern.2
zu treffen.
An den Technikerschulen zeichnen sich gute Mög-
lichkeiten zur Anwendung eines sowohl an der Arbeit
als auch am Sachgebiet orientierten didaktischen
Ansatzes ab. Dabei können und sollten die Ergeb-
nisse schon vorhandener Ansätze und Konzeptionen
berücksichtigt werden, indem sie systemisch in das
neu entstehende Gesamtkonzept eingefügt werden.
Mit diesem Angang werden die ausschließliche Aus-
richtung auf das Fach bzw. einzelne fachlich isolierte
Sachbereiche „der Technik“ aufgebrochen sowie die
mit dem Tätigkeitsgebiet verbundene Arbeit mit de-
ren Arbeits- und Geschäftsprozessen und die damit
Abb. 1: Arbeit, Bildung und Sachgebiet „Technik“ im im Zusammenhang stehenden relevanten Bildungs-
didaktischen Zusammenhang
aspekte berücksichtigt.
In dem beruflich orientierten Didaktikkonzept der
Beim Konzept einer arbeits- und technikorientierten Technikerschule stehen die arbeits- und technikspe-
Didaktik für die Technikerausbildung werden nicht zifischen Intentionen und Lern- und Studienziele,
nur eine Fachwissenschaft als didaktisch vereinfach- die zugehörigen Lern- und Studieninhalte, Methoden
tes Sachgebiet eines Technikbereiches thematisiert, und Medien in einem wechselseitigen Zusammen-
sondern auch berufswissenschaftlich begründete hang. Arbeits- und technikspezifische Intentionen,
Ansätze zur Erfassung von beruflichen Tätigkeitsdo- Ziele und Inhalte stellen dabei die Entscheidungsfel-
mänen herangezogen. der für diesen Ansatz beruflichen Lernens und Stu-
Arbeit, Technik und Handlungsorientierung dierens im engeren Sinne dar. Arbeits- und technik-
spezifische Methoden- und Medienkonzepte können
Führungskräfte des unteren und mittleren Manage-
als Teil der „Methodik“ angesehen werden. Damit
ments müssen über ein breites Spektrum beruflicher
zeigt sich ein Gesamtkonzept, das für die Planung
Fähigkeiten verfügen. Deshalb ist für die zu entwi-
beruflicher Erwachsenen- und Weiterbildung an den
ckelnden Kompetenzen der beruflichen Handlungs-
Technikerschulen wesentliche Bedingungs- und Ent-
fähigkeit der Bezug zur Arbeit und zum Sachgebiet
scheidungsfelder benennt.
„Technik“ unhintergehbar. Mit dem Konzept der
Handlungsorientierung können der Technikbereich Die beruflichen und lebensweltlichen Erfahrungen
sowie die damit verbundene Arbeit und über das der Studierenden sind – vor allem, wenn sie diese
eng Fachliche hinausgehende allgemeinbildende As- in den Lern- und Studienprozess einbringen wollen –
pekte in einem ausgewogenen Verhältnis betrachtet mit einer Bedingungsanalyse zu erfassen, denn wer-
werden. den weiterreichende und übergeordnete Intentionen
138 lernen & lehren | 4/2014 | 116SCHWERPUNKTTHEMA „TECHNIKERSCHULEN – FACHSCHULEN FÜR TECHNIK“
und Ziele unterdrückt, so kann das zu grundlegenden Durch den auf die Technik und die zugehörige Ar-
Auswirkungen bei den Lern- und Studieninhalten beit orientierten didaktischen Ansatz beruflichen
führen sowie durch die damit einhergehende Re- Lernens und Studierens können aber auch Themen
duktion in der Folge Probleme mit der erwachsenen des Beschäftigungs- und des Gesellschaftssystems
Klientel erzeugen. Wenn bei den didaktischen Über- behandelt werden, die nicht unmittelbar an einen
legungen allein schon durch Bezeichnungen der Fä- Beruf sowie eine Fachrichtung gebunden sind.
cher, Module oder der Lernfelder ein Technikbereich Außerdem sind in die didaktischen Entscheidungen
im Vordergrund steht, sollte darüber hinaus versucht die exemplarischen und berufsrelevanten Techniken,
werden, nicht nur das Sachgebiet oder Sachsysteme Arbeits- und Geschäftsprozesse, der Motivations-,
und die damit verbundene Arbeit zu behandeln, son- Aktivierungs- und Bildungsgehalt des Lern- bzw.
dern auch die Veränderungen im Beschäftigungssys- Studieninhalts in Hinblick auf Denken, Wahrnehmen
tem zu thematisieren und dabei weitere Gestaltungs- und Handeln sowie die wesentlichen Arbeitsmetho-
möglichkeiten für das Sachgebiet und die zugehörige den und -verfahren einzubeziehen. Unter einer sol-
Arbeit insbesondere in Führungspositionen, wie sie chen erweiterten Perspektive sind zugleich
die Absolventen der Fachschule die Themen mit ihren Verknüpfungsmög-
anstreben, aufzuzeigen. Auf die- Veränderungen der lichkeiten mit weiteren Inhalten – ganz im
se Weise erlangt das Verhältnis zu Arbeit thematisieren Sinne des Lernfeldkonzepts – zu untersu-
Arbeit und Technik, zu den Arbeits- chen, sodass sie vielschichtiger, ganzheitlicher und
und Geschäftsprozessen und zur Arbeitsorganisation integrativ fächerübergreifend strukturiert angelegt
besondere und angemessene Aufmerksamkeit. Durch sind.
die veränderte Sichtweise erhalten wesentliche Mo-
mente der beruflichen Bildung – also Arbeit und An der beruflichen Erwachsenen- und Weiterbil-
Technik – ihre eigentliche didaktische Bedeutung dungseinrichtung „Technikerschule“ sollte nicht eine
und werden um das Element „Bildung“ komplettiert. ausschließliche Festlegung auf ein Lern- und Studi-
Unter Berücksichtigung dieser tragenden Momente enkonzept erfolgen. In die Konzepte müssten auch
ergeben sich komplexe didaktische Konzepte für die fachsystematisch und kasuistisch strukturierte Pha-
berufliche Erwachsenen- und Weiterbildung im Be- sen mit arbeits- und technikweltlichen Themen, die
reich von Arbeit und Technik. Die berufliche Hand- durch die Studierenden – unter Berücksichtigung
lungskompetenz mit den Elementen Selbstständig- ihrer Probleme und Ansprüche – gestaltet werden
keit und Ganzheitlichkeit tritt somit ins Zentrum. sollten, integriert werden. Dieser umfassende ar-
beits- und technikorientierte didaktische Ansatz
Mit einem solchen didaktischen Ansatz beruflichen stellt in seiner relativ breiten Anlage eine Art Be-
Lernens erhalten das Handeln, Bewerten und Gestal- reichsdidaktik dar, bei der im Regelfall eine erhebli-
ten im Sachgebiet sowie der Bezug zu Arbeit und che Umformung auf die spezifischen Anforderungen
Technik für Lehr- und Lern- bzw. Studienkonzep- einer Fachrichtung erforderlich wird.
te einen besonderen Stellenwert. So kann erreicht
werden, dass beispielsweise neben dem erforderli- Mit einer Bereichsdidaktik – wie dem arbeits- und
chen Fachwissen über eine Technik und der damit technikorientierten Ansatz – ergeben sich zwar be-
verbundenen Arbeit auch das Handlungswissen zur sondere didaktische und methodische Möglichkeiten
Gestaltung und Beherrschung der Arbeits- und Ge- für die berufliche Erwachsenen- und Weiterbildung,
schäftsprozesse berücksichtigt werden. Auf diese es können jedoch nicht zwangsläufig die Spezifika
Weise wird für die angehenden Führungskräfte mit erfasst werden, die sich auf die Profile der Fach-
der zusätzlichen Zieldimension „Gestaltungs- bzw. bereiche, Fachrichtungen und die einzelnen Berufe
(Mit-)Gestaltungskompetenz“ – mehr noch als bei ei- beziehen. Entwickelt werden müssen deshalb Aufga-
nem Bezug auf eine berufliche Handlungskompetenz benstellungen, die den Studierenden für ihre berufli-
– „auf die schöpferische Qualität des selbstverant- che Zukunft relevant erscheinen. Die Bereichsdidak-
worteten Tuns sowie auf die Inhaltlichkeit der Ge- tik ist nicht auf die bestehenden Technikerschulen
staltungsspielräume“ (RAUNER 1995, S. 52) verwiesen. hin angelegt. Dennoch hat sie für die curricular vor-
Damit kann für einzelne Sachbereiche als Teil des geschriebenen und zusätzlichen Bildungsgänge eine
große Relevanz.
Sachgebietes ein „unauflösbarer Zusammenhang
des technisch Möglichen und des sozial Wünschba- Die Grenzen einer arbeits- und technikorientierten
ren“ (ebd., S. 57) aufgezeigt werden. Didaktik liegen darin, dass diese nicht auf spezifi-
lernen & lehren | 4/2014 | 116 139SCHWERPUNKTTHEMA „TECHNIKERSCHULEN – FACHSCHULEN FÜR TECHNIK“
sche Fachbereiche, Fachrichtungen und Berufe hin Die Arbeitsfelder der Berufsdidaktiken für die Techni-
ausdifferenziert sind und vielleicht auch nicht dar- kerschulen lassen sich in Anlehnung an die bildungs-
auf ausgelegt werden sollten, weil sonst übergeord- theoretische Didaktik für berufliches Lernen und
nete Momente von Arbeit und Sachgebiet oder Sach- Studieren in eine solche im weiteren sowie im en-
bereich aus dem Curriculum ausgeschlossen werden geren Sinne differenzieren. Danach umfasst die Be-
und die exemplarische Bedeutung von thematischen rufsdidaktik im weiteren Sinn alle relevanten didak-
Aufbereitungen verloren ginge. tischen und methodischen Bereiche. Eingeschlossen
sind darin sowohl Fragen des Gesamtansatzes der
Ansätze zu Berufsdidaktiken Lern- und Studienziel- sowie Inhaltsproblematik als
In der Technikerschule soll für einen Beruf mit Füh- auch der Methoden und Medien sowie der Lernorga-
rungsaufgaben im unteren und mittleren Manage- nisation der Technikerschule. Die Berufsdidaktik im
ment ausgebildet werden. Deshalb sind nicht nur engeren Sinne sollte Fragen der Lern- und Studien-
solche Berufsdidaktiken zu betrachten, wie sie be- zielfindung, der Auswahl, des Ausschlusses und der
reits in anderen Zusammenhängen diskutiert wor- Strukturierung von Lern- und Studieninhalten sowie
den sind. Vielmehr sind besondere Berufsdidaktiken deren Evaluation und Transformation im Bildungs-
wünschens- und erstrebenswert. Zwar werden schon gang behandeln.
seit längerem spezifische didaktische Konzepte in Berufsdidaktik und Methodik des berufsfachlichen
der beruflichen Erwachsenen- und Weiterbildung Unterrichts stehen letztlich für Planer von Lern- und
verwendet, diese sind jedoch in ihrer Ausrichtung Studienprozessen in enger Verbindung zueinander
auf die angestrebten Zweit- oder Weiterbildungsbe- und können nur in ihrem interdependenten Zusam-
rufe verbesserungsbedürftig. Ursachen dafür liegen menhang, d. h. nicht unabhängig voneinander, ge-
sowohl im Wandel von Handwerk, Industrie und sehen und entwickelt werden. Die systematisierten
Handel als auch in der Differenziertheit der Berufs- Ergebnisse von Tätigkeitsrecherchen sowie berufs-
welt und neuer gesellschaftlicher und bildungspoli- relevanten Aussagen von zusätzlich hinzugezoge-
tischer Ansprüche. nen Wissenschaften und berufswissenschaftlichen
Ansätzen bilden die Basis für die Aufbereitung von
Für die in der beruflichen Erwachsenen- und Wei-
umfassenderen Inhalten für die Unterrichtspraxis im
terbildung an Fachrichtungen und an der Berufswelt
Vorfeld didaktisch-methodischer Entscheidungen.
orientierten Bildungsgänge sind andere berufsorien-
tierte oder berufsspezifische didaktische Konzepte ENTWICKLUNGSMÖGLICHKEITEN DER DIDAKTIK UND
erforderlich. Hier können Ansätze der Berufsdidak- METHODIK DER BERUFLICHEN ERWACHSENEN- UND
tik, die für andere berufliche Schulen konzipiert wor- WEITERBILDUNG FÜR DIE PRAXIS UND THEORIE
den sind, hilfreich sein. Darüber hinaus lassen sich DER TECHNIKERSCHULE
in der einschlägigen Literatur, u. a. unter Rückgriff
Für die berufliche Erwachsenen- und Weiterbildung
auf deren Gründungsphase, zahlreiche Anregungen
an der Technikerschule lagen schon frühzeitig erste
finden (PAHL 2010, S. 79 ff.).
spezifische Unterrichtskonzepte sowie „didaktische“
Die heutigen Technikerschulen sind viel differenzier- Ansätze vor. Im Regelfall orientierten sich diese an
ter in Fachrichtungen und Schwerpunkte gegliedert. den Grundzügen der allgemeinen Unterrichtslehre
Sie stellen die jeweiligen Inhalte und Tätigkeitsmerk- bzw. Unterrichtsmethodik. Schon wenige Jahre nach
male eines fachrichtungsbezogenen Schwerpunktes der Gründung wurde aber erkannt, dass im Gegen-
bzw. Berufes „Techniker/-in“ in den Mittelpunkt einer satz zum Unterricht an allgemeinbildenden Schulen
beruflichen Erwachsenen- und Weiterbildung. Darü- beim Unterricht an beruflichen Lehranstalten „die
ber hinaus sind die Ziele auch auf eine Abrundung Anforderungen der Praxis im Vordergrunde“ (zit.
der Allgemeinbildung gerichtet. Bei neuen didakti- nach: SCHÜTTE 2003, S. 266) zu stehen hatten. Metho-
schen Ansätzen sind außerdem – wie schon expli- disch sollten „naturgemäße“ Unterrichtsverfahren
ziert – lernpsychologische Reflexionen zur Zielgrup- eingesetzt werden, die die psychologischen Anlagen
pe „Erwachsene“ empfehlenswert. Für die berufliche der Schüler berücksichtigen. Daher sollte sich der
Weiterbildung, um die es an der Technikerschule im Unterricht an den Schulen für Technik „nicht aus-
Kern geht, sind deshalb eher andragogische Lern- schließlich auf den Vortrag des Lehrers beschränken,
konzepte erforderlich (s. dazu die Praxisbeiträge in sondern durch Fragen, Beispiele, Wiederholungen
diesem Heft). ergänzt werden“ (zit. nach: SCHÜTTE 2003, S. 278). Die
140 lernen & lehren | 4/2014 | 116SCHWERPUNKTTHEMA „TECHNIKERSCHULEN – FACHSCHULEN FÜR TECHNIK“
im Vorfeld der „Technikerschule“ geführten Diskussi- tigungssystem und an den beruflichen Erfahrungen
onen hatten schon in der Wende vom neunzehnten der Studierenden, wobei die Entsprechung von Ver-
zum zwanzigsten Jahrhundert ein beachtliches Refle- fahren des Beschäftigungssystems mit Lern- und Stu-
xionsniveau erreicht. dienmethoden nutzbar ist.
Heute können und müssen Dozentinnen und Dozen- Für die Medien gilt, dass neben den Exponaten und
ten bei ihren Lehr- und Studienplanungen auf sehr Lernmitteln, die aus der allgemeinbildenden Schule
verschiedene didaktische Konzepte der Allgemein- bekannt sind, spezifische Ausbildungs- und Arbeits-
bildung, der Erwachsenenbildung, der beruflichen mittel an der Technikerschule eingesetzt werden, die
Weiterbildung und der Berufsausbildung zurückgrei- durch fach-, branchen- oder berufsspezifische Be-
fen. Auch wenn es für die Technikerschule spezifi- sonderheiten bestimmt sind (MANSFELD 2013).
sche didaktische Konzepte gibt, sind viele Bereiche
Die bisher in der Technikerschule praktizierten di-
mit Blick auf ihre Genese von der Allgemeinen Di-
daktischen und methodischen Konzepte lassen sich
daktik und den Fachdidaktiken der entsprechenden
auch als Ansätze zu spezifischen Didaktiken dieser
Fächer anderer Schularten geprägt (vgl. Abb. 2).
semi-akademischen Ausbildungseinrichtung inter-
Für die berufsorientierten Fächer lassen sich dage- pretieren, wobei sich bei realistischer Sicht zeigt,
gen neben der arbeits- und technikorientierten Be- dass die an der beruflichen Erwachsenen- und Wei-
reichsdidaktik berufsdidaktische Ansätze feststel- terbildungsstätte praktizierten didaktischen Konzep-
len, die – ohne expressiv verbis benannt zu werden te beruflichen Lernens und Studierens einerseits ein
– mehr oder weniger stark praktiziert werden, wobei Konglomerat verschiedenster didaktisch-methodi-
die Berufs- und Fachlichkeit einen hohen Stellenwert scher Ansätze aus Allgemeinbildung, Erwachsenen-
einnimmt. Etwas Entsprechendes wie eine ausge- bildung und Berufsbildung darstellen, andererseits
formte schulspezifische Didaktik im engeren Sinne schon spezifisch und teilweise profilgebend sind.
ist nur in Ansätzen vorhanden.
Damit sind Marksteine formuliert, um die Entwick-
Für den Einsatz in der Technikerschule liegt inzwi- lung der Didaktiken und Methodiken der Techniker-
schen ein reichhaltiges Reservoir an Vermittlungs- schule voranzubringen. Ein solches Vorhaben ist
verfahren vor, auf das die Lehrkräfte bzw. Dozen- nicht Selbstzweck, sondern soll die Unterrichtspra-
tinnen und Dozenten zurückgreifen können. Es ist xis fundieren und die Bildungsgänge an Techniker-
insbesondere im Bereich der Makromethoden ein schulen nachhaltig unterstützen.
umfassendes Methodenangebot vorhanden. Dieses
besteht sowohl aus allgemeinen als auch aus sehr ANMERKUNGEN
spezifischen Methoden. Letztere orientieren sich an
1) Wegen des traditionellen und auch des heutigen
entsprechenden Arbeitsmethoden und Techniken
Sprachgebrauchs wird im Folgenden der Ausdruck
bzw. Arbeits- und Geschäftsprozessen im Beschäf-
„Technikerschule“ verwendet, obwohl die
offizielle Bezeichnung „Fachschule für
Technik“ lautet.
2) Deshalb sollten die entstehenden be-
rufswissenschaftlichen Ansätze ausge-
baut werden, um u. a. zur Erfassung der
beruflichen Arbeit im Sachgebiet „Tech-
nik“ angemessene Instrumente zu entwi-
ckeln.
LITERATUR
KREBS, W. (Hrsg.) (1992): Technikerausbildung
als Aufstiegsfortbildung. Alsbach/Bergstraße
MANSFELD, T. (2013): Simulation – fach- und be-
rufsdidaktische Innovationen in metall- und
elektrotechnischen Domänen. Diss. TU Berlin
Abb. 2: Genese der didaktischen Ansätze beruflichen Lernens für die
Technikerschule
lernen & lehren | 4/2014 | 116 141SCHWERPUNKTTHEMA „TECHNIKERSCHULEN – FACHSCHULEN FÜR TECHNIK“/PRAXISBEITRÄGE
PAHL, J.-P. (2010): Fachschule. Praxis und Theorie einer be- SCHÜTTE, F. (2003): Quellen und Dokumente zur Geschich-
ruflichen Weiterbildungseinrichtung. Bielefeld te der technischen Bildung in Deutschland. Teil 2:
RAUNER, F. (1995): Gestaltung von Arbeit und Technik. In: Das technische Fachschulwesen 1890–1938. Quellen
ARNOLD, R./LIPSMEIER, A. (Hrsg.): Handbuch der Berufsbil- und Dokumente zur Geschichte der Berufsbildung in
dung. Opladen, S. 50–64 Deutschland, Reihe C, Band 8. Köln/Weimar/Wien
SCHÜTTE, F. (1996): Methodenwandel oder didaktischer Pa- ZÖLLER, M. (2013): Berufliche Weiterbildung an Fachschu-
radigmenwechsel? Zur Perspektive der Fachdidaktik an len. In: Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.): Da-
Technikerschulen. In: Zeitschrift für Berufs- und Wirt- tenreport zum Berufsbildungsbericht 2013. Bonn, S.
schaftspädagogik, 92. Band, Heft 2, S. 135–150 371–374
Berechnungen an Profilen
– ein Beispiel aus dem Fachschulunterricht
Die Weiterbildung zur Technikerin/zum Techniker für Maschinentechnik umfasst
wesentliche ingenieurwissenschaftliche Grundlagen, die aber im Gegensatz zur
Lehre an den Hochschulen nach den aktuellen Kriterien der Berufspädagogik ver-
mittelt werden sollen. An der Fachschule für Technik der Staatlichen Gewerbe-
schule für Stahl- und Maschinenbau G1 in Hamburg findet dies im Lernfeld „Mo-
dellbildung“ seinen Niederschlag. An einem Beispiel zur Querschnittsgeometrie
in der Festigkeitslehre wird dies mit Hilfe des Unterrichtsverfahrens Konstrukti-
onsvergleich erklärt. ROLAND KOCH
MODELLBILDUNG – EIN LERNFELD IM BEREICH rein virtuelle Lernträger, da die Haupttätigkeit des
„BERECHNEN UND KONSTRUIEREN“ Konstrukteurs im virtuellen Bereich stattfindet. Der
Autor hält alle drei Lernträgervarianten für notwen-
Das Lernfeld „Modellbildung“ wurde an unserer
dig, da sie gemeinsam mehr Lernsituationen gene-
Schule eingeführt, um die Fächer Mathematik, Phy-
rieren.
sik, Statik und Festigkeitslehre zu ersetzen. Neben
dem fächerverbindenden Aspekt war die Verwertbar- QUERSCHNITTSGEOMETRIE IN DER
keit für die Konstruktionslehre, im Bezug auf Inhal- FESTIGKEITSLEHRE
te und Methoden, maßgebend. Dieses Unterfangen
barg und birgt einige Widersprüche und Unwägbar- „Es ist Aufgabe der Festigkeitslehre, Konzepte be-
keiten, denen man sich stellen muss: reitzustellen, die eine sichere und wirtschaftliche
Bauteilauslegung unter Berücksichtigung von Art
1. keine passenden Referenzen im Bezug auf Niveau und Höhe der Belastung sowie von Geometrie und
und Inhalte, Werkstoffart erlauben.“ (LÄPPLE 2008, S. 1; Hervor-
2. didaktische Brüche zwischen Grundlagen- und Er- hebung im Original) Im Bereich Modellbildung erfolgt
fahrungsfächern, die Auseinandersetzung mit der Geometrie von Kon-
struktionselementen als letztes von den drei genann-
3. Zertifizierungs- und Überprüfungsdruck durch
ten Themengebieten. Die Art der Belastung ist rein
Bildungsstandards,
zweidimensional und reduziert sich zunächst auf die
4. Abbildungsprobleme der konstruktiven Vielfalt gerade Biegung. Der Einstieg zur Querschnittsgeo-
auf Lernträger. metrie erfolgt klassisch mit dem rechteckigen Balken
Ob ein Lernträger ein reales Industrieprodukt oder unter Verwendung der Rechteckformel für Flächen-
ein reales oder gar virtuelles Modell sein sollte, wur- momente zweiten Grades: .
de und wird an der G1 durchaus kontrovers disku- Hierzu gehören auch die Regeln zur Addition und
tiert. Der Standpunkt der Konstrukteure priorisiert Subtraktion von Flächenmomenten für zusammenge-
142 lernen & lehren | 4/2014 | 116PRAXISBEITRÄGE
setzte Querschnitte, die eine Reduzierung auf Recht- Verteilen eines Plattenmaterials mit vorgegebener
eckprobleme ermöglichen (s. Abb. 1). Wandstärke können die Lösungsvarianten reduziert
werden.
Unterrichtsziel und Methode
Die Studierenden sollen in einem „Konstruktionsver-
gleich“ (PAHL 2013, S. 224 ff.) die Phänomene „Wider-
standsmoment“ und „Flächenmoment zweiter Ord-
nung“ verstehen lernen sowie diese bedeutsamen
Abb. 1: Beispiel für Addition und Subtraktion von Flächenmo-
menten Parameter zur Querschnittsgeometrie unterscheiden
und anwenden können.
Ein paar Übungsaufgaben, mit der Methode „Papier Phase 1: Vergleichsanlass: Widerstandsmoment versus
und Bleistift“, sollten die möglichen Denkfehler the- Formsteifigkeit
matisieren und Unsicherheiten reduzieren. Außer-
Anhand der Profilpaare, die den Lernern zur Verfü-
dem wird mit dem Randfaserabstand zmax das Wider-
gung stehen, wird das Verhalten auf gerade Durch-
standsmoment eingeführt: .
biegung anschaulich überprüft. Dies geschieht am
DIDAKTISCHE ÜBERLEGUNGEN ZUM einfachsten, indem versucht wird, die Profile mit der
UNTERRICHTSABLAUF Hand durchzubiegen (Abb. 3).
Phase 0: Fertigung zweier Profile
Im Vorfeld des Unterrichts bekommen die Lernenden
den Auftrag, ein Kreuz- und ein Kastenprofil (s. Abb.
2) nach folgenden Vorgaben anzufertigen:
Abb. 3: Belastete Profile (Kreuzprofil links; Kastenprofil rechts)
Phase 2: Intuitives Vergleichen, Hypothesenbildung und
Hypothesenüberprüfung
Der wahrgenommene Unterschied, dass das Kas-
tenprofil biegsamer und das Kreuzprofil steifer ist,
wird von allen Studierenden variantenübergreifend
Abb. 2: Kreuz- und Kastenprofil
bestätigt. Manchmal ergibt sich der Glücksfall, dass
– Der Werkstoff sollte leicht und flexibel sein, z. B. eine Studierende bzw. ein Studierender ein zu sprö-
feinporiges Styropor. des Material als Werkstoff verwendet hat. Dann kann
mit einem leider nur einmal durchführbaren Bruch-
– Etwaige Klebeverbindungen müssen elastischer
test (!) auch demonstriert werden, dass das Wider-
als der Werkstoff sein.
standsmoment beim Kreuzprofil geringer ist. Die
– Die Klebeverbindungen dürfen das Festigkeitsver- Beobachtungen werden rechnerisch überprüft und
halten nicht stark verändern. bestätigt: .
– Die Länge des Profils ist deutlich größer als seine Dieses Vergleichsergebnis führt zu ersten Hypothe-
Außenmaße, z. B. 10:1. sen, z. B.:
– Für beide Querschnitte gilt jeweils: – Dem Kastenprofil fehlt Höhe, deshalb hat es eine
– zweiachsige Symmetrie und h = b, geringere Formsteifigkeit.
– gleiche Wandstärke und gleiche Querschnitts- – Die Waagerechte des Kreuzprofils liegt ungünstig.
fläche, – Das Kastenprofil hat eine geschlossene, rohrähnli-
– kleine Wandstärke zur Profillänge, z. B. 1:20. che Struktur.
Scheinbar sind die Einschränkungen sehr groß, aber Die Erklärungsversuche der Studierenden werden
die Schülerlösungen variieren doch erheblich. Durch dokumentiert und in Arbeitsgruppen auf logische
lernen & lehren | 4/2014 | 116 143PRAXISBEITRÄGE
Schlüssigkeit überprüft. Jetzt verdichten sich zwei
Kernhypothesen:
– Das Widerstandmoment geht zu Lasten der Form-
steifigkeit.
– Die Formsteifigkeit geht zu Lasten des Wider-
standsmomentes.
Je nach Temperament und Diskutierfreudigkeit der
Studierenden wird die Hypothese „Formsteifigkeit Abb. 4: Lösungsvarianten der Kastenprofile
versus Widerstandsmoment“ mit Vorschlägen, Bei- Höhe einfließen zu lassen. Außerdem wird auch Ma-
spielen und Beobachtungen untermauert oder ange- terial in die waagerechten Randstücke „investiert“
zweifelt. (wie im unteren Beispiel dargestellt). Folglich haben
Phase 3: Vergleichsplanung mit die so entdeckten verschiedenen I-Profile (Doppel-T)
Vergleichszielformulierung erstaunlich hohe Flächen- und Widerstandsmomen-
te. Diese können dann wiederum tabellarisch fest-
Zwangsläufig werden Fragen laut, ob nicht bei gehalten, verglichen und bewertet werden. Mit der
gleichbleibenden Querschnittsflächen und Wand- gefundenen optimalen Querschnittsgeometrie (s.
stärken die Geometriewerte verbessert werden kön- Abb. 5) wird der zum Unterrichtsbeginn festgestellte
nen. Aus dem Paarvergleich wird nun ein Vergleich Widerspruch widerlegt, dass ein hohes Widerstands-
zwischen den Arbeitsergebnissen der Studierenden. moment zu Lasten einer niedrigen Formsteifigkeit
Gemeinsam werden die Optimierungsbedingungen geht bzw. eine hohe Formsteifigkeit ein niedriges
festgelegt. Als Zielformulierung sind bei senkrechter Widerstandsmoment zur Folge hat.
Symmetrie, gleichbleibender Querschnittsfläche und
Wandstärke möglich:
– Erhöhung des Widerstands- und Flächenmoments.
– Verbesserung des jeweilig ungünstigeren Parame-
ters.
Phase 4: erste Optimierungssequenz und
Vergleichsdurchführung Abb. 5: Optimierung der Profile
Die Lerner fangen an, zu den Querschnittsflächen ih-
rer Profile neue Profile zu entwerfen und deren Geo- Ausblick und Fortführung des Themas
metriewerte nachzurechnen. Da die Formsteifigkeit Die stattgefundene umfangreiche Optimierungsse-
im Wesentlichen von der Höhe h abhängt, entstehen quenz ermutigt die Studierenden, noch weitere Op-
rechteckige Kastenprofile mit h > b. Diese Lösungs- timierungsmaßnahmen vorzuschlagen, z. B. durch
varianten (s. Abb. 4) ergeben sich aus der vorgege- Aufgabe der Profilsymmetrie, die zu einer Verschie-
benen Ausgangssituation und der relativ leichten bung der Schwerelinie führt. Unsymmetrische Profile
Berechenbarkeit von Kastenprofilen. Die mit „Papier erfordern dann die Herleitung des „Steinerschen Sat-
und Bleistift“ berechneten Widerstandswerte und zes“. Mit Hilfe des „Steinerschen Satzes“ können vie-
Flächenmomente werden tabellarisch festgehalten, le Profilvarianten entwickelt und berechnet werden.
verglichen und bewertet. Außerdem ist jetzt ein sicherer Umgang mit Tabel-
Phase 5: zweite Optimierungssequenz und lenwerten zu Normprofilen und deren konstruktiven
Vergleichsauswertung Kombinationen möglich. Nun können neu entwickel-
te Profile und Profilkombinationen aus Normprofilen
In der Regel wird von einigen Studierenden die Fra- mit außermittiger Schwerelinie berechnet werden
ge aufgeworfen (manchmal auch die Behauptung), (Beispiele in Abb. 6 und Abb. 7).
ob (bzw. dass) die Profilgeometrie noch weiter zu
verbessern sei. Im Plenum wird dann das „Wie“ SCHLUSSBETRACHTUNG
diskutiert. Gute bzw. berufserfahrene Studierende
In dem Unterrichtsbeispiel kommen nicht alle Pha-
verzichten auf einen der beiden senkrechten Stege, sen des Konstruktionsvergleiches zum Einsatz, da für
um das dadurch gewonnene Material in eine größere
144 lernen & lehren | 4/2014 | 116PRAXISBEITRÄGE
einem Jahr werden Sie sich nicht mehr an die For-
mel für das Flächenmoment erinnern – an die Profile
aber doch!“
Insgesamt ist das Feedback der Lerner sehr positiv,
da diese Art des Unterrichts eine angenehme und
Abb. 6/7: Zu beherrschende praktische Anwendungsfälle
entspannte Arbeitsatmosphäre bei gleichzeitig ho-
hem Lernzuwachs fördert. Darüber hinaus bestätigen
die Konstruktionskollegen, dass die Studierenden in
diese Anwendungssituation dann doch mit Kanonen den späteren Semestern – in den „harten“ Anwen-
auf Spatzen geschossen werden würde. Wem der Ter- dungssituationen – sicher mit Flächenmomenten
minus „Konstruktion“ nicht behagt, könnte die Lern- zweiter Ordnung und Widerstandsmomenten umge-
situation auch als „Homologievergleich“ titulieren. hen können.
In den bisher durchgeführten Unterrichten wird die
Chronologie der Unterrichtsphasen 3, 4 und 5, be- Realmodelle nehmen als Lernträger eine Zwitterfunk-
dingt durch die Spontanität und Berufserfahrung der tion zwischen einem realen Industrieprodukt und
Studierenden, oftmals durcheinander geworfen. Die- einem CAD generierten virtuellen Produkt ein. Beim
ses erfordert dann vom Unterrichtenden, „dramatur- Thema „Querschnittsgeometrie“, dass unabhängig
gisch“ einzugreifen. Es kann z. B. so aussehen, dass vom Werkstoff behandelt werden kann, ist ein Real-
eine leistungsstarke Arbeitsgruppe ihre einzelnen modell z. B. aus Hartschaum ein idealer Lernträger,
Optimierungsschritte dem Plenum vorträgt und da- da es als einprägsamer Gedächtnisanker fungiert
mit eine übertragbare Lösungsidee für die anderen und durch materielle Leichtigkeit gute Handhabbar-
Lerner zur Verfügung stellt. Da die Spontanität und keit ermöglicht. Versuche, auch destruktive, können
Lebendigkeit der Studierenden sehr viel Spaß bringt, kostengünstig realisiert werden, und es hilft, eine
wurde bisher auf eine lenkende Agenda zum Einstieg doch recht trockene Theoriewüste zu kultivieren.
in die Lernsituation verzichtet.
LITERATUR
Manchmal wird auch von den Studierenden der Ferti-
LÄPPLE, VOLKER (2008): Einführung in die Festigkeitslehre.
gungsaufwand für die Profilmodelle in Frage gestellt, Schorndorf
etwa mit den Worten: „Man kann das doch gleich al-
PAHL, JÖRG-PETER (2013): Ausbildungs- und Unterrichtsver-
les auf dem Papier berechnen!“ Die Entgegnung: „In
fahren. Bielefeld
Liebe Leserinnen und Leser,
die Zeitschrift „lernen & lehren“ möchte sehr gern vor allem den Fachleuten an den Lernorten die Mög-
lichkeit einräumen, die vielfältigen Erfahrungen gut funktionierender Ausbildungs- und Unterrichtspra-
xis in Beiträgen der Zeitschrift zu veröffentlichen. Daher möchten wir Sie gern ermuntern, sich mit der
Schriftleitung in Verbindung zu setzen. Wir streben wie bisher an, pro Heft zwei vom Themenschwer-
punkt unabhängige Beiträge zu veröffentlichen.
Wenn Sie Interesse haben, an einem Themenschwerpunkt mitzuwirken, setzen Sie sich bitte rechtzei-
tig mit uns in Verbindung, da die Herstellung der Zeitschrift einen langen zeitlichen Vorlauf benötigt.
Ab dem vierten Quartal 2015 sind derzeit folgende Themenschwerpunkte geplant:
– Industrie 4.0
– Elektromobilität
– Beitrag der berufsbildenden Schulen zur Lehrer(aus)bildung und forschendes Lernen
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung!
Herausgeber und Schriftleitung
lernen & lehren | 4/2014 | 116 145Sie können auch lesen