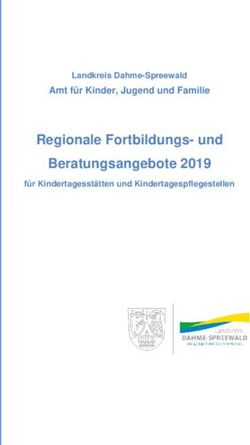LESEVERSTEHEN KENNT KEINE SPRACHGRENZEN - KOOPERATIV UND MEHRSPRACHIG TEXTE VERSTEHEN - BISS-TRANSFER
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
| 1 Leseverstehen kennt keine Sprachgrenzen Kooperativ und mehrsprachig Texte verstehen Eine Initiative von:
Sprach- und Leseförderung mit BiSS „Bildung durch Sprache und Schrift“ (BiSS) ist eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) sowie der Kultus ministerkonferenz (KMK) und der Konferenz der Jugend- und Familienminister (JFMK) der Länder zur Verbesserung der Sprachförderung, Sprachdiagnostik und Leseförderung. Das Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache der Universität zu Köln, das DIPF | Leibniz- Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation und die Humboldt-Universität zu Berlin in Kooperation mit dem Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) übernehmen als Trägerkonsortium die wissenschaft- liche Ausgestaltung und Gesamtkoordination des Programms.
1
Inhalt Bild: BiSS-Trä
gerkonsortium/Annet
te Etges
2
Mehrsprachigkeit
Ein Plus für die Leseförderung 11
Einführung des
5 Mehrsprachigen
Mehrsprachiges Reziproken Lesens
Reziprokes Lesen in der Primarstufe
In Kleingruppen Texte lesen und Orientierungshilfe für die Praxis
mehrsprachig Bedeutung herstellen
19
9 Weiterlesen
Experteninterview
„Die Kinder merken, dass sie sich in allen
ihren Sprachen den Text erschließen
20
können.“ Impressum2 | Leseverstehen kennt keine Sprachgrenzen
Mehrsprachigkeit
Ein Plus für die Leseförderung
Im Unterricht erhalten die Schülerinnen und Schüler schreiben wir, dass wir mit dem Radiergummiraumschiff
den Arbeitsauftrag, einer Person in einem Brief über zurückgeflogen sind.“ Pascal ergänzt: „Am besten einen
ihren neuen außerirdischen Freund sowie die gemein Tag später.“ (Videotranskript: vgl. Bezirksregierung
samen Erlebnisse auf seinem Planeten zu berichten. Köln, 2019)
Die Kinder sitzen an Gruppentischen zu fünft zusam-
men und bearbeiten die Aufgabe. Parallel unterhalten Diese authentische Unterrichtssituation macht deutlich,
sie sich über das Geschriebene. Klarissa schreibt einen dass mehrsprachige Interaktion eine Ressource für den
Brief an den Bürgermeister Herrn Jansen auf Rus- Unterricht darstellen kann. Sprachen zu kombinieren,
sisch „Дорогой Мистер Янсен, я была на Элементар ist insbesondere dann pragmatisch angemessen wenn
планетe [...]“ und unterhält sich zugleich mit ihren zwei oder mehr Lernende über sprachliche Mittel aus
Mitschülerinnen und Mitschülern über den Inhalt ihres den gleichen Sprachen verfügen. Mehrsprachige Kinder
Briefes. Klarissa: „Er lebt auf dem Elementarplane- lernen früh, wie sie die ihnen zur Verfügung stehen-
ten [...].“ [...] Samira liest ihren Text auf Türkisch vor: den sprachlichen Mittel an ein- oder mehrsprachige
„Sevgili arkadaşlar, uzaylı arkadaşımla birlikte bir hafta Kommunikationssituationen anpassen können, damit die
geçirdim. Bana kendi okulunu gösterdi“, und erläutert Gesprächsteilnehmenden sie verstehen. Damit erwerben
auf Deutsch: „Liebe Freundinnen und Freunde, ich habe sie eine besondere kommunikative Kompetenz: Sie lernen
eine Woche mit meinem außerirdischen Freund ver- nicht nur, ihre Sprachwahl flexibel und schnell umzustel-
bracht. Er hat mir seine Schule gezeigt.“ Klarissa fügt len — sie können die getroffene Sprachwahl falls nötig
hinzu: „Ja, das habe ich auch. [kleine Pause] Dann auch korrigieren (vgl. Tracy, 2008).
Bild: BiSS-Trägerkonsortium/Ann
ette EtgesMehrsprachigkeit | 3
Mehrsprachigkeit für
das Lernen aktivieren
Mehrsprachige Personen haben die
verschiedenen Sprachen nicht als strikt
getrennte Systeme im Kopf. Sie verfügen
vielmehr über ein Gesamtrepertoire an
sprachlichen Mitteln. Dieses können sie
insbesondere dann nutzen, wenn auch
die Gesprächspartnerinnen und -partner
mehrere Sprachen sprechen. Üblich sind
translinguale Sprachhandlungen wie
Sprachmischungen oder Sprachwechsel
(vgl. Cantone, 2007). Diese sind im
Gespräch zwischen zwei- oder mehr-
Etges
Bild: BiSS-Trägerkonsortium/Annette
sprachigen Menschen absolut sinnvoll und
deshalb ein Zeichen für den kompetenten
Umgang mit Sprachen (vgl. Tracy, 2008). forderungen (meist im Deutschen) unterstützen. Solche
Hilfen können z. B. Begriffsnetze, Definitionskarten oder
Für das schulische Lernen ist das Medium Sprache Lernplakate sein (vgl. „Weiterlesen“: Methodenpool für
zentral. Es lohnt sich daher, das gesamtsprachliche sprachsensiblen Unterricht).
Repertoire als Ressource im Unterricht aktiv zu nutzen.
Auf diese Weise kann man mehrsprachigen Kindern und
Jugendlichen das Lernen erleichtern. Translanguaging
Der Begriff Translanguaging wurde ursprünglich
In einer mehrsprachigen Unterrichtspraxis nutzen Lehr- von dem Waliser Sprachforscher Cen Williams
kräfte das gesamte sprachliche, kommunikative und geprägt. Später wurde er vor allem von der New
intellektuelle Potenzial mehrsprachiger Schülerinnen und Yorker Expertin für mehrsprachige Erziehung
Ofelia García übernommen. Sie beschreibt trans-
Schüler zu deren Wissens- und Kompetenzerwerb. Die
linguales sprachliches Handeln als natürliche und
Kinder und Jugendlichen erfahren außerdem, dass ihre
legitime Form der Kommunikation (vgl. Otheguy,
Mehrsprachigkeit wertgeschätzt wird. García & Reid, 2015) mit großem didaktischen
Potenzial für den Unterricht (vgl. García, Ibarra-
Gerade in kooperativen Lernformen bietet es sich an, Johnson & Seltzer, 2017). Im Alltag werden
dass Lernende mit gleichen Sprachenkonstellationen zu- Sprachen jedoch häufig als aufzählbare Einheiten
sammenarbeiten und in allen ihnen verfügbaren Sprachen behandelt. Dadurch entsteht das Missverständ-
nis, dass diese konstruierten Abgrenzungen (z. B.
interagieren (vgl. Celic & Seltzer, 2011). Wenn sie aber
Deutsch vs. Englisch) auch im Kopf mehrspra-
zu einer größeren Gruppe sprechen (z. B. im Klassen-
chiger Personen bestehen. Zentrale These des
plenum) oder etwas an die Allgemeinheit schreiben, Translanguaging-Ansatzes ist dagegen, dass klar
ist es erforderlich, dass sie die Sprache verwenden, die definierte Grenzen zwischen Sprachen im Kopf
möglichst alle Adressatinnen und Adressaten verstehen. nicht existieren. Standardsprachliche Korrekt-
Dabei brauchen die Kinder und Jugendlichen ggf. Unter- heit und bildungssprachliche Fähigkeiten sollten
deshalb auf der Basis der gesamten verfügbaren
stützung. Es ist deshalb sinnvoll, dass Lehrkräfte dann
sprachlichen Mittel der Kinder und Jugendlichen
sprachliche Hilfen bereithalten, die die Lernenden bei der
gefördert werden.
Bewältigung der standard- und bildungssprachlichen An-4 | Leseverstehen kennt keine Sprachgrenzen
Lesekompetenz auf Basis der
Gesamtsprachigkeit fördern Literatur
Im Hinblick auf die Lesekompetenz unterscheidet die Bezirksregierung Köln (2019). Mehrsprachiges Reziprokes
Forschung zwischen hierarchieniedrigen und hierarchie Lesen in der vierten Klasse. Video- und Fortbildungsmaterial.
hohen Prozessen (vgl. z. B. Lenhard, 2013). Kinder Köln.
müssen zunächst die hierarchieniedrigen Prozesse im Cantone, K. F. (2007). Code-switching in Bilingual Children.
Lesen automatisieren, z. B. die Laut-Buchstaben-Zuord- Dordrecht: Springer.
nung und die Worterkennung. Dann erst sind kognitive Celic, C. & Seltzer, K. (2011). Translanguaging: A CUNY-
Ressourcen für die hierarchiehohen Prozesse frei, also NYSIEB Guide for Educators. Verfügbar unter: https://www.
cuny-nysieb.org/wp-content/uploads/2016/04/Translangua-
für das Textverstehen. Hierarchiehohe Prozesse — wie die
ging-Guide-March-2013.pdf [12.08.2019].
Anwendung von Textsortenwissen und Lesestrategien —
sind jedoch nicht direkt mit bestimmten Einzelsprachen García, O.; Ibarra-Johnson, S. & Seltzer, K. (2017). The
Translanguaging classroom. Leveraging student bilingualism for
verknüpft. Das heißt: Hat ein Kind Lesestrategien z. B.
learning. Philadelphia: Caslon.
schon auf Türkisch kennengelernt, kann es die gleichen
Lenhard, W. (2013). Leseverständnis und Lesekompetenz.
Strategien auch auf Texte in Deutsch anwenden. Es ist
Grundlagen, Diagnostik, Förderung. Stuttgart: Kohlhammer.
daher plausibel, dass Kinder die Strategien auch effek-
tiver erwerben und festigen und Texte besser verstehen, Otheguy, R.; García, O. & Reid, W. (2015). Clarifying translan-
guaging and deconstructing named languages. A perspective
wenn sie in der Interaktion zu Texten alle verfügbaren from linguistics. Applied Linguistics Review, 6 (3), 281—307.
Sprachen anstatt nur eine Sprache nutzen.
Tracy, R. (2008). Wie Kinder Sprachen lernen. Und wie wir sie
dabei unterstützen können (2. überarbeitete Aufl.). Tübingen:
Diese Annahme macht sich die Methode des Mehrspra- Francke Verlag.
chigen Reziproken Lesens zunutze: Sie verknüpft das
Prinzip des interaktiven Lernens mit den didaktischen
Ressourcen der Mehrsprachigkeit.Mehrsprachiges Reziprokes Lesen | 5
Mehrsprachiges Reziprokes Lesen
In Kleingruppen Texte lesen und mehrsprachig
Bedeutung herstellen
Das Mehrsprachige Reziproke Lesen wurde im Rahmen metasprachliche Fähigkeiten auf Basis der Gesamtspra-
eines BiSS-Verbunds im Regierungsbezirk Köln ent- chigkeit anzueignen. Vor allem geht es darum, dass die
wickelt (vgl. Gantefort & Sánchez Oroquieta, 2015). Lernenden unter Nutzung all ihrer sprachlichen Fähig-
Reziprokes Lesen ist eine bekannte und evaluierte keiten Lesestrategien erwerben und sie festigen, um in
Methode zur Förderung des Leseverstehens (vgl. der Folge fachliche und literarische Texte eigenständig
Rosenshine & Meister, 1994). Der Verbund hat diese verstehen zu können.
Methode auf Basis der Prinzipien des Translanguaging-
Ansatzes (vgl. „Translanguaging“, S. 3) für den Einsatz Die Methode richtet sich an Schülerinnen und Schüler,
in mehrsprachigen Lerngruppen weiterentwickelt, die über ein Mindestmaß an Leseflüssigkeit verfügen und
erprobt und wissenschaftlich evaluiert. Die wichtigsten Unterstützung im strategischen, verstehenden Lesen
Merkmale der Methode fassen wir hier zusammen. benötigen. Sie eignet sich für den Deutsch-, Sachfach-
und den herkunftssprachlichen Unterricht (HSU) in der
Primar- und Sekundarstufe und lässt sich insbesondere
Für wen und wofür eignet sich die Methode? in mehrsprachigen Klassen einsetzen, in denen mehrere
Mithilfe des Mehrsprachigen Reziproken Lesens können Lernende über die gleichen bzw. vergleichbare Sprachen-
Lehrkräfte ihre Schülerinnen und Schüler darin unter- konstellationen verfügen.
stützen, sich fachliches Wissen, Leseverstehen und
Etges
Bild: BiSS-Trägerkonsortium/Annette6 | Leseverstehen kennt keine Sprachgrenzen
Wie wendet man die Methode an? 2. Anschließend besprechen die Lernenden unter freier
Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten in Gruppen Sprachwahl schwierige Wörter und/oder Textstellen
von vier bis fünf Personen einen Text. Dabei können sie in der Kleingruppe, um Unklarheiten zu Begriffen
sowohl das Deutsche als auch ihre Herkunftssprache(n) und Zusammenhängen zu klären. Unterstützend kann
nutzen. Die Lernenden wenden interaktiv fünf verschie- die Lehrkraft ihnen Tipp-Karten aushändigen, die die
dene Lesestrategien an. Dabei gehen sie abschnittsweise Lernenden bei Sprachhandlungen wie Erklären oder
vor und folgen einem festgelegten Ablauf: 1. (Vor-)Le- Definieren unterstützen.
sen, 2. Wörter und Textstellen klären, 3. Fragen stellen, 3. Im dritten Schritt formulieren und beantworten die
4. Zusammenfassen, 5. Vorhersagen (vgl. Abbildung 1). Schülerinnen und Schüler unter freier Sprachwahl
gemeinsam weiterführende Fragen zum Text. Die Fra-
Nach dem Lesen des Textes bearbeiten die Lernenden gen kann aber auch ein einzelnes Kind aus der Gruppe
weiterführende Aufgaben, für die sie standard- und bil- übernehmen. Fragen zu stellen und zu beantworten,
dungssprachliche Mittel benötigen. Für dieses Vorgehen unterstützt die Lernenden dabei, die inhaltlichen
hat das BiSS-Verbundteam deutsch-türkische Sprachhil- Zusammenhänge des Textes zu verstehen. Als hilfreich
fen (Lesehilfen, Fragenfächer; vgl. Abbildung 2) entwi- in dieser Phase hat sich ein Fragenfächer erwiesen,
ckelt. Sie unterstützen die Lernenden dabei, sprachliche der Fragewörter in Deutsch und der jeweiligen Her-
Anforderungen im Gruppengespräch zu bewältigen. kunftssprache enthält. Die Lehrkraft kann mit den Ler-
1. Im ersten Schritt lesen alle den Abschnitt leise und nenden gemeinsam reflektieren, welche Art von Fragen
markieren schwierige Wörter und Abschnitte. Gege- einfach und welche schwierig sind. Anknüpfungspunkte
benenfalls kann auch eine Schülerin oder ein Schüler dazu finden sich in den Kompetenzstufenmodellen der
den Text vorlesen. Kultusministerkonferenz zum Lesen (vgl. KMK, 2005).
Gibt es
schwierige Wörter
im Text?
‚Bleich‘
ne demek?
Bleich ist zum
eispiel, wenn
B
einem schlecht ist,
dann ist man
etwas weiß.
Abbildung 1: Mehrsprachiges Reziprokes Lesen im UnterrichtMehrsprachiges Reziprokes Lesen | 7
zum Klimawandel lesen
und dabei mehrsprachig
interagieren, sodann aber
einen Leserbrief für die
lokale Zeitung verfassen,
welcher in der deutschen
Standardsprache verfasst
werden muss, damit ihn
alle Leserinnen und Leser
der Zeitung auch verste-
hen können. Als hilfreich
haben sich dabei Methoden
und sprachliche Hilfen wie
Netzwerk, Definitions-
karte, Begriffsnetz und
Lernplakat erwiesen. Sie
unterstützen die Lernenden
Abbildung 2: Lesehilfen und Fragenfächer, Foto: BiSS-Trägerkonsortium
beim zusammenhängenden
Sprechen im Plenum und
4. Danach fassen die Lernenden den bisher gelesenen fördern zugleich die fachliche Begriffsbildung sowie das
Textabschnitt in eigenen Worten und wiederum unter Verstehen der Zuhörenden. Sollen im Anschluss an das
freier Sprachwahl zusammen. Auch an dieser Stelle Mehrsprachige Reziproke Lesen Schreibaufgaben bear
ist es möglich, dass ein Gruppenmitglied die Aufgabe beitet werden, bieten sich schreibdidaktische Methoden
übernimmt. Da es darum geht, die wesentlichen Aus- an, etwa Schreibplan, Schreibrahmen, Brief an mich
sagen des Textes zu erfassen, wird mit dieser Strate- selbst oder Gegenstand zum Text.
gie insbesondere die Fähigkeit unterstützt, inhaltliche
Zusammenhänge zu bilden.
5. Schließlich stellen die Schülerinnen und Schüler
Wo findet man Material zu
Vorhersagen oder Hypothesen darüber an, wie die
sprachlichen Hilfen?
Handlung weitergehen könnte (narrative Texte) bzw. Informationen zu schreibdidaktischen Methoden und
welche Inhalte noch thematisiert werden (Sachtexte). sprachlichen Hilfen finden sich im Methodenpool für
Für die Sprachhandlungen Vermuten, (Weiter-)Erzäh- sprachsensiblen Fachunterricht des Mercator-Instituts
len und Begründen nutzen die Lernenden wiederum für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache unter
alle Sprachen, die ihnen zur Verfügung stehen. www.unterrichtsmethoden-sprachsensibel.de.
Dieses Verfahren wird für jeden Textabschnitt wiederholt,
bis alle Abschnitte gelesen wurden. Dabei können nach
Welche Vorbereitungen sind für das
jedem Abschnitt die Rollen in der Gruppe wechseln. Im
Mehrsprachige Reziproke Lesen nötig?
Anschluss sollte die Lehrkraft eine Kommunikationssi- Die Lehrkraft sollte die Texte entsprechend der fachlichen
tuation schaffen, in der es erforderlich ist, die Sprachen Unterrichtsziele auswählen und sie in sinnvolle Abschnit-
nicht mehr zu kombinieren, sondern die Standardsprache te einteilen. Es hat sich bewährt, verschiedene Texte zum
in der jeweiligen Zielsprache zu nutzen. Dieser Wech- gleichen Oberthema auszuwählen. So können im An-
sel vollzieht sich z. B., wenn die Kinder zunächst Texte schluss an die Methode unterschiedliche Perspektiven8 | Leseverstehen kennt keine Sprachgrenzen
Zweitrangig können aber auch weitere
Prinzipien und Kriterien eine Rolle spie-
len, wie etwa die fachlichen Fähigkeiten,
die Arbeitsweise, die sprachlichen Fähig-
keiten im Deutschen oder die Sympathie
der Lernenden untereinander.
García, Ibarra-Johnson & Seltzer (2017,
S. 63) geben folgende Empfehlung
für eine Pädagogik, die sich am Trans
languaging-Ansatz orientiert: Zusammen-
arbeiten sollten Lernende mit gleicher
Familiensprache, jedoch unterschied-
lichen fachlichen, allgemeinsprachlichen
und sprachenspezifischen Fähigkeiten in
der Unterrichtssprache. Damit ist inter-
Bild: BiSS-Trägerkonsortium/Ann
ette Etges
aktives und kooperatives Lernen in der
Zone der nächsten Entwicklung möglich,
d. h. in einem Bereich, in welchem Heraus-
auf ein Thema im Plenum präsentiert und diskutiert forderung und Unterstützung in einem angemessenen
werden — und die Lernenden haben einen Grund, genau Verhältnis zueinander stehen.
zuzuhören.
In diesem Rahmen kann die Lehrkraft auch das Niveau Literatur
der Texte entsprechend der sprachlichen und fachlichen Gantefort, C. & Sánchez Oroquieta, M. J. (2015). Translangua-
Fähigkeiten in den Gruppen differenzieren und ggf. in ging-Strategien im Sachunterricht der Primarstufe: Förderung
weiteren Sprachen zur Verfügung stellen. Lehrkräfte des Leseverstehens auf Basis der Gesamtsprachigkeit. Transfer
Forschung ↔ Schule, 1 (1), 24—37.
müssen grundsätzlich nicht selbst mehrsprachig sein,
um das Mehrsprachige Reziproke Lesen mit den Kindern García, O.; Ibarra-Johnson, S. & Seltzer, K. (2017). The
durchzuführen. Translanguaging classroom. Leveraging student bilingualism for
learning. Philadelphia: Caslon.
Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als Zweit-
Wie werden die Gruppen sprache (2019 ff.). Methodenpool für sprachsensiblen Unter-
zusammengesetzt? richt. Verfügbar unter: www.unterrichtsmethoden-sprachsensi-
bel.de [10.09.2019].
Bei der Planung und Durchführung des Mehrsprachigen
Rosenshine, B. & Meister, C. (1994). Reciprocal Teaching. A
Reziproken Lesens ist die Gruppenzusammensetzung Review of the Research. Review of Educational Research, 64
besonders wichtig. Die Interaktionen in den Kleingruppen (4), 479—530.
können nur gelingen, wenn Schülerinnen und Schüler mit
Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der
gleichen bzw. vergleichbaren Sprachenkonstellationen Länder in der Bundesrepublik Deutschland (2005). Beschlüs-
zusammenarbeiten (z. B. vier Lernende mit Deutsch/ se der Kultusministerkonferenz. Bildungsstandards im Fach
Türkisch in einer Gruppe oder auch zwei Lernende Deutsch für den Primarbereich. München: Wolters Kluwer.
mit der Sprachenkonstellation Deutsch/Türkisch und
zwei Lernende mit Deutsch/Spanisch in einer Gruppe).Experteninterview | 9
Experteninterview
„Die Kinder merken, dass sie sich in allen ihren
Sprachen den Text erschließen können.“
Christina Keppeler ist Lehrerin Wie sind Ihre Erfahrungen als Lehrkraft mit dem Mehr-
an der St. Nikolaus Grundschule sprachigen Reziproken Lesen? Kommen Sie damit gut
in Köln-Zollstock. Sie erarbeitet zurecht?
Konzepte für die Unterrichts-
praxis im Arbeitskreis „Koor- CK: Meiner Erfahrung nach benötigt man einige Zeit, um
dinierte Alphabetisierung im die Methode einzuüben. Wenn sie aber erst mal auto-
Anfangsunterricht“ (KOALA) und
matisiert ist, gibt es viel Variationsfreiheit, sodass die
nimmt mit ihrer Klasse an der
empirischen Erhebung „Koordi- Lehrkräfte sie in unterschiedlichen Fächern und für neue
nierte Entwicklung von Lese- und Textgattungen einbringen können. Auf diese Weise kann
Schreibfähigkeiten in Deutsch und
in der Herkunftssprache“ teil.
das Lesen fächerübergreifend in vielen Bereichen ge-
fördert werden.
Bild: privat
Ist es problematisch, die Methode durchzuführen,
wenn man als Lehrkraft die in der Klasse vorhandenen
Christoph Gantefort ist Leiter Sprachen nicht beherrscht?
der Abteilung „Sprache und
Profession“ am Mercator-Institut CK: Wenn es z. B. um Texte geht, die von der ganzen
für Sprachförderung und Deutsch Klasse gemeinsam gelesen werden sollen, so sind sie
als Zweitsprache und verantwor-
ohne die Kenntnis der Sprache nicht so einfach zu über-
tet an der Universität zu Köln das
Modul „Deutsch für Schülerinnen setzen. Manche Texte liegen aber schon in mehreren
und Schüler mit Zuwanderungs- Sprachen vor und können im Unterricht genutzt werden.
geschichte“. Zusammen mit
Dr. Ina-Maria Maahs hat er die
Gelegentlich kann man die Eltern bitten, einen Text für
Verbundarbeit zum mehrsprachi- das Kind in der Herkunftssprache zu übersetzen.
gen reziproken Lesen wissen- CG: Wir haben das Mehrsprachige Reziproke Lesen in
schaftlich begleitet.
Bild: privat
KOALA-Schulen erprobt, die insofern besonders sind, als
dort die Lehrkräfte über Sprachkenntnisse in Türkisch
verfügen. Grundsätzlich müssen die Lehrkräfte solche
Kenntnisse aber nicht mitbringen. Es geht ja darum,
dass die Kinder sich in allen ihnen verfügbaren Sprachen
zum Text austauschen. Der Text kann dann auch nur im
Deutschen vorliegen.
CK: Das ist richtig. In allen Phasen des Mehrsprachigen
Reziproken Lesens können sich die Kinder mithilfe ihrer
Sprachen den Inhalt des Lesetextes erarbeiten und sich
darüber austauschen. Und auch Anschlussaufgaben an
das Lesen, wie z. B. den Text in Rollen sprechen, ein
Plakat erstellen usw., können die Kinder in einer anderen
Sprache als Deutsch planen und beraten. Dazu muss die
Lehrkraft die Sprachen nicht beherrschen. Die Ergebnisse10 | Leseverstehen kennt keine Sprachgrenzen
der Anschlussaufgaben werden den anderen Gruppen im sprachlichen Mitteln und eignen sich dabei die Lesestra-
Plenum dann auf Deutsch präsentiert. Die Kinder merken tegien an. Der einzige Unterschied ist, dass sie einspra-
aber, dass sie sich in allen ihren Sprachen den Text er- chig interagieren. Und: Wenn im Unterricht Sprache im
schließen können. Allgemeinen oft zum Thema gemacht wird, z. B. durch
sprachvergleichendes Arbeiten, können auch die einspra-
Wie nehmen Ihrer Erfahrung nach die Kinder die chig deutschen Kinder ein metasprachliches Bewusstsein
Methode an? entwickeln.
CK: Der Großteil der Klasse arbeitet gerne mit der Me-
thode, da die Kinder gemeinsam einen Text erschließen Wenn eine Lehrkraft in ihrem Unterricht
und ggf. sogar ein gemeinsames Endprodukt erstellen. die Methode umsetzen möchte, worauf sollte
Schwächere Leser empfinden das Aufteilen des Textes sie besonders achten?
als entlastend, da alle beim Vorlesen leise mitlesen, um CG: Es ist wichtig, die Sprachen nicht zu trennen, z. B.
dann reihum zu übernehmen. Und wenn Anschlussauf indem den sowohl Deutsch als auch Türkisch alphabeti-
gaben frei gestaltet sind, können leistungsstärkere sierten Kindern der Eindruck vermittelt wird, sie sollten
Kinder ihr Potenzial zeigen. während des Mehr-
Und wie reagieren die Kinder auf die Sprachmischung?
sprachigen Reziproken
Lesens ausschließlich
s ist wichtig,
E
CK: Für die Kinder einer KOALA-Klasse ist es normal, dass Türkisch miteinander die Sprachen
sprechen. Deutsch ist
sie Sprachen mischen und dazu aufgefordert werden, die
häufig die stärkere
nicht zu trennen.
Herkunftssprache im Unterricht zu verwenden, da dort
von Anfang an mehrsprachige Bilderbücher zum Einsatz Sprache dieser Kinder
kommen, mehrsprachige Vorlesetage stattfinden usw. Die und somit könnten sie nicht ihr gesamtes sprachliches
Kinder verstehen meist schon in der 1. Klasse, dass dieses Repertoire für den Aufbau des Leseverstehens nutzen.
Kombinieren von Sprachen eine besondere Fähigkeit ist. Das soll ja gerade vermieden werden, wenn nach den
CG: Aus der Forschung wissen wir außerdem, dass Schü- Prinzipien des Translanguagings unterrichtet wird.
lerinnen und Schüler andere Sprachen als Deutsch im
Unterricht für genau dieselben Zwecke nutzen wie das Gibt es Nachweise darüber, ob und wie die Methode
wirkt?
Deutsche. Lehrkräfte brauchen also nicht zu befürchten,
dass andere Sprachen als Deutsch vor allem für unter- CG: Bislang liegen noch nicht alle Daten vollständig
richtsfernen Austausch genutzt werden. Ich denke, es vor. Die bisherigen Auswertungen zeigen aber, dass die
ist vor allem wichtig, eine Atmosphäre zu schaffen, in Kinder, die in der ersten von zwei Kohorten am Mehr-
der Lernende die Erfahrung machen, dass es völlig okay sprachigen Reziproken Lesen teilgenommen haben, in
ist, sich in den passenden Momenten auch in anderen der Tendenz höhere Zuwächse in der Lesekompetenz im
Sprachen als Deutsch auszutauschen. Lehrkräfte sollten Deutschen erzielen als die Kinder der Kontrollgruppe.
im Hinblick darauf ein Bewusstsein dafür fördern, in wel- Insbesondere im dritten Schuljahr fallen diese Effekte
chen Situationen es Sinn macht, Sprachen zu mischen, recht deutlich aus. Mit Blick auf den Verlauf der Ent-
und in welchen nicht. wicklung des Leseverstehens bis zum Ende des dritten
Schuljahres können wir z. B. beobachten, dass die Ent-
Können auch die einsprachig aufwachsenden Kinder von wicklung viel stärker von der Zugehörigkeit der Kinder
der Methode profitieren? zur Untersuchungsgruppe abhängt als davon, ob sie ein-
CG: Sie profitieren vom Mehrsprachigen Reziproken oder mehrsprachig aufwachsen.
Lesen genauso, wie es die mehrsprachigen Kinder tun:
Sie verständigen sich in einer Gruppe mit den geteilten Christina Keppeler | Christoph GantefortEinführung des Mehrsprachigen Reziproken Lesens in der Primarstufe | 11
Einführung des Mehrsprachigen Reziproken Lesens
in der Primarstufe
Orientierungshilfe für die Praxis
Hier zeigen wir im Detail, wie die Methode des Mehr- Um die Methode einzuführen, liegt der Fokus zu Beginn
sprachigen Reziproken Lesens in der Primarstufe ein- des ersten Schuljahres auf der koordinierten Alphabeti-
geführt werden kann. Den Empfehlungen liegen die sierung der Schülerinnen und Schüler in der deutschen
Erfahrungen aus dem Kölner BiSS-Verbund zugrunde, der und in der entsprechenden Herkunftssprache. Anschlie-
die Methode an KOALA-Schulen eingeführt und erprobt ßend trainieren die Kinder die Leseflüssigkeit in beiden
hat. Für jeden Schritt der Methode präsentieren wir auch Sprachen. Wichtig dabei ist, die Sprachen nicht als
Variationen für ein Setting in einsprachigen Bildungs- voneinander getrennte Konstrukte zu behandeln, die in
programmen, denn sofern mehrsprachige Kinder nur in unterschiedlichen Kontexten verortet sind, sondern allen
Deutsch alphabetisiert sind, stellt die Mündlichkeit die Sprachen Raum im Klassenzimmer zu geben und die
wesentliche Ressource dar. Um das Mehrsprachige Rezi- Schülerinnen und Schüler auch für ihre Kompetenzen in
proke Lesen in einsprachigen Bildungsprogrammen durch- weiteren Sprachen zu sensibilisieren.
zuführen, reicht es also aus, wenn die Kinder mündlich
eine andere Sprache beherrschen. Falls auch schrift-
sprachliche Fähigkeiten in der Familiensprache vorliegen, Zweisprachig lernen mit KOALA
bieten sich entsprechend viefältigere Möglichkeiten. Das Bildungsprogramm „Koordinierte Alphabetisie-
rung im Anfangsunterricht“ (KOALA) arbeitet nach
Eine mehrsprachige Alphabetisierung (wie in KOALA) dem didaktischen Prinzip des koordinierten zwei-
ist somit keine notwendige Bedingung für das Mehr- sprachigen Lernens. 30 Schulen im Regierungs-
sprachige Reziproke Lesen: Den Kern der Methode bildet bezirk Köln setzen KOALA seit 2003 um. Grund-
legend ist, dass Lehrkräfte des Regelunterrichts
schließlich die mehrsprachige mündliche Interaktion!
im Tandem mit Lehrkräften des herkunftssprach-
Abbildung 1 (vgl. S. 12) bietet einen Überblick über alle lichen Unterrichts (HSU) zusammenarbeiten. Das
grundsätzlichen Schritte. Unterrichtskonzept startet mit einer kontrastiven
Alphabetisierung in Deutsch und in der jeweiligen
Herkunftssprache. Eine Lauttabelle hilft dabei. Auch
Phase 1: Erste Schritte alle anderen in der Klasse vorhandenen Sprachen
werden durch sprachkontrastive Arbeit berücksich-
Die Lernenden müssen verstehen, dass sie all ihre
tigt und aktiv in den Unterricht einbezogen.
mehrsprachigen Kompetenzen nutzen können, um sich
fachliche Inhalte zu erschließen — nur dann kann Mehr- Die sprachliche Kontrastivarbeit steht im Zentrum.
Die Sprachvergleiche beziehen alle Sprachebenen
sprachiges Reziprokes Lesen sinnvoll eingesetzt werden.
(Laut, Wort, Satz, Text) sowie sprachliche Hand-
Es ist also Aufgabe der Lehrkräfte, den Schülerinnen
lungs- und Kommunikationssituationen ein. Ver-
und Schülern zu vermitteln, dass Sprachmischungen und schiedene sprachliche Phänomene, grammatische
-wechsel bei Interaktionen mit ihren Mitschülerinnen Regeln und Schriftsysteme werden mit den Lernen-
und Mitschülern nicht nur erlaubt, sondern gewünscht den erarbeitet. Dabei werden Gemeinsamkeiten und
sind und dem eigenen Lernen dienen. Die Schülerinnen Unterschiede herausgestellt. Dieser sprachkontras
tive Vergleich unterstützt eine mehrsprachige
und Schüler sollten daher explizit dazu ermutigt werden,
Entwicklung und ein metasprachliches Bewusstsein
alle ihnen zur Verfügung stehenden Sprachen zu nutzen,
(vgl. Bezirksregierung Köln, 2014).
um sich über die Fachinhalte auszutauschen.12 | Leseverstehen kennt keine Sprachgrenzen
Erste Schritte
½ ab der Mitte bzw. zum Ende des ersten Schuljahres
½ Öffnung des Unterrichts zur Mehrsprachigkeit: Heranführung der Schülerinnen und
Schüler an die Nutzung des gesamten Sprachrepertoires
1 ½ Anleitung systematischer Gruppenarbeit
½ Förderung der Leseflüssigkeit
½ wenn möglich: Vernetzung von herkunftssprachlichem Unterricht und Regelunterrricht
Einführung und Ritualisierung der Lesestrategien
½ mit Beginn des zweiten Schuljahres
½ Anwendung des Mehrsprachigen Reziproken Lesens und Modellierung der Strategien
im Plenum
2 ½ Ritualisierung von Abläufen zunächst im Plenum und anschließend in der Gruppenarbeit
½ Anknüpfung kleinerer Schreibanlässe
½ kontinuierliche Förderung der Leseflüssigkeit
½ wenn möglich: Umsetzung des Mehrsprachigen Reziproken Lesens im herkunftssprachlichen
Unterricht und Regelunterricht
Selbstständiges Erproben der Lesestrategien
½ mit Beginn des dritten Schuljahres
½ Anwendung des Mehrsprachigen Reziproken Lesens sowie Automatisierung der Strategien
in Kleingruppen bei kurzen Texten und beim Lesen einer Ganzschrift in mehreren Sprachen
3 ½ Angebot verschiedener Präsentationsmöglichkeiten sowie Abschlussaufgaben
½ kontinuierliche Förderung der Leseflüssigkeit
½ wenn möglich: Festigung der Strategien im herkunftssprachlichen Unterricht und im
Regelunterricht
Automatisierung und Transfer des Mehrsprachigen Reziproken Lesens
½ mit Beginn des vierten Schuljahres
½ selbstständige Anwendung der Strategien des Mehrsprachigen Reziproken Lesens in
Kleingruppen und Einzelarbeit zum Erschließen von komplexen Sachtexten
4 ½ Angebot verschiedener Präsentationsmöglichkeiten sowie Abschlussaufgaben
½ kontinuierliche Förderung der Leseflüssigkeit
½ fachübergreifende Nutzung der Lesestrategien, wenn möglich auch im herkunfts
sprachlichen Unterricht
Abbildung 1: Schrittweise Einführung der Methode im ÜberblickEinführung des Mehrsprachigen Reziproken Lesens in der Primarstufe | 13
Zum Ende des ersten Schuljahres lernen die Kinder die und dabei einzelne Wörter, ihre Bedeutung sowie unter-
systematische Gruppenarbeit kennen. Zunächst wird ihre schiedliche Schriftzeichen besprechen.
Fähigkeit zur Partnerarbeit geschult. Sind sie in der ... Sprachhilfen unter Nutzung von Online-Ressourcen
Lage, selbstständig in kooperativen Lernformaten zu oder vorhandener Expertise im Kollegium mehrsprachig
arbeiten, kann die Gruppe schrittweise vergrößert gestalten.
werden. Die Regeln dafür werden im Vorfeld mit den ... Rituale einführen, indem sie die Lernenden mehr
Schülerinnen und Schülern gemeinsam erarbeitet. Es sprachig begrüßen oder mit ihnen Lieder in weiteren
ist hilfreich, wenn die Regeln zusätzlich auf Plakate Sprachen singen, um sie zur Nutzung ihrer anderen
geschrieben und im Klassenraum aufgehängt werden — Sprachen zu motivieren.
im besten Fall mehrsprachig.
Phase 2: Lesestrategien einführen und
Lehrkräfte in einsprachigen ritualisieren
Bildungsprogrammen können ... Als Nächstes führen die Lehrkräfte die dem Konzept zu-
... die Kinder im Allgemeinen ermutigen, neben Deutsch grunde liegenden Lesestrategien ein. Dazu modellieren
auch ihre weiteren Sprachen zu nutzen. sie die Lesestrategien zunächst im Plenum über lautes
Denken sowie Visualisierungen und thematisieren erfor-
... den Schülerinnen und Schülern mehrsprachige Bildwör-
terbücher oder mehrsprachige Lauttabellen zur Verfügung derliche sprachliche Mittel. Danach werden die Lese
stellen. strategien kleinschrittig gemeinsam geübt.
... auf Basis eines Grundwissens über den Sprachbau der
beteiligten Sprachen sprachkontrastiv im Plenum arbeiten
Etges
Bild: BiSS-Trägerkonsortium/Annette14 | Leseverstehen kennt keine Sprachgrenzen
Wenn die Schülerinnen und Schüler die Lesestrategien 3. Beim Formulieren von Fragen an den Text
grundlegend verstanden haben, üben sie in Kleingruppen, geht es zunächst darum, einfache, sehr
diese selbstständig anzuwenden. Dazu übernimmt gezielte Fragen nach Einzelinformationen zu
entweder jedes Gruppenmitglied jeweils pro Abschnitt entwickeln, die direkt aus dem Text ent-
oder pro Text eine Strategie oder die Lernenden setzen nommen werden können: Wer? Was? Wann?
die Strategien alle gemeinsam um. Sprachmischungen Wo? Im Verlauf werden dann auch schwie-
und Sprachwechsel sind in dieser Phase erwünscht rigere Fragen formuliert. Sie können sich
und sinnvoll. Daraus ergibt sich in dieser Phase fol- z. B. auf den Zusammenhang zwischen zwei
gender Erwartungshorizont für die einzelnen Strategien benachbarten Sätzen beziehen oder auch
(vgl. Abbildung 2): auf den Inhalt eines ganzen Textabschnitts.
1. Vor dem lauten Vorlesen lesen die Schülerinnen und In der Erprobung hat sich gezeigt, dass
Schüler den Text ggf. leise für sich. Sollte ein Kind ein Quiz zum Abschluss motiviert und den
dabei etwas langsamer sein als der Rest der Gruppe, Kindern dabei hilft, kreative Fragen zu ent-
kann es vom anschließenden Vorlesen profitieren. wickeln.
Für das laute Vorlesen wird entweder eine Schülerin 4. Für das Zusammenfassen des Textes oder
oder ein Schüler mit bereits fortgeschrittenen eines einzelnen Abschnitts bieten sich
Lesefähigkeiten ausgewählt oder der Text wird von zwei mögliche Vorgehensweisen an: Eine
allen in der Gruppe abschnittsweise nacheinander Schülerin oder ein Schüler präsentiert
vorgelesen. Die Lernenden sollten dabei in der Lage eine erste Zusammenfassung, die dann
sein, den Text möglichst deutlich zu lesen, wenn von den anderen Gruppenmitgliedern
auch ggf. leicht stockend oder ohne bewusste ergänzt oder berichtigt wird, oder die
Betonung. Lernenden erarbeiten die Zusammen-
2. Beim Klären der schwierigen Textstellen und Wörter fassung gemeinsam. Die Kinder erzählen
erklären die Schülerinnen und Schüler einander die meist auf einfach strukturierte Weise
komplizierten Wörter und Passagen und erschließen nach.
sie sich. Bei der Klärung genügen einfache Umschrei 5. Auch beim Vorhersagen entwickelt entweder ein
bungen. einzelnes Kind Ideen, die die Gruppe anschließend
ergänzt, oder die Gruppe entwickelt die Ideen
direkt gemeinsam. Erfahrungsgemäß stellen
die Kinder zunächst eher unsystematisch
(Vor-)Lesen Vermutungen und Hypothesen zum weiteren
Verlauf des Textes auf.
Vorher- Wörter In dieser Phase können die Kinder auch
sagen klären kreative und vom Text abweichende Ideen
sammeln.
Es ist notwendig, dieses Vorgehen regel-
mäßig und mindestens alle zwei Wochen zu
Zusammen- Fragen wiederholen, damit sich die Lesestrategien
fassen stellen
nachhaltig festigen. Besonders geeignet
dafür sind illustrierte narrative Texte. Die
KOALA-Schulen stellen den Schülerinnen
Abbildung 2: Lesestrategien
und Schülern ein an ihren HerkunftssprachenEinführung des Mehrsprachigen Reziproken Lesens in der Primarstufe | 15
Bild: BiSS-Trägerkonsortium/Ann
ette Etges
orientiertes mehrsprachiges Textangebot zur Verfügung. anzustellen. Dieses Vorgehen bietet sich vor allem an,
Dieses Angebot motiviert die Lernenden dazu, ihre um die Bedeutung schwieriger oder unbekannter Wörter
zu klären. Dabei könnten die Kinder etwa bemerken,
mehrsprachigen Kompetenzen einzubringen.
dass das Wort Journalist aus dem Französischen stammt
(le jour = der Tag; le journal = die Zeitung/Zeitschrift;
le journaliste = der Journalist) und auch Einzug in weitere
Lehrkräfte in einsprachigen Sprachen gefunden hat (z. B. ins Deutsche, Englische oder
Bildungsprogrammen können ... Russische).
... Eltern, Verwandte oder Bekannte einbeziehen und sie
bitten, z. B. Auszüge aus Kinderbüchern in mehreren Spra-
chen bereitzustellen. Phase 3: Lesestrategien selbstständig
anwenden
... sprachliche Hilfen (z. B. Fragenfächer mit einem
Angebot an Fragewörtern) relativ einfach in andere Die Schülerinnen und Schüler sind nun mit den Lese-
Sprachen übersetzen und dann dauerhaft im Unterricht strategien vertraut. Diese müssen jedoch weiter vertieft
einsetzen. werden, damit die Lernenden sie eigenständig anwenden
... die Schülerinnen und Schüler dazu motivieren, sich können. In diesem Rahmen werden auch die Aufgaben im
mehrsprachig zu unterhalten und Sprachvergleiche Anschluss an das Mehrsprachige Reziproke Lesen variiert16 | Leseverstehen kennt keine Sprachgrenzen
Etges
Bild: BiSS-Trägerkonsortium/Annette
(z. B. Vorträge, Lernplakate, Quiz, Rollenspiele). Die verständigen und die Ergebnisse ihrer Zusammen-
Lehrkraft nimmt in dieser Phase eine eher moderierende arbeit hinterher für die anderen übersetzen. Entschei-
Rolle ein. dend ist immer, dass die Lehrkraft die Lernenden zu
diesem aktiven Einsatz ihrer Mehrsprachigkeit er-
Auch in diesem dritten Lernabschnitt ist es erwünscht, mutigt und sie in ihrer mehrsprachigen Entwicklung
dass die Schülerinnen und Schüler Deutsch und ihre unterstützt.
Herkunftssprache(n) verwenden. Die Lehrkraft reflektiert
dazu mit ihnen, in welchem Kontext welche Sprache Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich für diese Phase
oder welches sprachliche Register angemessen ist: Bei- literarische Ganzschriften besonders eignen. An den
spielsweise kann ein Rollenspiel in der Alltagssprache KOALA-Schulen wird dafür das ausgewählte Buch
realisiert werden, ein Lernplakat sollte hingegen in der sowohl im Regelunterricht als auch im herkunftssprach-
Bildungs- und Fachsprache präsentiert werden. Auch lichen Unterricht gelesen. Es steht projektartig drei
sollten Vorträge vor der gesamten Klasse in einer allen bis vier Wochen lang thematisch im Vordergrund des
Lernenden gemeinsamen Sprache gehalten werden, Unterrichtsgeschehens. Dadurch wird es möglich, die
damit alle sie verstehen. Dagegen können sich die Strategien des Mehrsprachigen Reziproken Lesens in
Lernenden in der Gruppenarbeit in anderen Sprachen einem neuen Kontext zu erproben. Außerdem motiviertEinführung des Mehrsprachigen Reziproken Lesens in der Primarstufe | 17
ein literarisches Werk die Schülerinnen und Schüler eher
Lehrkräfte in einsprachigen
zum Lesen als Sachtexte. Die intensive Arbeit mit einem Bildungsprogrammen können ...
literarischen Werk bietet zudem große Potenziale für di-
verse fachliche und kreative Anschlussaufgaben aus dem ... die Schülerinnen und Schüler weiterhin dazu an-
Spektrum der Methoden und Techniken aus dem hand- regen, alle ihnen zur Verfügung stehenden Sprachen zu
gebrauchen.
lungs- und produktionsorientierten Literaturunterricht.
Diese lassen nicht nur ein hohes Maß an Differenzierung ... ein Buch auswählen, das es in möglichst vielen von den
zu, sondern ermöglichen auch Anknüpfungspunkte an Schülerinnen und Schülern eingebrachten Sprachen gibt,
um Sprachvergleiche anzuregen.
andere Fächer.
... die Schülerinnen und Schüler dazu ermutigen, z. B.
Um Redundanzen zu vermeiden, ist die Lektüreeinheit im Lernplakate zwei- oder mehrsprachig zu erstellen. Die
Lernenden können dazu z. B. unter die deutschen Fach
Vorfeld genau zu planen: Welche Kapitel sollen mehr-
begriffe die Begriffe in weiteren Sprachen in anderen
sprachig reziprok im Regelunterricht gelesen werden?
Farben notieren. Im Plenumsgespräch können daraufhin
Welche Textabschnitte sollen die Lernenden eigenständig Wortverwandtschaften thematisiert werden.
zu Hause oder als Teil der Lernplanarbeit vorbereiten?
Welche Kapitel bieten sich an, um sie im HSU im rezi
Phase 4: Lesestrategien automatisieren
proken Leseverfahren zu behandeln?
und übertragen
Während dieser Umsetzungsphase wird von den Durch die Methode des Mehrsprachigen Reziproken
Schülerinnen und Schülern ein zunehmend höheres Lesens sollten die Schülerinnen und Schüler zum Ende
Abstraktionsniveau erwartet. Konkret bedeutet das für der Primarstufe in der Lage sein, Lesestrategien auto-
die einzelnen Strategien: matisch und selbstständig zu nutzen, um sich gemein-
1. Das Vorlesen meistern die Kinder in dieser Phase sam komplexe (Sach-)Texte durch den Austausch in
bereits routiniert und deutlich flüssiger als in der verschiedenen Sprachen zu erschließen. Die Lernenden
Einführungsphase. Die Lehrkraft motiviert die wenden in dieser Phase die Lesestrategien frei an, um
Schülerinnen und Schüler verstärkt zu einer betonten herausfordernde Lesetexte bzw. -aufgaben zu bearbei-
Leseweise. ten — im Deutsch- genauso wie im Sachfachunterricht
2. Die Lernenden klären die schwierigen Textstellen und oder im HSU. Dafür üben die Lernenden einzelne Stra-
Wörter nun nicht mehr mit einfachen Umschreibun- tegien gezielt ein. Die Lehrkräfte stellen ihnen externe
gen, sondern entwickeln begründete Erklärungen und Quellen wie Lexika oder Internetseiten zur Verfügung.
stellen Zusammenhänge heraus. Damit können die Lernenden schwierige Begriffe klären.
3. Auch die Fragen, die die Schülerinnen und Schüler Außerdem sollten sich die Texte der Anschlussaufgaben
entwickeln, erreichen in dieser Phase schrittweise ein im Sinne der Lernprogression an einen zunehmend
höheres Niveau: Die Kinder formulieren nun Fragen abstrakteren Adressatenkreis richten. Denkbar sind
nach Zusammenhängen, Gründen und Ursachen (z. B. z. B. Verarbeitungen der erarbeiteten Inhalte in Leser-
Warum- und Wie-Fragen oder auch Fragen, die eine briefen, Artikeln für die Schulhomepage oder Erklär
eigene Stellungnahme erfordern). videos.
4. Beim Zusammenfassen geht es nicht mehr nur darum,
einfach nachzuerzählen. Vielmehr sollen die Schüle In dieser Phase sollten die Lernenden nicht mehr einzel-
rinnen und Schüler eigenständig die wesentlichen ne Strategien nach einem festgelegten Ablauf anwen-
Ereignisse und Inhalte kurz und knapp wiedergeben. den. Sie sollen stattdessen die Strategien flexibel und
5. Anstatt frei spekulierend vorherzusagen, begründen unaufgefordert nutzen und dabei ihr gesamtsprachliches
die Lernenden ihre Vermutungen. Repertoire einbeziehen.18 | Leseverstehen kennt keine Sprachgrenzen
Die am Programm beteiligten KOALA-Schulen haben zu einer Kontrollgruppe beim Leseverstehen deutlichere
Anreize entwickelt, die die Schülerinnen und Schüler Fortschritte, wenn sie im Unterricht mehrsprachig
dazu motivieren, alle ihnen zur Verfügung stehen- reziprok lasen und die Lehrkräfte direkt an der Konzept-
den Sprachen zu nutzen und Sprachvergleiche anzu- entwicklung beteiligt waren. Dieser Effekt zeigte sich
stellen. Zum Beispiel gibt es eine Auszeichnung für die sowohl für die einsprachigen als auch für die mehrspra-
Gruppe, die in ihre Erklärungen die meisten Sprachen chigen Schülerinnen und Schüler. Insgesamt profitierten
einbezieht. Auch kleine Wettbewerbe zwischen den die Lernenden jedoch nicht nur auf Ebene der Lesekom-
Gruppen finden statt: Wer formuliert die spannendste petenz. Sie lernten darüber hinaus, all ihre sprachlichen
Frage, die treffendste Zusammenfassung oder die krea- Fähigkeiten im Unterricht bewusst zu nutzen. In den
tivste Vorhersage? Die motivierenden Anreize dienen Klassenzimmern entwickelte sich ein neues Bewusst-
dazu, das metasprachliche Bewusstsein langfristig zu sein für sprachliche Vielfalt und eine selbstverständliche
fördern. Wertschätzung von Mehrsprachigkeit.
Lehrkräfte in einsprachigen
Literatur
Bildungsprogrammen können ...
Bezirksregierung Köln (Hrsg.). (2014). KOALA. Koordinierte
... den Schülerinnen und Schülern mehrsprachige Wörter- Alphabetisierung im Anfangsunterricht. Das KOALA-Konzept
bücher oder ggf. kinderorientierte Online-Lexika bereit an Kölner Schulen (vorläufiges Exemplar). Verfügbar unter:
stellen. https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/publikationen/
abteilung04/pub_abteilung_04_KOALA.pdf. [12.08.2019].
... die Schülerinnen und Schüler dazu ermuntern, sich
Notizen in weiteren Sprachen ihres Gesamtrepertoires zu
machen, auf deren Grundlage sie ihre Vermutungen
begründen können.
... die Lernenden dazu auffordern, einen zwei- oder mehr-
sprachigen Text für eine mehrsprachige Leserschaft zu
gestalten.
... im Anschluss die Texte mit Blick auf ähnliche Begriffe
in der Fachsprache, grammatische Strukturen oder Text-
muster vergleichen.
Die Methode hat Potenzial
Dem BiSS-Verbund ist es in fünf Jahren gemeinsa-
mer Arbeit gelungen, ein mehrsprachiges Konzept zur
Förderung des Leseverstehens zu entwickeln und zu
erproben. Dabei wurde die Methode in Absprache mit
den beteiligten Lehrkräften, mit der Verbundkoordination
und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern immer
wieder an die jeweiligen Bedingungen vor Ort angepasst
und weiterentwickelt.
Die Erprobung der Methode war ein Erfolg: Besonders
im dritten Schuljahr machten die Kinder im Vergleich| 19
ortium/Annette Etges
Bild: BiSS-Trägerkons
Weiterlesen
Bezirksregierung Köln (Hrsg.). (2014). KOALA. Koordinierte Alphabetisierung
im Anfangsunterricht. Das KOALA-Konzept an Kölner Schulen (vorläufiges
Exemplar). Verfügbar unter: https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/
publikationen/abteilung04/pub_abteilung_04_KOALA.pdf. [12.08.2019].
BiSS-Trägerkonsortium (Hrsg.). (2016). Durchgängige Leseförderung. Über-
blick, Analysen und Handlungsempfehlungen. Köln: Mercator-Institut für
Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache.
Celic, C. & Seltzer, K. (2011). Translanguaging: A CUNY-NYSIEB Guide for
Educators. Verfügbar unter: https://www.cuny-nysieb.org/wp-content/
uploads/2016/04/Translanguaging-Guide-March-2013.pdf [12.08.2019].
Gantefort, C. & Sánchez Oroquieta, M. J. (2015). Translanguaging-Strategien
im Sachunterricht der Primarstufe: Förderung des Leseverstehens auf Basis
der Gesamtsprachigkeit. Transfer Forschung ↔ Schule, 1 (1), S. 24—37.
Krifka, M.; Błaszczak, J.; Leßmöllmann, A.; Meinunger, A.; Stiebels, B.; Tracy,
R. & Truckenbrodt, H. (Hrsg.). (2014). Das mehrsprachige Klassenzimmer:
Über die Muttersprachen unserer Schüler. Berlin, Heidelberg: Springer.
Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache
(2019 ff.). Methodenpool für sprachsensiblen Unterricht.
Verfügbar unter: www.unterrichtsmethoden-sprachsensibel.de [10.09.2019].
Schader, B. (2012). Sprachenvielfalt als Chance: Handbuch für den Unter-
richt in mehrsprachigen Klassen. Zürich: Orell Füssli.Impressum
Herausgeber Redaktion
BiSS-Trägerkonsortium Monika Socha (verantwortlich),
Mercator-Institut für Sprachförderung und Karin Vogelsberg
Deutsch als Zweitsprache
Universität zu Köln, Triforum Mitarbeit
Albertus-Magnus-Platz Dorothee Schmitz
50923 Köln
Titelbild
kontakt@biss-sprachbildung.de BiSS-Trägerkonsortium/Annette Etges
0221 470-2013
biss-sprachbildung.de Gestaltung
wbv Media, Bielefeld/Sabine Ernat
Creative-Commons-Lizenzen
Die Beiträge dieser Publikation sind unter verschiedenen, Gesamtherstellung
jeweils unter den Beiträgen stehenden, CC-Lizenzen wbv Publikationen, ein Geschäftsbereich von wbv Media
veröffentlicht. Die generellen Lizenzbedingungen sind GmbH & Co. KG, Bielefeld 2020, wbv.de
nachzulesen unter: https://creativecommons.org/licenses.
Zitiervorschlag
BiSS-Trägerkonsortium (Hrsg.). (2020). Leseverstehen
kennt keine Sprachgrenzen. Kooperativ und mehr
sprachig Texte verstehen. Köln: Mercator-Institut für
Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache.
DOI: 10.3278/6004772w
Autorinnen und Autoren
Gülten Corlu, Ayca Ekinci, Christoph Gantefort,
Anna Geißelbach, Margarete Heeren, Doris Jacobs,
Christina Keppeler, Sarina Kluge, Ina-Maria Maahs,
Brigitte Mangasser, Anke Moch, Sema Mutlu,
Köksal Ozan, Barbara Riewenherm, María José Sánchez
Oroquieta, Constanze Strack, Christina WinterBiSS-Trägerkonsortium:
Sie können auch lesen