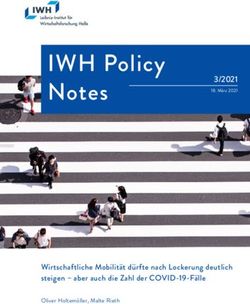Schengen-Raum Johannes Kohls
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Schengen-Raum
Johannes Kohls
Zusammenfassung
Der Schengen-Raum gilt als einer der wichtigsten Meilensteine im europäischen
Integrationsprozess, existierte jedoch bis zum Inkrafttreten des Vertrags von
Amsterdam am 1. Mai 1999 außerhalb des Rechtsrahmens der Europäischen
Union. Er basiert auf dem Schengener Übereinkommen (1985), das dem Ziel
diente, den Verkehr von Gütern, Dienstleistungen und Personen innerhalb der
europäischen Grenzen zu erleichtern. Mit der Unterzeichnung des Schengener
Durchführungsübereinkommens am 19. Juni 1990 wurden die Binnengrenzkon-
trollen zwischen den Schengen-Staaten endgültig aufgehoben und die Kontrollen
an den Außengrenzen (zwischen einem Schengen- und einem Nicht-Schengen-
Staat) verstärkt. Heute umfasst der Schengen-Raum 26 europäische Staaten. Die
Entscheidungskrise im Gemeinsamen Europäischen Asylsystem in den Jahren
2015 und 2016 offenbarte grundlegende Gestaltungsfehler und damit den
Reformbedarf des Schengen-Systems.
Schlüsselwörter
Außengrenzen · Binnengrenzen · Grenzkontrollen · Personenfreizügigkeit ·
Schengener Durchführungsübereinkommen · Schengener Übereinkommen
Vertragsgrundlage: Protokoll (Nr. 19) über den in den Rahmen der Europä-
ischen Union einbezogenen Schengen-Besitzstand
(Fortsetzung)
J. Kohls (*)
Institut für Europäische Politik, Berlin, Deutschland
E-Mail: Johannes.Kohls@iep-berlin.de
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019 1
W. Weidenfeld et al. (Hrsg.), Europa von A bis Z,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-24456-9_104-12 J. Kohls
Ziele: Erleichterung der Personenfreizügigkeit und des Verkehrs von Gü-
tern und Dienstleistungen, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung
Instrumente: Aufhebung der Binnengrenzkontrollen, Verstärkung der
Kontrollen an den gemeinsamen Außengrenzen, Vereinheitlichung der Aus-
stellungsverfahren von Visa, Einrichtung des Schengener Informationssys-
tems
Internet: Europäische Kommission: https://ec.europa.eu/home-affairs/
what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen_en, https://ec.europa.eu/
home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen-information-
system_en; Frontex: https://frontex.europa.eu/
Die Kernidee und die Gründung des Schengen-Raums
Bereits im Jahr 1984 einigten sich Frankreich und Deutschland auf eine intergou-
vernementale Initiative, welche die Grenzkontrollen zwischen den beiden Staaten
aufheben sollte. Am 14. Juni 1985 unterzeichneten Frankreich und Deutschland
schließlich mit den Benelux-Staaten ein entsprechendes Abkommen in Schengen
(Luxemburg), das Schengener Übereinkommen. Dieses formulierte ambitionierte
Ziele zum schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen, um
den BürgerInnen der fünf Staaten Freizügigkeit im Schengen-Raum zu ermöglichen.
Zudem sollten durch grenzüberschreitende Kooperation der Polizeiarbeit die öffent-
liche Ordnung und Sicherheit garantiert sowie der Drogenhandel und die illegale
Immigration bekämpft werden.
Das Schengener Durchführungsübereinkommen
Am 19. Juni 1990 wurde das Übereinkommen zur Durchführung des Übereinkom-
mens von Schengen (Schengener Durchführungsübereinkommen) unterzeichnet, in
dem die endgültige Aufhebung der Binnengrenzkontrollen beschlossen wurde. Im
Gegenzug wurden die Kontrollen an den Außengrenzen verstärkt, das Verfahren zur
Ausstellung von Visa vereinheitlicht sowie das Schengener Informationssystem
(SIS) eingeführt, um einen einheitlichen Raum der Sicherheit und des Rechts zu
garantieren. Das SIS wie auch der Nachfolger SIS II registrieren v. a. zu Fahndungs-
zwecken Personen- und Sachdaten für alle Strafverfolgungsbehörden im gesamten
Schengen-Raum. Dies betrifft u. a. Informationen über an schweren Verbrechen
mutmaßlich Beteiligte, aber auch Vermisstenausschreibungen. Darüber hinaus wur-
den die polizeiliche Kooperation an den Binnengrenzen sowie das gemeinsame
Vorgehen gegen den Drogenhandel verbessert. Das Durchführungsübereinkommen
trat am 1. September 1993 in Kraft. Allerdings wurde der Schengen-Raum erst am
26. März 1995 Wirklichkeit, als alle rechtlichen und technischen VoraussetzungenSchengen-Raum 3 für die praktische Anwendung (z. B. Einrichtung von Datenbanken und Daten- schutzbehörden) geschaffen waren. Die territoriale Erweiterung des Schengen-Raums Der Schengen-Raum wurde nach dem Inkrafttreten des Durchführungsübereinkom- mens beträchtlich erweitert. Bereits am 26. Februar 1992 hatte Spanien das Durch- führungsübereinkommen ratifiziert, Portugal folgte am 25. November 1993. Bis 2007 traten mit Dänemark, Estland, Finnland, Griechenland, Italien, Lettland, Litauen, Malta, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spa- nien, der Tschechischen Republik und Ungarn 17 weitere EU-Mitgliedstaaten dem Schengen-Raum bei. Während die EU-Mitgliedstaaten Bulgarien, Großbritannien, Irland, Kroatien, Rumänien und Zypern nicht Teil des Schengen-Raumes sind, gehören mit Liechtenstein, Island, Norwegen und der Schweiz vier Nicht-EU- Staaten dazu, sodass der Schengen-Raum insgesamt aus 26 Staaten besteht. Der Beitritt Islands und Norwegens geht auf die bereits 1954 geschlossene Nordische Passunion zurück, die u. a. die Abschaffung der Binnengrenzkontrollen für Däne- mark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden vorsieht. Bulgarien, Kroatien und Rumänien fordern seit ihrem EU-Beitritt die Aufnahme in den Schengen-Raum, allerdings wird diese aufgrund sicherheitspolitischer Bedenken seit Jahren verscho- ben. Die territoriale Erweiterung zeigt, dass der Schengen-Raum ein Prototyp der differenzierten Integration ist, bei dem einzelne Mitgliedstaaten der EU außerhalb der Verträge vorangehen und anschließend eine Aufnahme des Rechtsbestandes in die EU-Verträge sowie der Beitritt (fast) aller Mitgliedstaaten folgen. Inhaltliche Ausweitung und aktuelle Rechtslage Mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam am 1. Mai 1999 wurde der Schengen-Besitzstand in den Vertrag über die Europäische Gemeinschaft eingeglie- dert. Im Zuge der EU-Osterweiterung 2004 wurde die Gründung der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) beschlossen, um den Außen- grenzschutz effektiver zu gestalten. Mit den Erweiterungen bis 2007 gewann dieser weiter an Bedeutung. So ist in Art. 3 Abs. 2 des Vertrages über die Europäische Union der freie Personenverkehr festgelegt, allerdings mit explizitem Verweis auf geeignete Maßnahmen der Kontrolle an den Außengrenzen. In den folgenden Jahren deutete sich sodann eine Einschränkung des freien Personenverkehrs im Schengen- Raum an. Mit dem Ausbruch der tunesischen Jasmin-Revolution im Februar 2011 reisten vermehrt tunesische Geflüchtete über das Mittelmeer vor allem nach Italien und Malta. Der Umgang mit diesen sorgte im April und Mai 2011 für Konfliktpo- tenzial zwischen den europäischen Mitgliedstaaten. Daher entschloss sich eine Mehrheit der EU-InnenministerInnen auf einer Sondersitzung am 12. Mai 2011 dazu, das Schengener Übereinkommen zu flexibilisieren und damit eine zeitlich begrenzte Wiedereinführung von Kontrollen an den EU-Binnengrenzen zu ermög-
4 J. Kohls lichen. Seitdem erleichtern verschiedene Verordnungen die temporäre Wiederein- führung von Binnengrenzkontrollen. Insbesondere die Verordnung (EU) 2016/399 erlaubt einem Mitgliedstaat bei außergewöhnlichen Umständen zum Schutz der inneren Sicherheit die Wiedereinführung von Binnengrenzkontrollen für einen begrenzten Zeitraum (Schengener Grenzkodex). Dieser Zeitraum kann sich von 30 Tagen bis zu einer Höchstdauer von zwei Jahren erstrecken. Aktuelle Entwicklungen und Ausblick Die Entscheidungskrise im Gemeinsamen Europäischen Asylsystem (GEAS) in den Jahren 2015 und 2016 ging u. a. auf Gestaltungsfehler des Schengen-Systems zurück. Die 2013 in Kraft getretene Verordnung (EU) 604/2013 (Dublin-III-Verord- nung) stellt dabei ein zentrales Instrument des GEAS dar und legt die Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaates fest, der für die Prüfung eines Asylantrags zuständig ist. Das Grundprinzip des Dublin-Verfahrens besagt, dass die Zuständigkeit bei demjenigen Mitgliedstaat liegt, über den der oder die Asylsu- chende zuerst den Schengen-Raum betreten hat. In der Praxis bedeutet dies, dass lediglich wenige Mitgliedstaaten an den Außengrenzen des Schengen-Raums für die weitaus meisten Asylanträge zuständig sind. So fehlt es dem Schengen-Raum bis heute an Mechanismen zur Absicherung gegen das Risiko eines plötzlichen Anstiegs der Flüchtlingszahlen, der die Kapazitäten eines Mitgliedstaates an der Außengrenze übersteigt. Diese Defizite bedrohen die Existenz des Schengen-Raums, insbesondere da aktuell mit Dänemark, Deutschland, Frankreich, Norwegen, Österreich und Schweden sechs Schengen-Staaten temporäre Binnengrenzkontrollen durchführen. In Deutschland wurden diese zuletzt abermals bis zum 12. Mai 2020 verlängert. Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments kritisierten im Mai 2018 diese Binnen- grenzkontrollen, die sie angesichts ihrer Dauer, Notwendigkeit und Verhältnismä- ßigkeit als unrechtmäßig einschätzten. Der EU-Kommissar für Migration, Inneres und Bürgerschaft, Dimitris Avramopoulos, forderte Ende Dezember 2018 ebenfalls die vollständige Aufhebung der vorübergehenden Binnengrenzkontrollen. Anstelle dieser den Schengen-Raum gefährdenden Maßnahmen fordern die Abgeordneten des Europäischen Parlaments u. a. eine Reform des SIS, welche die Mitgliedstaaten zum Austausch von Informationen über Rückkehrentscheidungen verpflichten soll. Die Forderung des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron im März 2019 nach einer weitgehenden Reform des Schengen-Raums, u. a. mit dem Ziel einer gemeinsamen Grenzpolizei, einer europäischen Asylbehörde und eines Euro- päischen Rats für innere Sicherheit, spiegelt dabei die komplexe Interessenlage innerhalb der EU wider.
Schengen-Raum 5 Weiterführende Literatur und Dokumente Ademmer, Esther/Barsbai, Toman/Lücke, Matthias/Stöhr, Tobias (2015): 30 Years of Schengen: Internal blessing, external curse?, Kiel Institute for the World Economy: Kiel Policy Brief Nr. 88. Felbermayr, Gabriel/Gröschl, Jasmin/Steinwachs, Thomas (2018): The Trade Effects of Border Controls. Evidence from the European Schengen Agreement, in: Journal of Common Market Studies, Jg. 56, Nr. 2, S. 335–351. Pudlat, Andreas (2011): Der lange Weg zum Schengen-Raum. Ein Prozess im Vier-Phasen-Modell, in: Journal of European Integration History, Jg. 17, Nr. 2, S. 303–326. Übereinkommen zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 zwischen den Regierungen der Staaten der Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrol- len an den gemeinsamen Grenzen, in: Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, Nr. L 239 vom 22. September 2000, S. 19–62. Übereinkommen zwischen den Regierungen der Staaten der Benelux-Wirtschaftsunion, der Bun- desrepublik Deutschland und der Französischen Republik betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen, in: Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, Nr. L 239 vom 22. September 2000, S. 13–18.
Sie können auch lesen