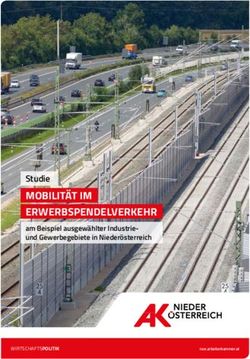Arbeitsbelastung und Gesundheit im privaten Sicherheitsgewerbe - Universität Innsbruck
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck
Institut für Psychologie
Dissertation
Zur Erlangung des akademischen Grades „Doctor of Philosophy“ (PhD)
Arbeitsbelastung und Gesundheit im privaten
Sicherheitsgewerbe
eingereicht bei
Univ.-Prof. Dr. phil. habil. Jürgen Glaser, Dipl.-Psych.
eingereicht von
Alexander Herrmann, BSc BA MSc
Innsbruck, 2021i
Vorwort - Danksagungen
Als ich 2010 neben dem Hochschulstudium zufällig über die Nebentätigkeit des „Türstehers“ -
und bald erste Einsätze im Veranstaltungsschutz - in das private Sicherheitsgewerbe
hineinschnupperte, war für mich klar, dass dies nur eine zweckmäßige Beziehung für einen
kurzen Zeitraum darstellen würde.
Niemals hätte ich gedacht, dass ich 11 Jahre später eine Dissertation im Fokus dieses
Tätigkeitsfeldes verfasse und auf einen mittlerweile reichen Erfahrungsschatz unterschiedlicher
Sicherheitstätigkeiten, eigener Schulungs- und Ausbildungstätigkeit, Vorträge, Verbandsarbeit
sowie der Organisation und dem Management bei nationalen und internationaler
Großsportveranstaltungen zurückblicken darf. Es ist wohl überflüssig zu erwähnen, dass mich
das Tätigkeitsfeld der privaten Sicherheit und seiner Beschäftigten so nachhaltig und prägend
in seinen Bann gezogen hat, dass ich mich auch als Nachwuchswissenschaftler unbedingt dieser
Branche widmen will.
Im vergangenen Jahrzehnt konnte ich so aus unterschiedlichen Perspektiven ein dynamisches
und facettenreiches Arbeitsfeld erfahren, dass oft zu Unrecht mit negativen Zuschreibungen
und Rollenbildern behaftet ist. Ich konnte viele Kolleg*innen kennenlernen, mit diesen
zusammenarbeiten und Freundschaften zu Menschen knüpfen, die mit Herzblut und
Leidenschaft dieser Tätigkeit nachgehen und trotz bestehender Problematiken unermüdlich an
einer positiven Entwicklung der privaten Sicherheit und für die Überwindung veralteter
Klischees arbeiten.
Die private Sicherheit verkörpert für mich als Psychologen eine der spannendsten
Dienstleistungen unserer Zeit, in dessen Zentrum der Mensch mit seinem Verhalten und
Erleben in ganz einzigartiger Weise mit seinem Grundbedürfnis nach Sicherheit und Ordnung
verbunden steht. Daher freue ich mich ganz besonders, wenn die vorliegende Arbeit einen
wissenschaftlichen Beitrag für die positive Entwicklung der privaten Sicherheit und ihrer
Beschäftigten leisten kann.
Diese Dissertationsschrift spiegelt aber nicht nur einen persönlichen Meilenstein wider, sondern
die unermüdliche Arbeit mit - und Unterstützung durch - weitere Personen, allen voran meiner
Familie und Kolleg*innen, denen ich zu aufrichtigem Dank verpflichtet bin.
Mein besonderer Dank gilt daher meinen Eltern für die immerwährende Unterstützung, meiner
Frau und meinen Kindern für die Liebe, Geduld und Rückendeckung, insbesondere in
arbeitsreichen und turbulenten Phasen, meinem Doktorvater Prof. Dr. Jürgen Glaser für das
„geschenkte“ Vertrauen, die hervorragende Betreuung und wissenschaftliche Mentoring der
vergangenen Jahre - auch über das wissenschaftliche Arbeiten hinaus, meinen Kolleg*innen
(und Mitautoren) Dr. Christian Seubert, Dr. Lisa Hopfgartner, Dr. Cornelia Strecker, Dr. Willi
Geser, Dr. Severin Hornung und Maga. Laura Leonhartsberger-Schrott für ihren „seelischen
Beistand“ und ihre Expertisen in allen Lebens-/ und Arbeitslagen, Prof. Dr. Tobias Greitemeyer
für meine aktuelle Anstellung sowie allen Kolleg*innen und Freunden in und um die private
Sicherheit die ich auf meinem Weg bisher kennenlernen durfte.
Mein Dank gilt auch dem Vizerektorat für Forschung der Universität Innsbruck für die
Verleihung eines Doktoratsstipendiums aus der Nachwuchsförderung sowie den Fördergebern
des Projekts (AB-G15) Arbeiterkammer (AK Wien) und Gewerkschaft Vida.ii Abstract Based on an Austrian-German pilot project, this dissertation provides the first systematic, occupational psychology-based work- and task analysis towards stressors and health as previously unconsidered factors for industry-specific problems among German-speaking (private) security personnel (N = 683). Against the background of human-oriented and health- promoting work concepts, basic work characteristics (predictor sets) were examined concerning their connection with psychosomatic health impairments and turnover intention. Study 1 provides a quantified perspective of occupational conditions, forms of violence and aggression as well as psychosocial work characteristics and their associations with psychosomatic complaints. A more in-depth examination of work-related violence and aggression, as well as person- and job-related risk factors, identifies private security guards as a high-risk population for harmful behaviors by organizational outsiders (Types I & II). Study 2 thus uses a subsample (N = 487) to examine the negative impact process of specific forms of outsider-initiated violent and aggressive experiences to be mediated by worries about violence. The developed mediation model provides first empirical evidence for a sequential impact process from worries about violence, nourished by different forms of harmful experiences, via psychosomatic complaints to turnover intention. Finally, Study 3 uses an online experiment with the general population (N = 932) to gain evidence that work clothing of private security guards (as a specific occupational condition) influences attributes and behavioral intentions in interactions with private security guards, thus displaying another potential influencing factor for the intensity and frequency of, e.g., work-related experiences of aggression. Finally, the integration of our collected findings from different sets of work characteristics (employment conditions, forms of work-related violence & aggression, psychosocial work characteristics) displays "adjusting screws" and suggestions for implementing a more health- promoting, human-oriented work (re)-design in the German-speaking security industry in order to tackle industry-immanent challenges.
iii Zusammenfassung Auf Basis eines österreichisch-deutschen Pilotprojektes liefert die vorliegende Dissertation eine erste systematische, arbeitspsychologisch fundierte Tätigkeitsanalyse mit Blick auf die Arbeitsbelastung und Gesundheit bei deutschsprachigem (privatem) Sicherheitspersonal (N = 683) als bisher unberücksichtigte Faktoren für branchenspezifische Problemstellungen. Vor dem Hintergrund humanorientierter und gesundheitsförderlicher Arbeitskonzeptionen wurden grundlegende Merkmalsgruppen hinsichtlich ihres Zusammenhangs mit psychosomatischen Gesundheitsbeeinträchtigungen und Kündigungsabsicht untersucht und entsprechende Risikofaktoren identifiziert. Studie 1 liefert dazu zunächst ein quantifiziertes Tätigkeitsprofil zu Beschäftigungsbedingungen, Formen von Gewalt- und Aggressionserfahrungen sowie psychosozialen Tätigkeitsmerkmalen und Zusammenhängen mit psychosomatischen Beschwerden. Eine weiterführende Betrachtung arbeitsbezogener Gewalt- und Aggression sowie personen- und tätigkeitsbezogener Risikofaktoren identifiziert privates Sicherheitspersonal als Hochrisikogruppe für schädigendes Verhalten von organisationalen Außenseitern (Typ I & II). In Studie 2 wird auf Basis einer Teilstichprobe (N = 487) ein, durch Gewaltbesorgnis vermittelter, negativer Wirkungsprozess von spezifischen Formen von Gewalt- und Aggressionserfahrungen untersucht. In unserem selbstständig weiterentwickelten Mediationsmodell finden sich erstmals empirische Hinweise für einen sequentiellen Wirkungsprozess von, durch unterschiedliche Aggressionsformen genährter, Gewaltbesorgnis über psychosomatische Beschwerden bis hin zu Kündigungsabsicht. Abschließend liefert Studie 3 durch ein sozialpsychologisch orientiertes online-Experiment mit der Allgemeinbevölkerung (N = 932) Hinweise, dass uniforme Arbeitskleidung von privatem Sicherheitspersonal (als eine spezifische Beschäftigungsbedingung) einen Einfluss auf zugeschriebene Attribute und Verhaltensintentionen in der Interaktion mit privaten Sicherheitskräften und damit einen potentiellen Einflussfaktor für die Intensität und Häufigkeit von z. B. arbeitsbezogenen Aggressionserfahrungen darstellt. Durch Integration der gesammelten Befunde aus den drei Merkmalsgruppen (Beschäftigungsbedingungen, Formen arbeitsbezogener Gewalt & Aggression, psychosozialer Tätigkeitsmerkmale) ergeben sich somit konkrete „Stellschrauben“ und Gestaltungsvorschläge für eine gesundheitsförderlichere, humanorientierte Arbeitsgestaltung im deutschsprachigen Sicherheitsgewerbe im Hinblick auf branchen-immanente Herausforderungen.
iv
Der Dissertation beigefügte Publikationen
Herrmann, A. & Glaser, J. (2021). Work characteristics and psychosomatic health complaints
of private security personnel. Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie
A&O, 65(2), 53-67.
Herrmann, A., Seubert, C. & Glaser, J. (2018). Arbeitsbezogene Gewalt bei privatem
Sicherheitspersonal: Wer ist besonders gefährdet und was ist der Preis? In R. Trimpop,
J. Kampe, M. Bald, I. Seliger & G. Effenberger (Hrsg.), Psychologie der
Arbeitssicherheit und Gesundheit. Voneinander lernen und miteinander Zukunft
gestalten (S. 565-569). Kröning, D: Asanger.
Herrmann, A., Seubert, C. & Glaser, J. (2020). Consequences of exposure to violence,
aggression and sexual harassment in private security work: A mediation model. Journal
of Interpersonal Violence. https://doi.org/10.1177/0886260520984432 [Advanced
Online Publication]
Herrmann, A. & Geser, W. (2021). Psychological responses to uniform styles of private security
personnel: An online experiment. Journal - Psychologie des Alltagshandelns, 14(1), 33-
44.
Ergänzende Publikationen
Herrmann, A., Seubert, C. & Glaser, J. (2020). Integriertes Modell zu Negativfolgen von
Gewalt, Aggression und sexueller Belästigung bei privatem Sicherheitspersonal durch
“Organizational Outsider“. In R. Trimpop, A. Fischbach, I. Seliger, A. Lynnyk & N.
Kleineidam (Hrsg.), Psychologie der Arbeitssicherheit und Gesundheit. Gewalt in der
Arbeit verhüten und die Zukunft gesundheitsförderlich gestalten! (S. 197-200). Kröning,
D: Asanger.
Herrmann, A. & Glaser, J. (2018a). Endbericht des Projekts „Pilotstudie zur
arbeitspsychologischen Bestandsaufnahme der Arbeitssituation bezüglich
Arbeitsbelastung und Gesundheit von ArbeitnehmerInnen des privaten
Sicherheitsgewerbes in Österreich“. Universität Innsbruck. Abrufbar unter:
https://www.vida.at//cms/S03/S03_28.a/1342588684052/tirol/bewachung-gewalt-
niedriger-lohn-und-sozial-unvertraegliche-arbeitszeitenv
Inhaltsverzeichnis
1 Einführung: Das private Sicherheitsgewerbe in Österreich und Deutschland ........... 1
1.1 Entwicklungen und Status-Quo..................................................................................... 1
1.2 Chancen und Herausforderungen .................................................................................. 2
2 Tätigkeitsfeld privates Sicherheitsgewerbe und seine Mitarbeiter – ein blinder Fleck
arbeits- und organisationspsychologischer Forschung?................................................ 3
2.1 Forschungsstand – Was wir wissen und was nicht ....................................................... 3
2.2 Kernfragestellung .......................................................................................................... 5
3 Arbeits- und Tätigkeitsmerkmale privater Sicherheitsdienstleistungen und ihr
Zusammenhang mit psychosomatischen Beschwerden (Studie 1) ............................... 6
3.1 Theoretischer Hintergrund ............................................................................................ 6
3.2 Fragestellung ................................................................................................................. 9
3.3 Methodik ....................................................................................................................... 9
3.4 Ergebnisse ................................................................................................................... 10
3.5 Diskussion und praktische Implikationen ................................................................... 13
4 Privates Sicherheitspersonal – eine Hochrisikogruppe für Gewalt- und
Aggressionserfahrungen. ................................................................................................ 14
4.1 Arbeitsbezogene Gewalt bei privatem Sicherheitspersonal: Wer ist besonders
gefährdet und was ist der Preis? .................................................................................. 15
4.1.1 Theoretischer Hintergrund und grundlegende Fragestellungen ......................... 16
4.1.2 Methodik ............................................................................................................ 17
4.1.3 Ergebnisse .......................................................................................................... 18
4.2 Modellentwicklung zu negativen Folgen von Formen arbeitsbezogener Gewalt- und
Aggressionserfahrungen (Typ I + II; Studie 2) ........................................................... 19
4.2.1 Theoretischer Hintergrund ................................................................................. 20
4.2.2 Fragestellung ...................................................................................................... 22
4.2.3 Methodik ............................................................................................................ 22
4.2.4 Ergebnisse .......................................................................................................... 22
4.2.5 Diskussion und praktische Implikationen .......................................................... 24
5 Arbeitskleidung als Einfluss auf Gewalt- und Aggressionserlebnisse in der privaten
Sicherheit? Eine sozialpsychologische Betrachtung .................................................... 26
5.1 Psychologische Reaktionen auf Uniformstile von privatem Sicherheitspersonal: ein
Online-Experiment (Studie 3) ..................................................................................... 26vi
5.1.1 Theoretischer Hintergrund ................................................................................. 27
5.1.2 Fragestellung ...................................................................................................... 27
5.1.3 Methodik ............................................................................................................ 29
5.1.4 Ergebnisse .......................................................................................................... 29
5.1.5 Diskussion und praktische Implikationen .......................................................... 30
6 Integrierende Zusammenfassung und Diskussion ....................................................... 32
6.1 Prädiktoren für Gewalt-, Aggressionserfahrungen und Gewaltbesorgnis ................... 32
6.1.1 Wirkmechanismen .............................................................................................. 32
6.1.2 Unerwartete Befunde.......................................................................................... 34
6.2 Prädiktoren für psychosomatische Beschwerden ........................................................ 34
6.2.1 Wirkmechanismen .............................................................................................. 35
6.2.2 Unerwartete Befunde.......................................................................................... 37
6.3 Prädiktoren für Kündigungsabsicht ............................................................................. 38
6.3.1 Wirkmechanismen .............................................................................................. 39
6.4 Limitierungen und Anregungen für zukünftigen Forschungsbedarf ........................... 39
7 Implikationen für die Praxis – Stellschrauben für gesundheitsförderliche
Arbeitsgestaltung ............................................................................................................ 42
7.1 Beschäftigungsbedingungen (Stellschraube 1) ........................................................... 42
7.1.1 Wochenarbeitszeit und atypische Arbeitszeiten ................................................. 42
7.1.2 Mangelnde Aufstiegsmöglichkeiten und niedriger sozialer Status .................... 44
7.1.3 Alleinarbeit ......................................................................................................... 46
7.1.4 Arbeitskleidung – Uniformierung ...................................................................... 46
7.2 Arbeitsbezogene Gewalt-, Aggressionserfahrungen und Gewaltbesorgnis
(Stellschraube 2).......................................................................................................... 47
7.2.1 Physische Gewalt, verbale Aggression, sexuelle Belästigung ........................... 47
7.2.2 Beobachtete Gewalt und Gewaltbesorgnis ......................................................... 48
7.3 Psychosoziale Tätigkeitsmerkmale (Stellschraube 3) ................................................. 50
7.3.1 Lernanforderungen ............................................................................................. 50
7.3.2 Arbeitsbezogene Ressourcen .............................................................................. 51
7.3.3 Arbeitsstressoren ................................................................................................ 52
8 Konklusion ....................................................................................................................... 55
Literaturverzeichnis ............................................................................................................... 56
A. Anhang ............................................................................................................................. 69vii A.1 vollständige Publikationen............................................................................................. 69 A.1.1. Herrmann, A. & Glaser, J. (2021). Work characteristics and psychosomatic health complaints of private security personnel. Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie A&O, 65(2), 53-67. ................................................................ 69 A.1.2. Herrmann, A., Seubert, C. & Glaser, J. (2018). Arbeitsbezogene Gewalt bei privatem Sicherheitspersonal: Wer ist besonders gefährdet und was ist der Preis? In R. Trimpop, J. Kampe, M. Bald, I. Seliger & G. Effenberger (Hrsg.), Psychologie der Arbeitssicherheit und Gesundheit. Voneinander lernen und miteinander Zukunft gestalten (S. 565-569). Kröning, D: Asanger. .................................................................................. 85 A.1.3. Herrmann, A., Seubert, C. & Glaser, J. (2020). Consequences of exposure to violence, aggression and sexual harassment in private security work: A mediation model. Journal of Interpersonal Violence. ................................................................................... 90 A.1.4. Herrmann, A. & Geser, W. (2021). Psychological responses to uniform styles of private security personnel: An online experiment. Journal - Psychologie des Alltagshandelns, 14(1), 33-44. ........................................................................................ 119 A.2 Eidesstaatliche Erklärung ............................................................................................ 132
viii
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1. Integriertes Modell zu lern- und gesundheitsförderlicher Arbeit (Glaser et al.,
2020, S. 17). ........................................................................................................ 8
Abbildung 2. Psychosoziale Tätigkeitsmerkmale privater Sicherheitsarbeit (N ≤ 683). ........ 11
Abbildung 3. Integriertes zweistufiges Modell zu Folgen von Gewalt, Aggression und
sexueller Belästigungen in der Arbeit............................................................. 211
Abbildung 4. Integration empirisch identifizierter Merkmalsgruppen (Risikofaktoren)
gesundheitsbeeinträchtigender Arbeit im privaten Sicherheitsgewerbe. .......... 43ix
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1. Dimensionen der psychologischen Reaktionen. ................................................... 299
Tabelle 2. Zusammenfassung von Gestaltungsvorschlägen für eine gesundheitsförderliche
Arbeitsgestaltung in der privaten Sicherheit. .................................................... 53-541 1 Einführung: Das private Sicherheitsgewerbe in Österreich und Deutschland 1.1 Entwicklungen und Status-Quo In den vergangenen 20 Jahren hat die private Sicherheit, analog zur weltweiten Entwicklung, auch in Europa ein nahezu exponentielles Wachstum erfahren (Moreira, Cardoso, & Nalla, 2015; van Steden & Nalla, 2010). Als Gründe hierfür sind vornehmlich die voranschreitende Privatisierung von behördlichen und polizeilichen Aufgaben (Button, 2007a; Van Steden & Sarre, 2007), die moderne Veranstaltungskultur und ein vermindertes subjektives Sicherheitsgefühl (Briken, 2011; Munar Suard & Lebeer, 2003) im Zusammenspiel mit einem kontinuierlich angewachsenen Leistungsportfolio der privaten Sicherheitsdienstleister zu nennen. In den meisten Ländern haben private Sicherheitskräfte längst eine substantielle Rolle an der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung eingenommen. In der Europäischen Union gibt es daher aktuell ungefähr 44.800 private Sicherheitsdienstleister, die in ihren unterschiedlichen Anwendungsbereichen im Jahr 2020 rund 40 Milliarden Euro umgesetzt haben (Confederation of European Security Services [CoESS], 2020). In Österreich und Deutschland arbeiten aktuell ungefähr 260.000 Personen für rund 5900 Unternehmen (CoESS, 2020). Private Sicherheitskräfte begleiten uns heutzutage beinahe selbstverständlich in unserem Alltag durch ihre Anwesenheit, z. B. in öffentlichen Verkehrsmitteln und Flughäfen, bei der Verkehrssicherung, in Einkaufszentren und Geschäften, in der Bewachung und dem Empfang öffentlicher Gebäude oder beim abendlichen Diskothekenbesuch. Auch abseits des Alltags hat die private Sicherheitswirtschaft Eingang in vormals staatshoheitliche Aufgaben gefunden und bewacht nicht selten militärische und staatliche Einrichtungen oder kritische Infrastruktur. Trotz der substantiellen gesellschaftlichen Verantwortung durch vielfältige Sicherheits- und Ordnungsaufgaben und der Vielzahl an Beschäftigten zeugten in der Vergangenheit Blicke hinter die Kulissen der Branche immer wieder von Aspekten prekärer Beschäftigung und niedriger Tätigkeitsvoraussetzungen. Dazu gehören insbesondere mangelnde Ausbildungsstandards für Unternehmer und Beschäftigte (Manzo, 2009; Nalla & Cobbina, 2017; Van Steden & Nalla, 2010). Eine Studie zu Gewerbestandards (Button, 2007b) wies Österreich und Deutschland im europäischen Vergleich eine Platzierung im unteren Drittel zu. Eine Situation, welche sich zum Zeitpunkt dieser Arbeit nicht nachhaltig verändert zu haben scheint.
2 1.2 Chancen und Herausforderungen Der substantielle Bedarf an Sicherheitsdienstleistungen und die hohe Flexibilität der Branche sind Stärken, die ihren wirtschaftlichen Aufschwung vorangetrieben haben. Auch in der fortwährenden Covid-19-Pandemie scheint sich diese Wandlungsfähigkeit abzuzeichnen. Während die Pandemie auf nicht absehbare Zeit ganze Aufgabenfelder aussetzte (z.B. in der Kultur- und Eventbranche) und sich existenzielle Krisen abzeichneten, haben sich mit fortschreitender Lage immer wieder neue Aufgaben in systemrelevanten Bereichen (z.B. Impf- und Testzentren, Einzelhandel, Behörden u.a.) im Kampf und Umgang mit der Pandemie erschlossen. Eine Entwicklung, welche den Stellenwert privater Akteure in der öffentlichen Sicherheit unterstreicht (Schönefeld, Herrmann, & Schütte, 2021). Trotz dieser Wandlungsfähigkeit, eines stetigen Wachstums und einer positiven Wirtschaftsprognostik für die kommenden Jahre (Zendehrouhkermani, 2020) ist die Branche grenzüberschreitend bekannt für ihre hohe Mitarbeiterfluktuation (Nalla & Cobbina, 2017) und eine problematische Personalbeschaffung bzw. Bewerberlage. Diese Aspekte spiegeln sich insbesondere in der Betrachtung der offenen Stellen wieder. 2019 waren monatlich rund 12.000 unbesetzte Stellen in Österreich und Deutschland ausgeschrieben (Arbeitsmarktservice, 2019; Bundesverband der Sicherheitswirtschaft, 2019). Die Nachfrage nach privaten Sicherheitsdienstleistungen scheint also offensichtlich in einem Kontrast zur Personalkraft zu stehen. Es ist diese Diskrepanz, welche die Frage aufwirft, warum dieses Beschäftigungsfeld, trotz teils hoher gesellschaftlicher Verantwortung, gewisser Arbeitsplatzsicherheit und Tätigkeitsvielfalt, offenbar von vielen Arbeitsuchenden und Beschäftigten als zu unattraktiv wahrgenommen wird, als dass es einen Eintritt oder langfristigen Verbleib rechtfertigen würde. Zusätzlich wird in Gesprächen mit privatem Sicherheitspersonal immer wieder deutlich, dass der Weg in diese Tätigkeit in den überwiegenden Fällen eher zufällig und nicht aufgrund einer aktiv intendierten Berufswahl geschehen ist und oftmals rein als Nebentätigkeit gesehen oder ausgeübt wird. Diese Dissertation hat es sich deshalb zum Ziel gemacht, konstituierende Faktoren dieser „Unattraktivität“ aus arbeitspsychologischer Perspektive zu identifizieren, um auf dieser Grundlage potentielle Maßnahmen einer humanorientierten, gesundheitsförderlichen Arbeitsgestaltung entwickeln zu können.
3 2 Tätigkeitsfeld privates Sicherheitsgewerbe und seine Mitarbeiter – ein blinder Fleck arbeits- und organisationspsychologischer Forschung? 2.1 Forschungsstand – Was wir wissen und was nicht Das private Sicherheitsgewerbe hat, trotz seiner gesellschaftlichen Bedeutung und nicht unerheblicher Beschäftigungszahlen, überraschenderweise in der Psychologie, insbesondere der Arbeits- und Organisationspsychologie, bisher nur eine sehr überschaubare wissenschaftliche Berücksichtigung erfahren. Die einleitend geschilderten Herausforderungen der Branche wurden bisher vornehmlich der Niedriglohnsituation und dem geringen sozialen Tätigkeitsstatus zugeschrieben (Nalla & Cobbina, 2017; Sefalafala & Webster, 2013). Aus arbeitspsychologischer Sicht ist es allerdings unwahrscheinlich, dass diese beiden Faktoren allein und umfassend für die mangelnde Attraktivität dieses Tätigkeitsfeldes bzw. für die hohe Mitarbeiterfluktuation verantwortlich sind. Für eine grundlegende Ursachenforschung und Tätigkeitsdiagnostik bedarf es einer systematischen Betrachtung verschiedenster Merkmale dieses Tätigkeitsbereichs. Teil einer fundierten arbeitspsychologischen Herangehensweise muss deshalb zunächst die Identifikation und Evaluierung konkreter Beschäftigungsbedingungen und Tätigkeitsinhalte sein, welche in weiterer Folge bezüglich ihrer Auswirkungen auf das arbeitende Individuum untersucht werden müssen, allem voran dessen Gesundheit. Gerade die Mitarbeitergesundheit dieser Beschäftigungsgruppe scheint als eine mögliche Ursache für bestehende Problemstellungen bisher in der wissenschaftlichen Betrachtung zu wenig berücksichtigt. Hier lohnt zudem ein Blick auf wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Polizeiarbeit (bzw. der Polizeipsychologie), die als vergleichbarstes Tätigkeitsfeld identifiziert wurde (Cobbina, Nalla, & Bender, 2016; Manzo, 2009). Die Polizeiarbeit wurde ihrerseits in empirischen Untersuchungen immer wieder als eine der stressreichsten und herausforderndsten Arbeitstätigkeiten beschrieben (Liberman et al., 2002; Wang et al., 2010). Auf Grund der Nähe der beiden Arbeitstätigkeiten könnten Befunde dieser Untersuchungen vermutlich auch Relevanz für die private Sicherheit haben. Eine vergleichende Studie bei uniformierten Tätigkeitsgruppen (Polizei, Feuerwehr, Strafvollzug, private Sicherheit) dokumentiert insbesondere bei privatem Sicherheitspersonal umfangreiche Arbeitsstressoren und eine eher schlechte psychische Gesundheit (Oginska-Bulik, 2005). Erschwerend kommt hinzu, dass in nationalen Arbeits- und Gesundheitsstatistiken Österreichs oder Deutschlands, mit Ausnahme des 2018 erschienen Security Reports des Deutschen Unfallversicherers (Verwaltungs-
4 Berufsgenossenschaft VBG), diese Beschäftigungsgruppe bisher kaum oder keinen Eingang gefunden zu haben scheint. Tatsächlich bestehen zum Zeitpunkt dieser Arbeit nahezu keine wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Gesundheitssituation oder zu den Arbeitsbelastungen des deutschsprachigen Sicherheitsgewerbes (Briken, 2011). In der internationalen psychologischen Forschung zur Polizeiarbeit und den wenigen Studien mit privaten Sicherheitskräften finden sich immer wieder Befunde, die auf eine gesundheitlich stark belastende Tätigkeit schließen lassen. So scheinen negative Beanspruchungsfolgen, wie verminderte Schlafdauer und -qualität, Insomnien, chronische Müdigkeit, schlechter subjektiver Gesundheitszustand, verringerte Leistungsfähigkeit und eine herabgesetzte Erholungsfähigkeit (Abedini et al., 2015; Alfredsson, Akerstedt, Mattson, & Wilborg, 1991; Boudreau, Dumont, & Boivin, 2013; Garbarino et al., 2002; Neylan et al., 2002), sowie Burnout (Vanheule, Declerq, Meganck, & Desmet, 2008; Vanheule & Declercq, 2009), Arbeitsstress (Leino, Selin, Summala, & Virtanen, 2011a) und psychische Gesundheitsbeeinträchtigungen (Leino, 2013; Talas, Button, Doyle, & Das, 2020) in dieser Beschäftigtengruppe besonders prävalent. Zusätzlich werden für Polizist*innen besonders häufig schwerwiegende psychiatrische Diagnosen, wie posttraumatische Belastungsstörungen, Depression und Angststörungen (Arial, Gonik, Wild, & Danuser, 2010; Berg, Hem, Lau, & Ekeberg 2006; Gershon, Lin, & Lee, 2002) bis hin zu hohen Suizidraten (Violanti, 2007) dokumentiert. Auch gesundheitsschädigendes Verhalten, wie etwa ein übermäßiger Konsum von Sucht- und Betäubungsmitteln, scheint für das Beschäftigungsfeld der (öffentlichen) Sicherheit charakteristisch (Abdollahi, 2002; Lindsay, 2008; Monaghan, 2003). Im Vergleich der Arbeitsbelastung von privaten Sicherheitskräften (insbesondere des deutschen Sprachraums) und Exekutivbeamt*innen muss unbedingt berücksichtigt werden, dass es teils gravierende Unterschiede, z.B. in den Rechtsgrundlagen, in der Ausbildungsqualität und - dauer, im Weiterbildungsangebot und der Ausstattung mit Arbeitsmitteln (Kleidung und Arbeitsschutz) gibt (Briken, 2011; Button, 2007b; Munar Suard & Lebeer, 2003; Manzo, 2009; Ruddell, Thomas, & Patten, 2011). Dieser bestehende Mangel an vergleichbaren Tätigkeitsgrundlagen, Fähigkeiten und Fertigkeiten in der privaten Sicherheit wird bei ähnlichen Tätigkeitsanforderungen wie der Polizeiarbeit, unweigerlich zu einer schlechteren Vorbereitung für den Arbeitsalltag, den Umgang mit Herausforderungen und kritischem Einsatzgeschehen und letztlich einer geringeren Ausbildung und Förderung von Einsatzkompetenz (Schmalzl, 2008) führen. In anderen Worten: Wenn Polizeiarbeit trotz entsprechender (intensiver) Vorbereitung auf den Arbeitsalltag als eines der forderndsten Tätigkeitsfelder mit einem erhöhten Risiko für
5
Gesundheitsbeeinträchtigung gilt, ist anzunehmen, dass negative Tätigkeitsfolgen in der
privaten Sicherheit nicht weniger prävalent sind.
2.2 Kernfragestellung
In der vorliegenden Dissertation werden eigene Publikationen auf Basis einer empirischen
Bestandsaufnahme dargestellt, die sich in kumulativer Herangehensweise erstmals einer
arbeitspsychologisch fundierten und quantitativen Tätigkeitsdiagnostik widmen.
Beschäftigungs- und Tätigkeitsbedingungen sowie Inhalte der Tätigkeit wurden möglichst
systematisch und umfassend evaluiert, um:
1.) private Sicherheitsarbeit und ihre Beschäftigten durch ein differenziertes Bild (auch
im Vergleich zu anderen Tätigkeitsfeldern) wissenschaftlich erfahrbar zu machen.
2.) Beziehungen zu Kernindikatoren der Arbeit (z.B. Mitarbeitergesundheit und
Fluktuation) und daran geknüpfte Herausforderungen der Branche zu explorieren
und zu dokumentieren.
3.) Ansatzpunkte für eine arbeitspsychologische Maßnahmenentwicklung zu
identifizieren, hin zu guten Arbeitsbedingungen nach Prinzipien einer
persönlichkeits- und gesundheitsförderlichen Arbeitsgestaltung.
Um die genannten Kernfragestellungen wissenschaftlich aufzuarbeiten, wird eingangs eine
theoretisch fundierte Erfassung zentraler Arbeits- und Tätigkeitsmerkmale (Studie 1) anhand
dreier Merkmalsklassen vorgestellt. Neben dem daraus entstehenden Tätigkeitsprofil, werden
so auf breiter Grundlage potentielle Einflussfaktoren für psychosomatische Beschwerden, als
einem Indikator der Mitarbeitergesundheit, untersucht.
Darauf aufbauend und aufgrund der Kategorisierung als Hochrisiko-Tätigkeit wird in weiterer
Folge ein Fokus auf Gewalt- und Aggressionserfahrungen gelegt. Durch eine vertiefende
Auswertung werden zunächst einige potentielle Risikofaktoren für entsprechende Erfahrungen
im Dienst exploriert. Hauptaugenmerk wurde auf die Untersuchung des negativen
Wirkungsprozesses von arbeitsbezogenen Gewalt- und Aggressionserfahrungen über die Sorge
vor Gewalt hin zu psychosomatischen Beschwerden und Kündigungsabsicht gelegt (Studie 2).
Um auch das charakteristische Tätigkeitsmerkmal der uniformen Berufskleidung im Kontext
dieses Fokus zu berücksichtigen, wurden die Außenwirkungen unterschiedlicher
Uniformmerkmale für eine positive bzw. negative Interaktionen mit der Öffentlichkeit über
entsprechende Zuschreibungen und Verhaltensintentionen untersucht (Studie 3).6
Im letzten Kapitel dieser Dissertation werden die gesammelten empirischen Befunde sowohl
im Hinblick auf weiterführende Forschung, als auch hinsichtlich praktischer Implikationen für
eine verbesserte Arbeitsgestaltung in der privaten Sicherheit in Österreich und Deutschland
diskutiert.
3 Arbeits- und Tätigkeitsmerkmale privater Sicherheits-
dienstleistungen und ihr Zusammenhang mit psychosomatischen
Beschwerden (Studie 1)
Die arbeits- und organisationspsychologische Forschung hat sich im Hinblick auf die Analyse
von Arbeits- und Tätigkeitsmerkmalen des privaten Sicherheitsgewerbes bisher vornehmlich
auf wenige ausgewählte Aspekte beschränkt, was nicht nur eine begründete Systematik,
sondern auch den Anspruch einer näherungsweise ganzheitlichen Betrachtung vermissen oder
zumindest nicht transparent erkennen lässt.
Eine erwähnenswerte Ausnahme stellen die Arbeiten von Munar Suard und Lebeer (2003)
sowie von Briken (2011) dar, welche es durch ihren qualitativen Ansatz in Form von
Expertenbefragungen geschafft haben, einen Überblick über relevante Arbeits- und
Tätigkeitsmerkmale privater Sicherheitstätigkeit zu erarbeiten. Diese Arbeiten bilden daher
eine empirische Grundlage für eine systematischere Analyse der Arbeit in privaten
Sicherheitsdiensten mit dem Ziel, eine theoriegeleitete, möglichst umfassende und zugleich
praxisnahe Erhebung von gesundheitsrelevanten Arbeits- und Tätigkeitsmerkmalen
durchzuführen (Herrmann & Glaser, 2021).
3.1 Theoretischer Hintergrund
Durch eine inhaltliche Kategorisierung bisheriger wissenschaftlicher Befunde, insbesondere
aus den genannten Arbeiten von Munar Suard und Lebeer (2003) sowie von Briken (2011),
wurden drei übergeordnete Merkmalsklassen (predictor sets) identifiziert:
1. Beschäftigungsbedingungen (occupational conditions), welche typischerweise den
strukturellen Rahmen dieser Arbeitstätigkeit (z.B. lange Arbeitszeiten,
Bereitschaftsdienst und hohe Flexibilität, Schicht-, Nacht- und Wochenend-/7
Feiertagsarbeit), den Einsatz von und Umgang mit Personal (z.B. Alleinarbeit,
geringe Aufstiegsmöglichkeiten, Sub-Contracting) und den gesellschaftlichen
Stellenwert (z.B. Niedriglohn, schlechtes Berufsimage, geringes öffentliches Ansehen)
umfassen.
2. Gewalt und Aggression (violence and aggression). Es besteht offensichtlich ein
erhöhtes Risiko für Aggressions- und Gewalterfahrungen im Dienst (z.B. verbale
Aggression und Beleidigungen, physische Gewalt, Bullying, sexuelle Belästigung;
siehe auch Dang, Denis, Gahide, Chariot, & Lefèvre, 2016; Harrell, 2011; Leino, 2013).
3. Psychosoziale Tätigkeitsmerkmale (psychosocial work characteristics; PSWC), also all
jene psychischen und sozialen Einflüsse, die während der Ausübung der Tätigkeit auf
ein Individuum Einfluss nehmen (z.B. arbeitsorganisatorische Hindernisse, niedrige
Qualifizierungsmöglichkeiten, mangelnde Unterstützung durch Vorgesetzte,
ambivalente Arbeitsrollen, übermäßiges Stehen oder Sitzen, schneller Wechsel
zwischen niedriger und hoher Konzentration, öffentliche Exposition, Lärm,
Feuchtigkeit, Hitze/Kälte).
Mit den psychosozialen Tätigkeitsmerkmalen ist ein besonders komplexer Themenbereich
angesprochen, welcher für sich genommen bereits eine Vielzahl an möglichen
arbeitspsychologisch relevanten Faktoren umfasst, die bisher in quantitativen Studien bei
privatem Sicherheitspersonal weder nach einem theoretisch fundierten, systematischen
Vorgehen, noch in der notwendigen methodischen Qualität untersucht worden sind. Um für
diesen bei privaten Sicherheitstätigkeiten unterbelichteten Merkmalskomplex eine strukturierte
Annäherung zu ermöglichen, insbesondere auch im Hinblick auf mögliche Gesundheitsfolgen,
wurde ein integriertes arbeitspsychologisches Modell zu gesundheitsförderlicher
Arbeitsgestaltung (Glaser & Herbig, 2012; 2014) zugrunde gelegt (siehe Abbildung 1).8
Abbildung 1. Integriertes Modell zu lern- und gesundheitsförderlicher Arbeit (Glaser, Hornung, Höge,
& Strecker, 2020, S. 17).
Dieses Modell spiegelt das integrierte Wissen aus etablierten arbeitspsychologischen
Konzepten wider, allen voran der Handlungsregulationstheorie (HRT), aber auch dem Job
Characteristics Model (JCM, Hackman & Oldham, 1975, 1976), dem Job Demand Control
(JDCM, Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990) oder dem Job Demands-Resources Model
(JD-R, Bakker & Demerouti, 2007; Demerouti, Bakker, Nachrainer, & Schaufeli, 2001). Es
erfasst psychische Arbeitsbelastungen als neutral wirkende Arbeitsfaktoren, die je nach
Beschaffenheit zu positiven oder negativen (individuellen) Beanspruchungen führen. In einer
humanen Tätigkeit sind daher, im Sinne des Konzepts der vollständigen Tätigkeit (Hacker,
1998), positive Beanspruchungen für ein kognitives und motivationales Wachstum und eine
positive Persönlichkeitsentwicklung (Frese & Zapf, 1994) unerlässlich. Das Ausbleiben von
Gesundheitsbeeinträchtigungen, als mittelfristige Folge negativer Beanspruchungen, beschreibt
das zweite zentrale Kriterium humaner Arbeit.
Das integrierte Modell zu lern- und gesundheitsförderlicher Arbeit unterscheidet in seiner
Konzeptualisierung auf dieser Basis in drei Gruppen von psychosozialen Tätigkeitsmerkmalen
(psychischen Belastungen):
• Lernanforderungen in der Arbeit sind solche Tätigkeitsmerkmale, die bei
herausfordernden oder ganzheitlichen Arbeitstätigkeiten den Erwerb oder die
Erweiterung bestehender Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse erforderlich machen
und so das menschliche Grundbedürfnis nach Lern- und Persönlichkeitsentwicklung
fördern (Glaser & Herbig, 2014).9
• Arbeitsstressoren beschreiben Tätigkeitsmerkmale, die durch (Regulations-)
Überforderungen oder (Regulations-)Hindernisse dem erfolgreichen Ausführen von
Arbeitsaufgaben entgegenwirken. Sie können durch Zusatzaufwand überwunden
werden oder zu einer Überforderung führen (Leitner et al., 1993) und damit
Gesundheitsbeeinträchtigungen bedingen (Büssing & Glaser, 2000; Greiner, Ragland,
Krause, Syme, & Fisher, 1997).
• Arbeitsbezogene Ressourcen beschreiben unterstützende Tätigkeitsmerkmale im
Umgang mit Lernanforderungen, aber auch einen Puffer (Karasek & Theorell, 1990)
zwischen widrigen Arbeitsbedingungen bzw. Arbeitsstressoren und deren negativen
Beanspruchungsfolgen.
3.2 Fragestellung
Neben der grundlegenden Frage, wie die als tätigkeitsrelevant identifizierten Merkmale der
Arbeit bei deutschsprachigem Sicherheitspersonal ausgeprägt sind, zielt diese empirische
Studie darauf ab, unter diesen umfangreichen Arbeits- und Tätigkeitsmerkmalen Prädiktoren
für Gesundheitsbeeinträchtigungen zu identifizieren. Dazu nehmen wir an, dass
Beschäftigungsbedingungen (H1), Formen der Gewalt und Aggressionserfahrung (H2a) und
psychosoziale Tätigkeitsmerkmale (H3a) jeweils eigenständig und unabhängig voneinander
(inkrementelle Varianz; H2b, H3b) kumulativ zur Erklärung von
Gesundheitsbeeinträchtigungen (psychosomatischen Beschwerden) beitragen werden. Mit
anderen Worten gehen wir davon aus, dass jeder Merkmalskomplex im Sinne kumulierter
Mehrfachbelastungen eigenständige Varianz für die Aufklärung gesundheitlicher
Fehlbeanspruchungen des privaten Sicherheitspersonals beiträgt.
3.3 Methodik
Im Rahmen eines Projektes zur Erfassung der Arbeitsbelastungen und der Gesundheit von
privatem Sicherheitspersonal konnten mittels online Befragung 683 Personen aus
verschiedenen Anwendungsbereichen der privaten Sicherheit in Österreich und Deutschland
querschnittlich befragt werden. Zur Datenerhebung wurden, wo immer möglich, reliable und
validierte Messinstrumente bzw. adaptierte Items aus etablierten Verfahren verwendet.
Beschäftigungsbedingungen wurden durch: 1) (zeitliche) Aspekte wie Wochenarbeitszeit,
Überstunden sowie einem Index zur Häufigkeit atypischer Arbeitszeiten (Abend-, Nacht-,10 Wochenend- und Feiertagsarbeit); 2) Einsatz und Umgang mit Personal, wie Alleinarbeit und Aufstiegsmöglichkeiten; 3) gesellschaftlicher Stellenwert der Tätigkeit, wie erlebte Angemessenheit der Entlohnung und sozialer Status, abgebildet. Formen von Gewalt und Aggression wurden durch Fragen nach Erfahrungen von physischer Gewalt, verbaler Aggression, beobachteter Gewalt und sexueller Belästigung in den vergangenen 12 Monaten, sowie der Sorge vor Gewalt am Arbeitsplatz, erfasst. Psychosoziale Tätigkeitsmerkmale wurden mit dem etablierten Screening TAA (Glaser et al., 2020) erhoben, wobei einzelne Skalen aus Validitätsgründen entfernt und bestimmte Items für die Tätigkeit in privaten Sicherheitsdiensten angepasst wurden. Das bedingungsbezogene Fragebogeninstrument umfasst Lernanforderungen (kognitive Anforderungen, Lernerfordernisse, Qualifizierungsmöglichkeiten, qualifikatorische Voraussetzungen, Angemessenheit der Qualifikation), Arbeitsstressoren (organisationale, soziale und physische Stressoren, zeitliche Überforderung, Qualitätseinbußen) sowie wichtige arbeitsbezogene Ressourcen (Vorgesetztenfeedback, Tätigkeitsspielraum, Partizipationschancen, soziales Klima). Als Gesundheitsindikatoren dienten psychosomatische Beschwerden, die mit einer Kurzfassung des Gießener Beschwerdebogens (GBB; Brähler, Hinz, & Scheer, 2008) mit den vier Unterkategorien Erschöpfung, Magenbeschwerden, Gliederschmerzen und Herzbeschwerden erhoben wurden, welche eine subklinische, niedrigschwellige Betrachtung von kurzen bis mittelfristigen Gesundheitsbeeinträchtigungen ermöglichen. Mittels multipler linearer Regressionen wurden signifikante Prädiktoren innerhalb jedes thematischen Merkmalskomplexes für psychosomatische Beschwerden (Beschäftigungsbedingungen - Modell 1, Gewalt und Aggression - Modell 2, psychosoziale Tätigkeitsmerkmale - Modell 3) berechnet. In einem hierarchischen Gesamtregressionsmodell (block-wise), welches alle Merkmalskomplexe beinhaltet, wurde auf eigenständigen und unabhängigen Einfluss (inkrementelle Varianz) der drei Merkmalsblöcke getestet. 3.4 Ergebnisse Neben detaillierten deskriptiven Befunden zur Stichprobenzusammensetzung, zu Arbeitszeiten, Aggressionserfahrungen und gesundheitsrelevantem Verhalten (siehe Publikation A.1.1), wurde ein Tätigkeitsprofil hinsichtlich der psychosozialen Tätigkeitsmerkmale erstellt (siehe Abbildung 2).
11 Abbildung 2. Psychosoziale Tätigkeitsmerkmale privater Sicherheitsarbeit (N ≤ 683).
12 In der graphischen Veranschaulichung entlang des Skalenmittelwerts (Abbildung 2) lässt sich erkennen, dass die Arbeit von privatem Sicherheitspersonal durch substantielle Lernanforderungen, insbesondere qualifikatorischen Voraussetzungen, gekennzeichnet ist. Dies scheint jedoch in einem gewissen Kontrast zu den Möglichkeiten zu stehen, sich die benötigten Fähigkeiten in entsprechenden Angeboten, wie Schulungen und Weiterbildungen, aneignen zu können. Neben einer Reihe vergleichsweise moderat ausgeprägter Stressoren (soziale Stressoren, physische Stressoren, zeitliche Überforderung, Qualitätseinbußen, ungünstige Arbeitsumgebung), sind vor allem organisationale Stressoren am stärksten vorhanden. Zudem scheinen, mit Ausnahme des sozialen Klimas, tätigkeitsbezogene Ressourcen (Partizipationschancen, Vorgesetztenfeedback, Tätigkeitsspielräume), in eher geringem Maße vorhanden zu sein. Die Ergebnisse der schrittweisen multiplen Regressionsanalysen (siehe Tabelle 2 in Herrmann & Glaser, 2021, S. 8) sprechen für die Annahme, dass die untersuchten Merkmalskomplexe, im Sinne von Mehrfachbelastungen, jeweils eigenständig und unabhängig auf psychosomatische Beschwerden wirken. Psychosozialen Tätigkeitsmerkmalen kommen demnach die stärkste Prognosefähigkeit für psychosomatische Beschwerden zu (37 % Varianzanteil), noch vor den Beschäftigungsbedingungen (24 % Varianzanteil) und den Formen von Gewalt und Aggression (9 % Varianzanteil). Zusammengenommen erreicht das Modell eine sehr gute Erklärungsquote für psychosomatische Beschwerden (43,2 % Varianzanteil). Hinsichtlich der gemessenen Beschäftigungsbedingungen (Modell 1) berichten besonders Arbeitende mit einer hohen Wochenarbeitszeit, vielen atypischen Arbeitszeiten, häufiger Alleinarbeit, mit geringen Aufstiegsmöglichkeiten und einer geringen Einschätzung des soziales Ansehens ihrer Tätigkeit von stärkeren psychosomatischen Beschwerden. Im Hinblick auf die berichteten Formen von Gewalt und Aggression (Modell 2) sind Arbeitende mit erhöhter Sorge vor Gewalt am Arbeitsplatz und vermehrten Erfahrungen verbaler Aggression verstärkt von psychosomatischen Beschwerden betroffen. Die Befunde zu psychosozialen Tätigkeitsmerkmalen (Modell 3) lassen erkennen, dass Arbeitende, welche von hohen qualifikatorischen Voraussetzungen, psychischen Stressoren, organisationalen Stressoren, Qualitätseinbußen, einer zeitlichen Überforderung und sozialen Stressoren berichten, auch mehr psychosomatische Beschwerden haben. Das gilt weiterhin für Arbeitende, die eine geringe Angemessenheit der eigenen Qualifikation und wenige Qualifizierungsmöglichkeiten erleben.
13 3.5 Diskussion und praktische Implikationen Diese Studie gibt mit ihren Befunden einen ersten systematischen Überblick über gesundheitsrelevante Tätigkeitsmerkmale privater Sicherheitsdienstleistungen und zeigt, dass jede Merkmalsklasse, und in der Detailbetrachtung insbesondere bestimmte Faktoren, einen deutlichen Einfluss auf die Gesundheit des Beschäftigten haben. Bei der Interpretation der Befunde sind einige Einschränkungen der Studie zu berücksichtigen. Die Daten stammen aus einer querschnittlichen, nicht repräsentativen Stichprobe, auch wenn die Geschlechterverteilung sowie die Arbeitsfelder näherungsweise der bekannten Verteilung in Deutschland entsprechen (Bundesverband der Sicherheitswirtschaft, 2019). Dies bedeutet, dass eine Generalisierbarkeit sowie kausale Beziehungen zwischen Tätigkeitsmerkmalen und psychosomatischen Beschwerden nicht mit Sicherheit angenommen werden können. Psychosomatische Beschwerden stellen letztlich nur einen möglichen Gesundheitsindikator dar. Es können daher mit der vorgelegten Datengrundlage keine Ableitungen für andere Gesundheitsbeeinträchtigungen oder gar für klinische Diagnosen (z.B. Insomnie, Depression, posttraumatische Belastungsstörungen etc.) vorgenommen werden. Darüber hinaus sind, aufgrund der digitalen online Befragung, in den erhobenen Daten vermutlich jene Personen mit einem beschränkten Zugang und geringer Erfahrung mit digitalen Kommunikationswegen (Smartphone, Facebook, Email) unterrepräsentiert. Unterrepräsentiert sind auch solche Personen, welche weniger als fünf Jahre im Sicherheitsgewerbe tätig sind (ca. 30 %). Aufgrund dieser Schiefverteilung hinsichtlich einer längeren Tätigkeitsdauer vermuten wir, dass Personen die es in den ersten Tätigkeitsjahren nicht geschafft haben, sich an die Arbeitsbelastungen zu gewöhnen, bereits aus dem Dienst ausgeschieden sind und daher von unserer Befragung nicht erfasst werden konnten; ein Phänomen, dass in der Arbeitsforschung als “Healthy Worker Effekt” (z.B. Baillargeon, 2001) bekannt ist und tendenziell zu einer Unterschätzung negativer Befunde führt. Darüber hinaus beziehen sich die Befunde auf „allgemeine Sicherheitsdienstleistungen“, was bedeutet, dass Teilnehmer aus unterschiedlichen Anwendungsbereichen repräsentiert sind. Obwohl dies für einen grundlegenden Überblick angemessen ist und sich privates Sicherheitspersonal in der Praxis eher selten uneingeschränkt einem einzigen und klar abgrenzbaren Anwendungsbereich widmet, muss dennoch bedacht werden, dass sich Befunde über Anwendungsfelder hinweg unterscheiden könnten (z.B. Objektschutz vs. Veranstaltungssicherheit). Abschließend muss noch erwähnt werden, dass die dargestellten Merkmalskomplexe keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Ihre Zusammenstellung erfolgte zwar in enger Anlehnung an bestehende wissenschaftliche Theorien und Befunde (v.a. hinsichtlich
14 psychosozialer Tätigkeitsmerkmale), ist aber nicht in allen Bereichen (v.a. bei Beschäftigungsmerkmalen) ausreichend theoretisch fundiert und somit nicht frei von einer gewissen Willkür der thematischen Gliederung. Für die Praxis gibt diese Studie einen ersten Orientierungsrahmen zur Ausprägung der drei Merkmalsgruppen (Beschäftigungsbedingungen, Erleben von Gewalt und Aggression, psychosoziale Tätigkeitsmerkmale) und ihren Bezug zu psychosomatischen Beschwerden. Die hieraus abzuleitenden Empfehlungen für eine gesundheitsförderliche Arbeitsgestaltung in der betrieblichen und gewerblichen Praxis werden im letzten Kapitel dieser Arbeit vorgestellt und diskutiert. 4 Privates Sicherheitspersonal – eine Hochrisikogruppe für Gewalt- und Aggressionserfahrungen. Während im europäischen Durchschnitt davon ausgegangen wird, dass innerhalb eines Jahres rund 1,9 % aller arbeitenden Personen psychische Gewalt, 5,0 % Androhungen psychischer Gewalt, 4,1 % Bullying und Belästigungen sowie 2,0 % sexuelle Belästigung im Rahmen ihrer Tätigkeit erfahren (Eurofound, 2015), bestehen deutliche Hinweise, dass diese Prävalenzen in bestimmten Tätigkeitsfeldern deutlich höher liegen. Zu den bekanntesten Hochrisikofeldern zählen insbesondere der Gesundheitssektor (Spector, Zhou, & Che, 2014), Schulbildung (Tiesman, Konda, Hendricks, Mercer, & Amandus, 2013), öffentliche Sicherheit, Handel und Justiz (Gadegaard, Anderson, & Hogh, 2018; Hogh & Viitasara, 2005; Piquero, Piquero, Craig, & Clipper, 2013). Weniger bekannt, wenn auch auf Basis der Tätigkeitsinhalte wenig überraschend, sind Befunde, die auch das private Sicherheitsgewerbe eindeutig als eine Hochrisikotätigkeit für Gewalt- und Aggressionserfahrungen charakterisieren (Dang et al., 2016; Leino, 2013; Rosen, 2001; Waddington, Badger, & Bull, 2005). Am Beispiel des amerikanischen National Crime Victimization Survey (Harrell, 2011) liegen private Sicherheitskräfte sogar auf dem dritten Rangplatz aller Tätigkeitsfelder hinter Barpersonal und Gesetzeshütern. Obwohl die gravierenden negativen Auswirkungen von arbeitsbezogener Gewalt- und Aggressionserfahrungen weitreichend wissenschaftlich dokumentiert sind, gibt es nur wenig internationale Forschung, die sich mit privaten Sicherheitsdiensten befasst hat (Declercq, Vanheule, Markey, & Willemsen, 2007; Leino et al., 2011ab; Vanheule et al., 2008; Declercq
Sie können auch lesen