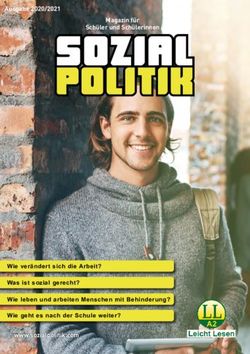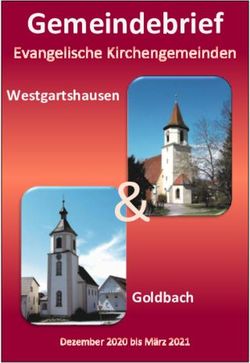Metal Recovery from Fly Ashes - Experiences from Routine Operation of the Flurec Process and Status of the Industry Solution SwissZinc
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Abstract
Metal Recovery from Fly Ashes – Experiences from Routine
Operation of the Flurec Process and Status
of the Industry Solution SwissZinc
Stefan Schlumberger
Volatile metals such as cadmium, copper, lead and zinc are accumulated in fly ashes
(FA) from municipal waste incineration (MSWI) plants. In Switzerland, acidic fly ash
Rückstände aus MVA
leaching – so called Fluwa process – has been established since 1997 and offers an
effective method for metals separation and recovery. Nowadays, more than 60 percent
of these FA are treated and the metals contained in it are recovered. Acidic FA leaching
provides the basis for extended methods such as the Flurec process. This process allows
the recovery of special high grade zinc (SHG Zn > 99.995 %) and a lead, copper and
cadmium containing concentrate. Good operational experiences within the past five
years confirm the efficiency and high capability of this process. Thus, about 250 tons
of SHG zinc metal is produced annually and sold as a commodity.
Until the year 2021, all FA produced in Switzerland have to be treated and metals have
to be recovered according to state-of-the-art procedures as prescribed in the Swiss
Waste Ordinance (2015). Therefore, the construction of a centralized treatment and
metal recovery plant – similar to the Flurec process – is planned at national level in
Switzerland: SwissZinc. Swiss MSWI plants will be the sole shareholders. SwissZinc is
not operated for profit but is intended to ensure long-term cost-covering operation.
The plant is capable of recovering approximately 2,200 tons of SHG Zinc per year.
According to current planning, commissioning is scheduled for 2024. As an efficient
business solution, SwissZinc enables ecologically and economically sustainable metal
recovery from fly ashes. In the long term, SwissZinc represents the most optimal im-
plementation of the legal requirements for metal recovery from fly ashes.
202Metallrückgewinnungen aus Flugaschen – Das Flurec-Verfahren und die Branchenlösung SwissZinc
Metallrückgewinnungen aus Flugaschen –
Erfahrungen aus dem Routinebetrieb des Flurec-Verfahrens
und Stand der Branchenlösung SwissZinc
Stefan Schlumberger
1. Schweizer Abfallwirtschaft..........................................................................204
Rückstände aus MVA
1.1. Verwertungsmöglichkeiten der Flugaschen.............................................204
1.2. Prinzip der sauren Flugaschenwäsche.......................................................205
2. Betriebserfahrungen Flurec........................................................................206
2.1. Saure Flugaschenwäsche ............................................................................208
2.2. Zementierung ..............................................................................................210
2.3. Solventextraktion und Zinkelektrolyse ....................................................211
2.4. Massenbilanz................................................................................................212
2.5. Fazit................................................................................................................213
3. SwissZinc.......................................................................................................213
4. Literatur.........................................................................................................216
Wertstoffe ungenutzt zu deponieren ist weder ökologisch noch ökonomisch sinn-
voll. Dies gilt auch für Verbrennungsrückstände, die bei der thermischen Abfall-
behandlung – in der Schweiz als Kehrichtverwertung bezeichnet – anfallen. Die
Stiftung Zentrum für nachhaltige Abfall- und Ressourcennutzung (ZAR) erarbeitet
zukunftsweisende Ergänzungen zu bestehenden Sammelsystemen der schweizeri-
schen Abfallwirtschaft und leistet als nationales Entwicklungszentrum wegweisende
Praxisbeiträge zur nachhaltigen Schließung von Stoffkreisläufen. Seit ihrer Grün-
dung im Jahr 2010 wurden unter anderem die Grundlagen für eine weltweit erste
Aufbereitungsanlage für Trockenschlacke aus der thermischen Abfallverwertung
erarbeitet. Mit der Erweiterung der technologischen Möglichkeiten durch das
Kompetenzzentrum für Hydrometallurgie wurden im Jahr 2014 die Grundlagen für
weitergehende Aufbereitungs- und Rückgewinnungskonzepte wie beispielsweise die
nationale Metallrückgewinnung aus Flugaschen oder die Phosphorrückgewinnung
aus Klärschlammaschen geschaffen. Ziel ist es, neben der bereits sehr effizienten
thermischen Verwertung der Abfälle auch deren stoffliche Nutzung zu verbessern.
Damit leistet die Abfallwirtschaft einen aktiven Beitrag zur nachhaltigen Ressourcen-
politik und Schließung von Stoffkreisläufen.
203Stefan Schlumberger
1. Schweizer Abfallwirtschaft
Jährlich werden in der Schweiz etwa 4 Millionen Tonnen Abfälle in 29 Kehrichtverbren-
nungsanlagen (KVA) verwertet [1]. Lag der bisherige Fokus der thermischen Abfallbe-
handlung hauptsächlich bei der energetischen Verwertung durch Fernwärmenutzung
und Stromproduktion, so gewann die Nutzung der in den Verbrennungsrückständen
enthaltenen Ressourcen in den letzten Jahren einen immer größeren Stellenwert. Die-
sem Aspekt wurde auch im Rahmen der Totalrevision der Schweizer Abfallverordnung
Rechnung getragen, indem die neue Verordnung über die Vermeidung und Entsorgung
von Abfällen (VVEA) Ziele zur Ressourcennutzung vorgibt. Abfälle sind demnach
Rückstände aus MVA
stofflich und energetisch gemäß dem Stand der Technik zu verwerten. Demzufolge
müssen Anlagen, die Siedlungsabfälle oder Abfälle vergleichbarer Zusammensetzung
thermisch verwerten, nach Ablauf einer Übergangsfrist ab dem Jahr 2021 Metalle
aus den Filteraschen zurückgewinnen [3]. Neben den Filteraschen betrifft dies auch
diejenigen Kesselaschen, die sich qualitativ von den Rostaschen unterscheiden und
somit filterascheähnlich sind. Nachfolgend werden diese zu behandelnden Aschen als
Flugaschen bezeichnet, die die im Abgas transportierten, aus dem Feuerraum ausge-
tragenen bzw. im Abgasstrom neugebildeten Partikel beinhalten. Da alle Schweizer
KVAs zur Staubabtrennung aus dem Abgasstrom – sowohl für nasse als auch trockene
Abgasreinigungssysteme – einen Elektrofilter zur primären Staubabscheidung verwen-
den und die Neutralisation der Abgase in einer nachgeschalteten Stufe erfolgt, liegt
hier keine Vermischung von Elektrofilteraschen und Neutralisationsprodukten vor.
Im Mittel fallen bei der Verbrennung einer Tonne Abfall in einer Schweizer KVA
etwa 20 kg Flugasche (FA) an. Das entspricht einer jährlichen Menge von etwa
80.000 Tonnen Flugasche. Da mit diesen 4 Millionen Tonnen Abfall die Kapazitäts-
grenze der heutigen Schweizer KVA erreicht ist, kann davon ausgegangen werden, dass
die anfallende Menge an KVA-Flugasche in den nächsten Jahren nicht weiter ansteigen
wird. Die aktuelle Abfallwirtschaftssituation in der Schweiz deutet aber auch auf kein
relevantes Sinken dieser Flugaschenmengen in den nächsten Jahren hin.
1.1. Verwertungsmöglichkeiten der Flugaschen
Heute werden zur Behandlung der Flugaschen vier Verfahren angewendet (Bild 1).
Die neutrale Wäsche gefolgt von einer Verfestigung mit Zement oder alternativen
Bindemitteln und anschließender Deponierung der stabilisierten Flugaschen im In-
land, der Export der unbehandelten Flugaschen in eine Untertagedeponie (UTD) in
Deutschland sowie die sogenannte saure Flugaschenwäsche (Fluwa) bzw. das darauf
aufbauende Flurec-Verfahren (Kapitel 2). Eine Metallrückgewinnung ist nur durch das
Fluwa- bzw. Flurec-Verfahren möglich. Dieses stellt den derzeitigen Stand der Technik
zur Metallrückgewinnung aus Flugaschen dar. Zwölf KVAs wenden dieses Verfahren
derzeit in der Schweiz an. Fünf weitere Anlagen lassen ihre Flugaschen an einer die-
ser zwölf Anlagen mitbehandeln. Von den zwölf Fluwa-Anlagen ist eine zusätzlich
mit dem neuen Flurec-Verfahren zur direkten Metallrückgewinnung aus den KVA-
Filteraschen ausgerüstet. Insgesamt werden mit diesen beiden Verfahrensvarianten
58 % der Schweizer Flugaschen aufbereitet und die Metalle daraus anteilig verwertet.
204Metallrückgewinnungen aus Flugaschen – Das Flurec-Verfahren und die Branchenlösung SwissZinc
Die verbleibenden 42 % der Flugaschenmenge müssen zukünftig einer Metallrückge-
winnung zugeführt werden. Dafür sind drei weitere Fluwa-Anlagen in Planung, die
diese Kapazitätslücke zukünftig schließen werden. Ab 2022 können alle Flugaschen im
Land durch den Prozess der sauren Flugaschenwäsche behandelt werden.
Bild 1:
FLUREC
8% Aufteilung der heutigen Entsor-
gungs- bzw. Verwertungswege
Neutralwäsche für KVA-Flugaschen; Neut-
Rückstände aus MVA
16 % ralwäsche mit nachfolgender
Stabilisierung und Deponierung
Export UTD im Inland, Export in eine Unter-
26 % tagedeponie (UTD) im Ausland
als Entsorgungswege und das
FLUWA
Fluwa- bzw. Flurec-Verfahren
zur Metallrückgewinnung und
50 %
stofflichen Verwertung
1.2. Prinzip der sauren Flugaschenwäsche
Abgas-
Elektrofilter
wäscher
Feuerung
Abfall
Flugasche
Rostasche
zur Deponie Hg-Ionen-
Austauscher
Schwermetall-
Extraktion
Kalksilo
Hg-Abscheidung
Filterkuchen
zur Deponie
Fällung Vorfluter
Zinkschlamm Ionen-
zum Recycling austauscher
Bild 2: Prinzipschema der sauren Flugaschenwäsche; die extrahierten Metalle werden in der
Abwasserbehandlung ausgefällt, im Zinkschlamm angereichert und einer stofflichen
Verwertung zugeführt; der metallabgereicherte Filterkuchen wird gemeinsam mit der
ebenfalls metallentfrachteten Rostasche deponiert
205Stefan Schlumberger
Die saure Flugaschenwäsche (Fluwa, Bild 2) wurde in der Schweiz Anfang der 1990er
Jahre erstmals großtechnisch umgesetzt. Sie beruht auf der Kombination zweier Abfall-
stoffströme: den Flugaschen und dem sauren Wäscherabwasser, die in einer Extrakti-
onskaskade gemeinsam behandelt werden. Dabei erfolgt einerseits die Neutralisation
der im sauren Wäscherabwasser enthaltenen Salzsäure durch die Alkalinität der Flug-
aschen und anderseits die Schwermetallextraktion aus den Flugaschen. Die extrahierten
Metalle werden in der Abwasserbehandlungsanlage mit Kalkmilch ausgefällt und als
Zink- bzw. Metallhydroxidschlamm der Verwertung im Ausland zugeführt. Die metall-
abgereicherte, sauer gewaschene Flugasche (Filterkuchen) wird gemeinsam mit der Rost-
Rückstände aus MVA
schlacke in der Schweiz auf Deponien des Typs C oder D abgelagert [3].
2. Betriebserfahrungen Flurec
Das Flugasche-Recycling (Flurec-Verfahren) steht für die direkte Rückgewinnung der
mittels saurer Wäsche extrahierten Metalle. Es wurde im Jahr 2013 bei der KEBAG
in Zuchwil (Schweiz) erfolgreich in Betrieb genommen. Nach dem Prozessschritt der
sauren Flugaschenextraktion wird das schwermetallangereicherte Filtrat in der nachge-
schalteten Flurec-Anlage weiter aufbereitet. Die aus der Flugasche extrahierten Metalle
werden in mehreren Prozessschritten weiter aufgetrennt, gereinigt und als Produkte ver-
wertet. In einem ersten Schritt werden dazu die edleren Metalle Blei, Cadmium, Kupfer
und Silber durch einen Reduktionsprozess mit Zinkpulver als Reduktionsmittel – der
sogenannten Zementierung – abgeschieden (Bild 3). Das erhaltene Metallkonzentrat,
im Weiteren als Zementat bezeichnet, wird zur Weiterverarbeitung an ausländische
Betriebe zur Rückgewinnung der darin enthaltenen Metalle abgegeben. Dabei werden
die Metalle Blei, Kupfer und Silber mit hydro- und pyrometallurgischen Verfahren
aufbereitet und als Produkte dem Stoffkreislauf wieder zugeführt. Cadmium wird ab-
getrennt und in stabilisierter Form auf einer Deponie für Sonderabfälle abgelagert.
Zinkpulver-
dosierung
metallhaltiges
Filtrat
vorgereinigtes Filtrat
Bild 3:
(aus FLUWA) Reaktor
zur Solventextraktion
Kerzenfilter Prinzipschema der Zementie-
rung – reduktive Abtrennung
Filterpresse
der edleren Metalle Blei (Pb),
Cadmium (Cd), Kupfer (Cu) und
Zementat: Silber (Ag) mittels Zinkpulver-
Rückgewinnung zugabe; das Metallkonzentrat
von Ag, Cd, Cu, Pb
(Zementat) wird einer stoff-
lichen Verwertung zugeführt
206Metallrückgewinnungen aus Flugaschen – Das Flurec-Verfahren und die Branchenlösung SwissZinc
Aus dem vorgereinigten Filtrat wird anschließend mittels Solventextraktion ein
hochreines Zinkkonzentrat hergestellt, aus dem Zink elektrolytisch als hochreines
Metall mit einer Reinheit von über 99.995 % abgeschieden wird (Bild 4). Mithilfe der
Solventextraktion werden dabei drei Ziele erreicht:
1. Zink wird selektiv aus dem Abwasserstrom extrahiert. Die hohe Reinheit des Zink-
metalls wird somit sichergestellt,
2. das Anion Chlorid wird gegen Sulfat ausgetauscht und ein konventioneller Zink-
elektrolyseprozess ermöglicht und
Rückstände aus MVA
3. das Zielmetall Zink im Konzentrat auf einen Gehalt von 150 g/l angereichert.
Extraktion
vorgereinigtes
Filtrat Abwasser
organische
Phase im
Waschstufe geschlossenen
Kreislauf
Reextraktion
Zink-
Konzentrat
Elektrolytkreislauf H2SO4 Bild 4:
Zinkelektrolyse
Prinzipschema der Solvent-
Zinkmetall > 99,995 % extraktion und elektrolytischen
Zinkmetallgewinnung
Tabelle 1: Qualitative Anforderungen der
Gewässerschutzverordnung für
Abwasserbehandlungsanlagen von
Abfallverbrennungsanlagen
Parameter Ein- Einleitung in die
heit öffentliche Kanalisation
pH-Wert 6,5 – 9,0
Temperatur °C 40
Arsen (As) mg/l 0,1 Das von Schwermetallen abgereicherte
Blei (Pb) mg/l 0,1 Abwasser wird in der prozessinternen
Cadmium (Cd) mg/l 0,05 Abwasserbehandlung weiter aufbereitet
Chrom (Cr gesamt) mg/l 0,1 (technisch analog zu Bild 2). Die Anfor-
Kobalt (Co) mg/l 0,5 derungen der Gewässerschutzverordnung
Kupfer (Cu) mg/l 0,1 [2] für Entsorgungsbetriebe (Tabelle 1)
Molybdän (Mo) mg/l 1,0 werden dabei deutlich unterschritten,
Nickel (Ni) mg/l 0,1 so dass das Abwasser anschließend der
Quecksilber (Hg) mg/l 0,001 kommunalen Kläranlage zugeführt wer-
Zink (Zn) mg/l 0,1 den kann.
207Stefan Schlumberger
Nachfolgend werden die Betriebserfahrungen aus den Jahren 2015 bis 2019 anhand der
einzelnen Verfahrensstufen erläutert. Für eine detaillierte Beschreibung der einzelnen
Verfahrensstufen sei hier auf eine frühere Publikationsschrift verwiesen [6].
Nach Abschluss der Inbetriebnahme sowie der grundlegenden Optimierung des Ver-
fahrens begann im Februar 2014 der großtechnische Dauerbetrieb. Die Anlage wird
während sieben Tagen pro Woche und 365 Tagen im Jahr betrieben. Für den regulären
Betrieb der gesamten Metallrückgewinnung (Fluwa- und Flurec-Verfahren) werden wo-
chentags im Tagesbetrieb (6:30 bis 15:30 Uhr) drei Personen für den operativen Betrieb
und 1,5 Personalstellen für die prozessbegleitende Analytik und Qualitätsüberwachung
Rückstände aus MVA
benötigt. Die restliche Zeit des Tages, sowie an Wochenenden und Feiertagen, wird die
Anlage vom Schichtbetrieb der KVA mitüberwacht. Wartungs- und Reinigungsarbeiten
werden durch Kurzunterbrechungen im Tagesbetrieb vorgenommen. Neben Betriebs-,
Wartungs- und Unterhaltsarbeiten stellen die Prozess- und Qualitätskontrolle die
wichtigsten operativen Arbeitsfelder dar.
2.1. Saure Flugaschenwäsche
Neben der eigenen Flugasche (FA) wird auch diejenige der Kehrichtverwertung Zür-
cher Oberland KEZO (Hinwil) verarbeitet. Insgesamt werden somit pro Jahr etwa
6.000 Tonnen Flugasche behandelt. Die im sauren Wäscherabwasser enthaltene Salzsäure-
menge ist zur Extraktion der Metalle weitestgehend ausreichend, so dass nur in sehr
geringem Umfang ergänzend technische Salzsäure (80 kg/t FA) mit verwendet werden
muss. Zusätzlich wird noch Wasserstoffperoxid dosiert, damit die Flugaschenextraktion
unter oxidierenden Bedingungen betrieben werden kann. Dies wirkt sich insbesondere
positiv auf die Rückgewinnung der Elemente Blei, Cadmium und Kupfer aus, die sonst
an metallischen Eisen-, Aluminium- und Zinkpartikeln, die in den Flugaschen enthalten
sind, reduktiv abgeschieden und mit der gewaschenen Asche deponiert werden.
Die Metallgehalte der verarbeiteten Flugaschen variieren hinsichtlich der qualitativen
Zusammensetzung (Bild 5). So lag der Zinkgehalt in der Flugasche im Jahr 2018
zwischen 50 und 80 g/kg Trockensubstanz (TS). Ein analoger Konzentrationsverlauf
zeigt sich im Filtrat der sauren Flugaschenextraktion. Dort variierte der Zinkgehalt
zwischen 6 und 16 g/l. Diese Variation spiegelt die Schwankungen im Abfallinput
sowie Veränderungen im thermischen Transferverhalten der Schwermetalle im Ver-
brennungsprozess wider.
Die Korrelation des zeitlichen Verlaufs der Zinkkonzentration in der Flugasche und im
Filtrat bestätigt eine zugrundeliegende, konstante Extraktionsausbeute. Diese lag im
Jahr 2018 bei 75 % (± 5 %). Für die anderen relevanten Schwermetalle Blei, Cadmium
und Kupfer liegen ähnliche zeitliche Konzentrationsverläufe vor. Die durchschnittlich
erreichten Extraktionsausbeuten der Jahre 2015 bis 2018 zeigt Tabelle 2. Blei, Cadmium
und Zink zeigen dabei unter Berücksichtigung der Messunsicherheiten eine annähernd
konstante Extraktionsrate. Bei Kupfer ist ein Anstieg der Extraktionsausbeute im Jahr
2018 erkennbar. Dies wurde durch eine geringfügige Modifikation des pH-Wertes in
der Extraktion erreicht.
208Metallrückgewinnungen aus Flugaschen – Das Flurec-Verfahren und die Branchenlösung SwissZinc
Zinkgehalt im Filtrat Zinkgehalt in Flugasche
g/l g/kg TS
18 100
16 90
14 80
12 70
Rückstände aus MVA
10 60
8 50
6 40
4 30
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Filtrat Flugasche
Bild 5: Zeitliche Variation des Zinkgehalts in der Flugasche und des Filtrates der sauren Flug-
aschenextraktion im Jahr 2018
Tabelle 2: Neben verfahrenstechnischen Parame-
Durchschnittlich erreichte Extrak-
tionsausbeuten der sauren Flug-
tern beeinflussen auch Abfallinhaltsstoffe
aschenwäsche für die Elemente
die erreichbaren Rückgewinnungsraten.
Blei, Cadmium, Kupfer und Zink
der Jahre 2015 bis 2018 So stellt beispielsweise der Schwefel-
gehalt im Abgas bzw. in der neutralen
Blei Cadmium Kupfer Zink
Jahr Wäscherabschlämmung der nassen Ab-
%
gasreinigung eine signifikante Störquelle
2015 45 92 34 70
für die Bleirückgewinnung dar. Liegen
2016 52 93 39 74
im Rohgas hohe SO2-Frachten vor, so
2017 55 92 40 77
kann dies zu einer erhöhten Ausfällung
2018 54 91 52 75
von schwerlöslichem Bleisulfat in der
Flugaschenextraktion führen (Bild 6),
da die saure und neutrale Wäscherabschlämmung bauartbedingt gemeinsam als
Quenchwasser (QW) anfallen und somit direkt der Flugaschenwäsche zugeführt
werden. Zur Ausfällung schwerlöslicher Sulfate tragen dabei primär die beiden
Kationen Calcium und Blei bei. Sinkt nun parallel zum steigenden Sulfatgehalt im
Wäscherabwasser der Calciumgehalt in den Flugaschen, so kommt es zu einer Aus-
fällung von Bleisulfat, da verfügbares Calcium bereits vollständig als Gips ausgefallen
ist. Dieser Umstand ist bei der in Tabelle 2 dargestellten Bleiausbeute bereits berück-
sichtigt. Ohne die Mitfällung von Bleisulfat liegt die Bleiausbeute im Bereich von
75 bis 80 %. Zur langfristig stabilen und effizienten Bleirückgewinnung sind daher
eine bauliche Trennung und eine separate Behandlung der sauren und neutralen
Wäscherabschlämmung empfehlenswert.
209Stefan Schlumberger
Bleigehalt im Filtrat Sulfatgehalt im Quenchwasser
mg/l g/l
2.500 75
2.000 60
Rückstände aus MVA
1.500 45
1.000 30
500 15
0 0
Jan Mär Mai Jul Aug Okt Dez
Bleigehalt im Filtrat Sulfatgehalt im Quenchwasser
Bild 6: Abhängigkeit des Bleigehaltes im Filtrat der sauren Flugaschenwäsche vom Sulfatgehalt
des Quenchwassers
2.2. Zementierung
Im Filtrat der sauren Flugaschenextraktion vorliegende, im Vergleich zu Zink edlere
Metalle, werden in der Zementierung reduktiv durch die Zugabe von Zinkpulver als
Reduktionsmittel abgeschieden. Die zugegebene Menge des Reduktionsmittels ist vom
jeweiligen Gehalt der edleren Elemente abhängig. Anhand der im eigenen Prozesslabor
kontinuierlich analysierten Filtratzusammensetzung wird die Zinkpulverzugabe an-
hand des stöchiometrischen Bedarfs angepasst und optimiert. Pro Jahr werden somit
durchschnittlich etwa 30 Tonnen Zinkpulver benötigt. Wie aus Tabelle 3 ersichtlich,
liegen die Abreicherungsraten der Elemente Blei, Cadmium und Kupfer über 95 %.
Das unedelste von den hier diskutierten Elementen ist Cadmium. Dessen reduktive
Abscheidung durch die Zugabe von Zinkpulver ist demzufolge am schwierigsten, so
dass sich dort kontinuierliche Verbesserungen in der mechanischen Dosierung sowie
der Prozessführung im Verlauf der Jahre 2015 bis 2017 erkennen lassen. Neben der
Optimierung der chemisch relevanten Betriebsparameter wurde zusätzlich ein größe-
rer Filtratvorlagebehälter mit einem Nutzvolumen von 120 m3 zur Homogenisierung
des Zementierungszulaufs integriert. Nachdem das Prozesslabor aus personellen
und wirtschaftlichen Gründen nur wochentags zur Verfügung steht und die Anlage
210Metallrückgewinnungen aus Flugaschen – Das Flurec-Verfahren und die Branchenlösung SwissZinc
im 24-Stundenbetrieb von Montag bis Sonntag gefahren wird, konnten durch diese
Maßnahmen bessere und konstantere Abreicherungsraten erzielt werden. Die hohe
Produktqualität des in der nachfolgenden Elektrolysestufe abgeschiedenen Zinkmetalls
konnte somit sichergestellt werden.
Tabelle 3: Durchschnittlich erreichte Ab- Tabelle 4: Durchschnittliche Zusammenset-
reicherungsraten der Elemente zung des Zementates 2015 bis 2018
Blei, Cadmium, und Kupfer in der
Zementierungsstufe der Jahre 2015 Blei Cadmium Kupfer Silber Zink
bis 2018 %
Rückstände aus MVA
60Stefan Schlumberger
dem Tageskurs an der Börse (London Metal Exchange, LME) abzüglich einer Um-
schmelzgebühr von 200 EUR pro Tonne Zink, da das hier hergestellte Zink nicht im
Standardformat – als Barren gegossen – vorliegt. Eine dafür notwendige Umschmelz-
und Gießanlage ist für die geringe Jahresproduktion von 250 bis 300 Tonnen Zink pro
Jahr nicht rentabel zu betreiben.
Rückstände aus MVA
Bild 7:
Zinkblech auf Euro-Paletten
zu Einheiten von einer Tonne
gebündelt
Der Anlagenteil der Solventextraktion und Zinkelektrolyse ist auf eine Jahresproduktion
von 300 Tonnen Zink bzw. einer maximalen Zinkkonzentration im Filtrat von 12 g/l
ausgelegt. Da aber die abfallbedingten Zinkschwankungen im Input der Flugaschen
bzw. dem resultierenden Filtrat einer größeren Variation unterliegen (Bild 5), kann die
Auslegungskapazität nicht linear über das ganze Jahr erreicht werden. In Zeiten hoher
Zinkgehalte der Flugasche liegt die resultierende Konzentration im Filtrat deutlich
über 12 g/l, so dass der Anteil >12 g/l des zuvor in der Flugaschenwäsche extrahierten
Zinks nicht der Elektrolyse, sondern über den Abwasserschlamm wieder der Feuerung
zugeführt wird. Durch diese Rückführung verteilt sich das in die Feuerung zusätzlich
eingetragene Zink wiederum anteilig auf die beiden Stoffströme Rostasche und Flug-
asche. Der Anteil des Zinks, der erneut in die Flugasche gelangt, wird im System im
Kreis gefahren. Die derzeit durchschnittlich produzierte Jahresmenge an Zink liegt bei
250 Tonnen. Die Optimierung der internen Kreisläufe zur Steigerung der Zinkproduk-
tion auf 300 Tonnen pro Jahr ist Gegenstand laufender Arbeiten.
2.4. Massenbilanz
In Bild 8 ist die Massenbilanz des Flurec-Prozesses für die schwermetallrelevanten
Stoffströme zur Behandlung einer Tonne Flugasche dargestellt. Der Gesamtwirkungs-
grad zur Verwertung des Zinks beträgt derzeit etwa 60 %. Abweichungen der Massen-
bilanz für die Elemente Blei, Cadmium, Kupfer und Zink von ± 7 % resultieren durch
Messunsicherheiten bei der Bestimmung der Massenströme und der dazugehörigen
Elementkonzentration.
212Metallrückgewinnungen aus Flugaschen – Das Flurec-Verfahren und die Branchenlösung SwissZinc
Flugasche 1.000 kg Filterkuchen 780 kg
Zn = 70 kg Cu = 2,2 kg Zn = 18 kg Cu = 1,20 kg
Pb = 12 kg Cd = 0,4 kg Pb = 5,5 kg Cd = 0,03 kg
Abwasserschlamm 100 kg
Zn = 14 kg Cu = 0,06 kg
Pb = 0,4 kg Cd = 0,02 kg
Quenchwasser 3.000 kg FLUREC-
Zn = 2,0 kg Cu = 0,04 kg Verfahren Zementat 11 kg
Pb = 0,2 kg Cd = 0,02 kg Zn = 0,6 kg Cu = 0,90 kg
Rückstände aus MVA
Pb = 6,8 kg Cd = 0,34 kg
Zinkmetall 42 kg
Zn = 42 kg
Zinkpulver 5 kg
Zn = 5,0 kg Abwasser 3.072 kg
Zn = < 0,5 g Cu = < 0,1 g
Pb = < 0,1 g Cd = < 0,1 g
Bild 8: Massenbilanz des Flurec-Verfahrens, dargestellt für die schwermetallrelevanten Stoff-
ströme zur Behandlung einer Tonne Flugasche
2.5. Fazit
Das Flurec-Verfahren ist nun seit fünf Jahren erfolgreich unter industriellen Bedin-
gungen im Dauerbetrieb. Insbesondere die verfahrenstechnisch sehr robuste Kombi-
nation aus Zementierung und Solventextraktion gewährleistete eine konstant hohe
Zinkproduktqualität. Abfallinputbedingte Qualitätsschwankungen konnten damit
gut abgefangen werden, so dass dies keine negativen Auswirkungen auf die Produkte
sowie deren Wert hatte. Eine Verbesserung der Zinkausbeute und die Minimierung
prozessinterner Verluste sollen in den nächsten Monaten erreicht werden.
Der Übergang von der Abfallverbrennung, einst als stoffliche Vernichtung gesehen,
hin zur Produktion eines hochwertigen, hochreinen Metalls mit gleichbleibend hoher
Qualität stellte das bestehende Personal vor große Herausforderungen, die im Verlauf
der Optimierungsphasen sukzessive angegangen und gelöst wurden. Heute arbeitet
die Anlage zuverlässig und beweist, dass die Abfallverbrennung einen wichtigen Teil
zur ökoeffizienten Schließung von Stoffkreisläufen beitragen kann.
3. SwissZinc
Wie bereits einleitend erwähnt, gilt für Betreiber von Schweizer Abfallverbrennungsan-
lagen ab dem Januar 2021 eine gesetzliche Metallrückgewinnungspflicht aus den dort
anfallenden Flugaschen. Zur Erfüllung der Vorgaben muss die saure Flugaschenwäsche
als erste Behandlungsstufe angewendet werden. Anschließend kann einerseits das
Flurec-Verfahren zur direkten Metallrückgewinnung oder die ausländische Verwer-
tung der Zinkhydroxidschlämme praktiziert werden. Bei letztgenannter dominiert
213Stefan Schlumberger
mengenmäßig die thermische Verwertung in Drehrohröfen, dem sogenannten Wälz-
verfahren. Die dafür verrechneten Behandlungs- und Verwertungskosten pro Tonne
Hydroxidschlamm wurden für die Schweizer Abfallbehandlungsanlagen einerseits nicht
transparent und offen nachvollziehbar dargelegt, und anderseits der darin enthaltene
Metallgehalt nicht vergütet. Die Preisgestaltung unterlag zudem großen Schwankungen
jenseits wechselkursbedingter Faktoren, so dass die Kostensituation für die Anlagen-
betreiber langfristig unsicher und nicht zufriedenstellend war.
Da mit dem Flurec-Verfahren die Metallrückgewinnung aus den Flugaschen im in-
dustriellen Maßstab erfolgreich gezeigt werden konnte, wurde eine auf dieser Techno-
Rückstände aus MVA
logie basierende nationale Metallrückgewinnungsanlage (SwissZinc) geplant. Die
flächendeckende Umsetzung des Flurec-Verfahrens auf allen Anlagen, die heute und
zukünftig eine saure Flugaschenwäsche betreiben, wäre sowohl betrieblich als auch
wirtschaftlich nicht zielführend. Der Verband der Betreiber Schweizerischer Abfall-
verwertungsanlagen (VBSA) gründete daraufhin im Jahre 2016 die SwissZinc AG. Sie
wurde von 27 der 29 Schweizer KVAs beauftragt, die Machbarkeit einer gemeinsamen
Rückgewinnungsanlage in technischer und rechtlicher Hinsicht zu prüfen. Dabei sollen
Synergien und Skaleneffekte durch die zentralisierte Aufbereitung möglichst optimal
genutzt werden. Die gemeinsame Aufbereitungsanlage soll neben der KEBAG am
Standort Zuchwil (SO) errichtet werden. Weiter soll sie nicht gewinnorientiert aber
kostendeckend betrieben werden. Die anliefernden KVAs werden Aktionäre der Anlage
und kontrollieren diese. Dieser Ansatz gewährleistet eine effiziente und gesetzeskon-
forme Metallrückgewinnung sowie die totale Transparenz der Behandlungskosten und
langfristige Planungssicherheit.
Das Konzept basiert dabei auf der regionalen Behandlung der Flugaschen mit dem
Prozess der sauren Flugaschenwäsche und einer anschließenden, zentralen Aufbe-
reitung der lokal anfallenden Hydroxidschlämme. Die Metallrückgewinnung erfolgt
durch eine salzsaure Laugung der Hydroxidschlämme. Blei, Cadmium und Kupfer
werden dabei über eine Zementierung als Metallkonzentrat abgetrennt und verwertet.
Zink wird mittels Solventextraktion und Elektrolyse als special high grade Zink zurück
gewonnen und anschließend vermarktet. Die erreichten Rückgewinnungsgrade der
Metalle Zink, Blei und Cadmium lagen über 95 %. Für Kupfer konnte eine Ausbeute
> 80 % realisiert werden.
Abschließend wurde der SwissZinc-Prozess mit den heute mengenmäßig dominieren-
den Wälzverfahren und der anschließenden Zinkverhüttung des Wälzoxides ökolo-
gisch verglichen [5]. Datengrundlage bildeten die im SwissZinc-Projekt erarbeiteten
Kenngrößen, Betriebsdaten der Flurec-Anlage sowie die aktualisierte Umwelterklärung
der Befesa Zinc Freiberg GmbH aus dem Jahre 2016 [4]. Für die Verhüttung des Wälz-
oxids wurden die gleichen Rahmenbedingungen wie bei der SwissZinc-Elektrolyse
zugrunde gelegt. Die funktionelle Einheit der Ökobilanz betrug 1 kg special high grade
Zink (SHG Zink, > 99.995 % Reinheit). Die Umweltauswirkung ist für die beiden Me-
thoden bezüglich der ökologischen Knappheit (Umweltbelastungspunkte UBP) sowie
des Global Warming Potentials (GWP) in Bild 9 dargestellt. In beiden Fällen weist das
SwissZinc-Verfahren eine geringere Umweltbelastung auf.
214Metallrückgewinnungen aus Flugaschen – Das Flurec-Verfahren und die Branchenlösung SwissZinc
ökologische Knappheit (UBP) Global Warming Potential (GWP)
UBP/kg Zink kg CO2-eq/kg Zink
7.000 8
6.000 7
6
5.000
5
Rückstände aus MVA
4.000
4
3.000
3
2.000
2
1.000 1
0 0
SwissZinc Waelz+Zinkhütte SwissZinc Waelz+Zinkhütte
Transporte Emissionen Wasser Transporte Betriebsmittel
Emissionen Luft Bilanz UBP Emissionen Luft Bilanz CO2-eq
Betriebsmittel
Bild 9: Ökologischer Vergleich des SwissZinc-Verfahrens mit dem Export von Hydroxid-
schlämmen und der Verwertung mittels Wälz- und Zinkverhüttungs-Verfahren
(Waelz+Zinkhütte) mit den Methoden der ökologischen Knappheit (UBP) und Global
Warming Potential (GWP, CO2-Equivalente)
Quelle: M. Haupt, S. Hellweg, ETH Zürich, 2018
Unter der Voraussetzung, dass nahezu 100 % der schweizweit anfallenden Hydroxid-
schlämme mit SwissZinc aufbereitet werden, liegen die Kosten für den Bahntransport
zur SwissZinc-Anlage und die Verwertung der Schlämme bei etwa 220 CHF pro Tonne
Hydroxidschlamm (30 % TS). Unter Berücksichtigung der aktuellen Planungsunsicher-
heiten und zukünftiger Preisschwankungen in der Betriebsmittelbewirtschaftung und
dem Produkteverkauf, werden die Verwertungskosten durch das SwissZinc-Verfahren
mit denjenigen der alternativen Verwertungswege in einer ähnlichen Größenordnung
liegen.
Nach Abschluss der Machbarkeitsstudie stimmten im April 2018 28 von 29 KVAs
einer Weiterführung des Projektes zu. Aktuell laufen die Vertragsverhandlungen mit
den Parteien. Bis Anfang 2020 sollen die langfristigen Verträge unterzeichnet und das
Bauprojekt begonnen werden. Mitte 2022 wird nach dem Abschluss des Bauprojektes
eine genauere Investitions- und Betriebskostenermittlung vorliegen, die einen fun-
dierten Realisierungsentscheid ermöglichen soll. Nach diesem Entscheid wird mit der
Inbetriebnahme der Anlage im Jahre 2024 gerechnet.
215Stefan Schlumberger
SwissZinc – als Branchenlösung zur effizienten Metallrückgewinnung aus KVA-Flug-
aschen – ermöglicht die Bündelung der Kräfte zur Effizienzsteigerung und gezielter
Nutzung von Synergien. Dies stellt langfristig sowohl ökologisch als auch ökonomisch
die optimalste Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur Metallrückgewinnungspflicht
aus Flugaschen dar.
4. Literatur
[1] Bundesamt für Umwelt (BAFU): Abfallstatistik der Jahre 2010 bis 2017, Bern
Rückstände aus MVA
[2] Bundesamt für Umwelt (BAFU): Gewässerschutzverordnung (GSchV), vom 28.Oktober 1998,
Bern, Stand 01.06.2018
[3] Bundesamt für Umwelt (BAFU): Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von
Abfällen (Abfallverordnung, VVEA) vom 4. Dezember 2015, Bern, Stand 01.01.2019
[4] Hasche, U.; Seidel, J.: Aktualisierte Umwelterklärung der Befesa Zinc Freiberg GmbH, Freiberg,
2016
[5] Haupt, M.; Hellweg, S.: Studie zum ökologischen Vergleich der Zink-Produktion aus KVA-
Hydroxidschlämmen: SwissZinc-Verfahren und Befesa-Verfahren, ETH Zürich, 2018
[6] Schlumberger, S.; Bühler, J.: Metallrückgewinnung aus Filterstäuben der thermischen Abfall-
behandlung nach dem FLUREC-Verfahren. In: Thomé-Kozmiensky, K. J. (Hrsg.): Aschen •
Schlacken • Stäube – aus Abfallverbrennung und Metallurgie. Neuruppin: TK Verlag Karl
Thomé-Kozmiensky, 2013, S. 377-396
Ansprechpartner
Dr. rer. nat. Stefan Schlumberger
Stiftung Zentrum für nachhaltige Abfall- und Ressourcennutzung (ZAR)
Leiter Kompetenzzentrum Hydrometallurgie
Emmenspitz
4528 Zuchwil, Schweiz
+41 32 686 5430
stefan.schlumberger@kebag.ch
216Energie aus Abfall
Thiel, Thomé-Kozmiensky, Quicker, Gosten Energie aus Abfall 16
Thomé-Kozmie
nsky und Beck
mann Energie aus Abf
all 14
Thomé-Kozmiensky und Beckmann Energie aus Abfall 12
1
Energie aus Abfall
Energie aus Abfall 11
Thomé-Kozmiensky und Beckmann Energie aus Abfall 7
Energie aus Abfall 10
Energie aus Abfall 9
ll 8
s Abfa
Energie aus Abfall 15
ie au
Thomé-Kozmiensky und Beckmann Energie aus Abfall 6
Energ
Beckmann
Thomé-Kozmiensky und Beckmann
Thomé-Kozmiensky und Beckmann
Thomé-Kozmiensky und Beckmann
mann
Thomé-Kozmiensky und Beckmann Energie aus Abfall 5
Beck
Thiel, Thomé-Kozmiensky, Quicker, Gosten
Thomé-Kozmiensky
und
nsky
Thomé-Kozmiensky und Beckmann Energie aus Abfall 4
zmie
é-Ko
Thomé-Kozmiensky und Beckmann Energie aus Abfall 3
Thom
Thomé-Kozmiensky Beckmann Energie aus Abfall 2
Herausgeber: Thomé-Kozmiensky (et. al)
Energie aus Abfall, Band 1 (2006) ISBN: 978-3-935317-24-5 20,00 EUR
Energie aus Abfall, Band 2 (2007) ISBN: 978-3-935317-26-9 20,00 EUR
Energie aus Abfall, Band 3 (2007) ISBN: 978-3-935317-30-6 20,00 EUR
Energie aus Abfall, Band 4 (2008) ISBN: 978-3-935317-32-0 20,00 EUR
Energie aus Abfall, Band 5 (2008) ISBN: 978-3-935317-34-4 20,00 EUR
Energie aus Abfall, Band 6 (2009) ISBN: 978-3-935317-39-9 30,00 EUR
Energie aus Abfall, Band 7 (2010) ISBN: 978-3-935317-46-7 30,00 EUR
Energie aus Abfall, Band 8 (2011) ISBN: 978-3-935317-60-3 30,00 EUR
Energie aus Abfall, Band 9 (2012) ISBN: 978-3-935317-78-8 30,00 EUR
Energie aus Abfall, Band 10 (2013) ISBN: 978-3-935317-92-4 50,00 EUR
Energie aus Abfall, Band 11 (2014) ISBN: 978-3-944310-06-0 50,00 EUR
Energie aus Abfall, Band 12 (2015) ISBN: 978-3-944310-18-3 50,00 EUR
Energie aus Abfall, Band 13 (2016) ISBN: 978-3-944310-24-4 75,00 EUR
Energie aus Abfall, Band 14 (2017) ISBN: 978-3-944310-32-9 75,00 EUR
Energie aus Abfall, Band 15 (2018) ISBN: 978-3-944310-39-8 100,00 EUR
Energie aus Abfall, Band 16 (2019) ISBN: 978-3-944310-45-9 100,00 EUR
Paketpreis 490,00 EUR
Energie aus Abfall, Band 1 bis 16 statt 720,00 EUR
Bestellen Sie direkt beim TK Verlag oder unter www. .de
TK Verlag GmbH
Dorfstraße 51
D-16816 Nietwerder-Neuruppin
Tel. +49.3391-45.45-0 • Fax +49.3391-45.45-10
E-Mail: order@vivis.deVorwort
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im
Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar
Stephanie Thiel, Elisabeth Thomé-Kozmiensky,
Thomas Pretz, Dieter Georg Senk, Hermann Wotruba (Hrsg.):
Mineralische Nebenprodukte und Abfälle 6
– Aschen, Schlacken, Stäube und Baurestmassen –
ISBN 978-3-944310-47-3 Thomé-Kozmiensky Verlag GmbH
Copyright: Elisabeth Thomé-Kozmiensky, M.Sc., Dr.-Ing. Stephanie Thiel
Alle Rechte vorbehalten
Verlag: Thomé-Kozmiensky Verlag GmbH • Neuruppin 2019
Redaktion und Lektorat: Dr.-Ing. Stephanie Thiel, Dr.-Ing. Olaf Holm,
Elisabeth Thomé-Kozmiensky, M.Sc.
Erfassung und Layout: Elisabeth Thomé-Kozmiensky, Claudia Naumann-Deppe, Sarah Pietsch,
Janin Burbott-Seidel, Ginette Teske, Roland Richter,
Cordula Müller, Gabi Spiegel
Druck: Universal Medien GmbH, München
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die
der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen,
der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung,
vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im
Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland vom 9. September 1965 in der jeweils geltenden Fassung zulässig.
Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmun-
gen des Urheberrechtsgesetzes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürfen.
Sollte in diesem Werk direkt oder indirekt auf Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien, z.B. DIN,
VDI, VDE, VGB Bezug genommen oder aus ihnen zitiert worden sein, so kann der Verlag
keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernehmen. Es empfiehlt sich,
gegebenenfalls für die eigenen Arbeiten die vollständigen Vorschriften oder Richtlinien in der
jeweils gültigen Fassung hinzuzuziehen.
4Sie können auch lesen