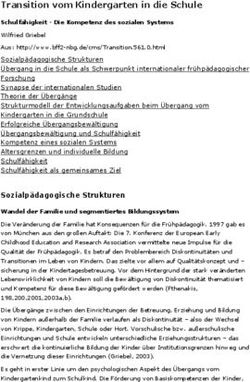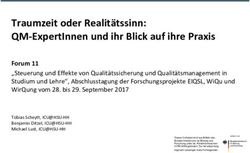Transferstrategie 2016-2020 - Uni Kassel
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
2016–2020 Transferstrategie
TRANSFERSTRATEGIE 2016–2020 (beschlossen vom Senat der Universität am 08.02.2017)
Im Entwicklungsplan der Universität Kassel für die Jahre 2015 bis 2019 wurde niedergelegt, dass die
Transferstrategie der Hochschule eine Aktualisierung erfahren soll, die die weitere strategische Ent-
wicklung des Handlungsbereichs Wissenstransfer ersichtlich macht. Die vorliegende Transferstrategie
kommt dieser Aufgabe nach und knüpft zugleich an die Transferstrategie der Jahre 2011 bis 2015 an.
Im Folgenden wird also insbesondere entfaltet, wie die bisherigen „Angebots- bzw. Nachfrageorien-
tierungen“ durch das neue Paradigma eines „gestaltungsorientierten Transfers“ weiterentwickelt
werden können. Gestaltungsorientierter Transfer nimmt in besonderer Weise Schwerpunktfelder der
gesellschaftlichen Entwicklung für künftige Transferaktivitäten der Hochschule in den Blick und lässt
wissenschaftliche Erkenntnis in der Zusammenarbeit mit anderen gesellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Akteuren dort wirksam werden, wo der Handlungsdruck aus gesellschafts- und wissenschaftspo-
litisch bestimmten Schwerpunktsetzungen heraus als besonders hoch anzusehen ist. Den Anspruch,
durch „Offenheit und Verantwortungsbewusstsein gegenüber Herausforderungen in Natur und Gesell-
schaft“ zur Lösung von Zukunftsfragen beitragen zu wollen, hat die Hochschule schon 2007 in ihrem
Leitbild zu einem Maßstab ihres Handelns und ihrer weiteren Entwicklung gemacht.
A. Wissenstransfer als strategische Hochschulaufgabe
A.1 Mehrwerte durch Wissenstransfer
Mit ihrem Konzept „Von der Grundlagenforschung bis zur Anwendung“ nimmt sich die Universität
Kassel seit ihrer Gründung gesellschaftlicher Herausforderungen an und generiert Lösungsangebote
von der lokalen bis zur globalen Ebene. In besonderer Weise ist die Hochschule dabei mit ihrer Region
Nordhessen verbunden und sieht sich in der Verantwortung, wirksam zu deren Entwicklung beizutra-
gen. Die Universität Kassel wirkt in dieser Rolle bereits jetzt als Innovationsmotor für ihr Umfeld¹ und
sie möchte diese Funktion in Zukunft noch weiter ausbauen. Hierfür stellt die Universität ihre in der
Forschung erarbeiteten Kompetenzen in Wirtschaft und Technik, Klima und Umwelt, Bildung, Kultur
und Soziales den Partnern in der Region zur Verfügung.
Im Sinne eines lernenden Systems wirkt ein gelungener Wissenstransfer dabei – so formuliert es der Ent-
wicklungsplan 2015–2019 – nicht nur nach außen, sondern er generiert auch intern Mehrwerte für Forschung
und Lehre, bis hin zur Perspektive der Beschäftigungsfähigkeit der Absolventinnen und Absolventen.
Die Universität greift Forschungsfragen aus dem gesellschaftlichen Kontext auf und validiert Forschungs
ergebnisse in der Praxis. In der Lehre wird durch zahlreiche Kooperationsbeziehungen mit Partnern
aus Wirtschaft und Gesellschaft der Praxisbezug sichergestellt und die Beschäftigungsfähigkeit (Employ
ability) der Absolventinnen und Absolventen befördert.
Grundsätzlich definiert die Universität Kassel Wissenstransfer als Austauschbeziehung zum wechsel-
seitigen Vorteil – als Alternative und in Abgrenzung zu einer Vermarktungs- oder Verwertungslogik des
¹ Schon heute werden etwa durch Ausgründungen aus der Universität 10 500 Arbeitsplätze direkt oder indirekt bereitgestellt
(Beckenbach / Daskalakis / Hofmann: Die ökonomische Bedeutung der Universität Kassel für die Region Nordhessen, 2011).
1Wissenstransfers. In diesem Verständnis ist Wissenstransfer an der Universität Kassel keine zusätz
liche Aufgabe, sondern ist als strategische Kernaufgabe inhärent mit Forschung und Lehre verbunden.
Nur so wird nach Auffassung der Universität Kassel eine nachhaltige Basis dafür geschaffen, dass der
Wissenstransfer positive Wirkungen in der Gesellschaft entfaltet.
A.2 Hochschulgovernance und Unterstützungsstruktur
Im Entwicklungsplan 2015–2019 der Universität Kassel ist der Wissenstransfer als Kernaufgabe der
Hochschule zusammen mit Forschung, Lehre und Nachwuchsförderung verankert. Grundsätzlich ge-
tragen wird er von den Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern und Studierenden in vielfältiger Form
und mit unterschiedlichsten hochschulexternen Partnern. Die Umsetzung der Transferstrategie wird
als Leitungsaufgabe im Geschäftsbereich des Kanzlers wahrgenommen und sie wird als integraler
Bestandteil von Verfahren und Instrumenten der Hochschulsteuerung berücksichtigt:
• Auf institutioneller Ebene gibt sich die Hochschule mit der vorliegenden Transferstrategie eine
übergreifende, auf fünf Jahre angelegte Strategie, die Ziele und Ansatzpunkte des Entwicklungs
planes aufgreift.
• Die fächerspezifischen Transferaktivitäten auf Fachbereichsebene werden fortgeschrieben im
Rahmen der fünfjährlich mit dem Präsidium zu vereinbarenden Strukturplanung.
• Transferbezogene Aktivitäten der einzelnen Fachgebiete sind Bestandteil der Berufungsverein
barungen und der zu ihrer Überprüfung und Fortschreibung dienenden Fünfjahresberichte und
-gespräche.
• Lehrbezogene Maßnahmen, etwa der berufsbegleitenden Weiterbildung, werden alle zwei Jahre
im Rahmen der Lehrberichte erörtert.
• Transferbezogene Aktivitäten der einzelnen Fachgebiete sind Bestandteil der vom Senat der Uni-
versität festgelegten Kriterien für besondere Leistungsbezüge im Rahmen der W-Besoldung.
• Die zentrale Transferorganisation UniKasselTransfer fördert und unterstützt gezielt die Transfer-
potenziale der Fächer – zumal mit dem von der Hochschule formulierten Anspruch der Interdiszip-
linarität. Mit der Einrichtung von UniKasselTransfer hat die Universität ein Gesicht für den Wissen-
stransfer etabliert, das nach innen und außen dessen Bedeutung für die Universitätsentwicklung
sichtbar macht und zur Profilbildung beiträgt. UniKasselTransfer ist methodischer Begleiter und
Impulsgeber für die Fachbereiche sowie ihre externen Partner und unterstützt dort, wo der Wis-
senstransfer aus methodischen oder ressourciellen Gründen vor besonderen Herausforderungen
steht. Sämtliche Unterstützungsangebote sind in dieser Einrichtung gebündelt. Sie reichen von
der Unterstützung von Innovationsprozessen zwischen Universität und Wirtschaft über die Grün
dungsförderung und das Patentmanagement, die Entwicklung und Organisation von Angeboten
zur Weiterbildung sowie des dualen Studiums bis hin zur Förderung der Zusammenarbeit mit der
Zivilgesellschaft durch das Lehrformat des Service Learning. Die Angebote von UniKasselTrans-
fer werden durch Tochtergesellschaften ergänzt, die auf bestimmte marktorientierte Transferberei-
che spezialisiert sind (UNIKIMS Management School, GINo Patentvermarktungsagentur, Science
Park Kassel GmbH) (→ Abbildung 1)
2UniKasselTransfer
Strategische Planung / Kooperationsmanagement
Innovationsmanagement
Career Service Service Learning
und Produktentwicklung
Patentmanagement Weiterbildung Alumni Service
Gründungsberatung /
Duales Studium Bürgeruniversität
Inkubator
GINo mbH SCIENCE PARK KASSEL GmbH UNIKIMS GmbH
Patentvermarktungsagentur Gründungs- und Innovationszentrum Management School der
der Universität Kassel der Universität Kassel Universität Kassel
Abbildung 1: Transferorganisation der Universität Kassel
Das Zusammenspiel zwischen den originären Interessenlagen der Wissenschaftlerinnen, Wissen-
schaftler und Studierenden und dieser professionellen Unterstützungsstruktur wird auch weiterhin ein
wesentlicher Erfolgsfaktor für den Ausbau des Wissenstransfers als strategisch relevante Hochschul-
aufgabe und für sein Hineinwirken in die Region sein.
B. Stand der Entwicklung
B.1 Konzeptionelle Entwicklung von 2003 bis 2015
Für die Universität Kassel lässt sich der Entwicklungsprozess des Wissenstransfers anhand von zwei
bisherigen Entwicklungsstufen beschreiben, denen von Senat und Hochschulleitung beschlossene
Strategiekonzepte zugrunde liegen:
a) Nachfrageorientierter Wissenstransfer: Mit dem Beschluss zur Einrichtung von UniKassel-
Transfer im Jahr 2002 verband die Hochschule das Ziel, „die institutionellen Voraussetzungen für
eine Stärkung des Wissenstransfers als strategisches Profilmerkmal der Universität zu verbes
sern“ (Präsidiumsbeschluss vom 16.12.2002). Damit verbunden ist die Aufgabenstellung, Transfer-
anfragen aus Wirtschaft und Gesellschaft zuverlässig in die Hochschule an die jeweils relevanten
Ansprechpartner zu vermitteln und bis zu einer erfolgreichen Umsetzung zu begleiten. Zugleich
werden für die Universität relevante Kooperationspartner von UniKasselTransfer aktiv angespro-
chen und für Projekte gewonnen.
b) Angebotsorientierter Wissenstransfer: Eine strategische Weiterentwicklung formulierte nachfol-
gend die Transferstrategie für die Jahre 2011 bis 2015. Mit dieser wurde das eingangs erläuterte
„Zusammenspiel des Wissenstransfers mit den Aufgaben in Forschung und Lehre“ (Senatsbeschluss
3vom 13.07.2011) zur Leitlinie der weiteren Entwicklung. Die Angebotspotenziale der Universität sollen
nunmehr aktiver für die Region mobilisiert werden. Dabei setzt die Hochschule zwei Schwerpunkte:
• Sie legt fest, dass „in der Zusammenarbeit mit externen Partnern ein Schwerpunkt auf den
Aufbau und die Pflege dauerhafter Formen der Interaktion gelegt wird“ (Senatsbeschluss vom
13.07.2011). Als eine Ausprägungsform strategischer Partnerschaften sind sog. „Anwendungs-
zentren“ entstanden, in denen besonders deutlich markiert wird, wie relevant die Kooperation für
beide Seiten ist. Die Zentren sind verbindliche Plattformen für dauerhafte Zusammenarbeit und ver-
fügen über entsprechend fachlich spezialisiertes Personal sowie eine infrastrukturelle Ausstattung.
• Geborene Partner für Kooperationen im strategischen Sinne sind zudem aus der Forschung
entstandene und entstehende Spin-offs. Sie pflegen nachweislich intensivere Transferkanäle
als andere Unternehmen und sind daher für die Universität von besonderer Bedeutung. Nicht
zuletzt auch deshalb hat die Universität ihre Gründungsförderung in dieser Phase über alle
Fachbereiche hinweg substanziell ausgebaut.
B.2 Erfolge
Hervorzuheben sind die erfolgreichen Beteiligungen an bundesweiten Wettbewerben:
• Im Programm „EXIST-Gründerhochschule“ des BMWi ist die Universität Kassel im Jahr 2013 als
eine von drei Universitäten bundesweit als Gründerhochschule ausgezeichnet worden.
• Im Wettbewerb „Mehr als Forschung und Lehre“ wurde sie im Jahr 2011 mit ihrem Antrag „Praktisch
Freiwillig“ vom Stifterverband und der Stiftung Mercator als eine von sechs Hochschulen ausgewählt.
In der Weiterentwicklung ihres Wissenstransfers konnte die Universität in den letzten Jahren markante
Vorhaben entwickeln:
a) Im Zusammenwirken mit der regionalen Wirtschaft hat die Universität ihre strategischen Partner-
schaften weiter ausgebaut und Anwendungszentren geschaffen:
• Fest etabliert ist das im Jahr 2014 mit der B. Braun Melsungen AG begründete Anwendungs
zentrum Kunststoffverarbeitung UNIpace.
• Neu geschaffen wurde das Fachgebiet Gießereitechnik und das damit verbundene Gießerei-
technikum mit Unterstützung von Industriepartnern, insbesondere der Volkswagen AG. In dem
2013 gegründeten Industrie-Förderkreis „Innovativer Gussleichtbau“ wirken 25 Unternehmen
aus der Branche mit.
• Es entstand das House of Energy e. V., mit dem Unternehmen der Energiewirtschaft, die Uni-
versität Kassel, das Fraunhofer Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik (Fraunhofer
IWES) sowie weitere hessische Hochschulen unter Beteiligung des Landes Hessen im Jahr
2016 eine Transferplattform gegründet haben, um die Energiewende in Hessen effektiv und
effizient zu gestalten.
•
b) In Bereichen, die nicht auf technologische Anwendung von Wissen ausgerichtet sind, hat die
Hochschule die Zusammenarbeit mit regionalen Akteuren anderer gesellschaftlicher Bereiche
vorangetrieben:
4• Gemeinsam mit der Stadt Kassel wurde das Transfer- und Anwendungszentrum Sport in
Kassel (TASK) etabliert, dessen Aufgabe es ist, sportbezogene Projekte aus der wissenschaft-
lichen Forschung in die praktische Anwendung zu bringen. Mit dem Bau einer Sporthalle wird
bis 2019 zusammen mit dem Land Hessen und der Stadt Kassel eine dauerhafte Infrastruktur
für TASK geschaffen.
• Die 2013 vereinbarte strategische Partnerschaft des Instituts für Erziehungswissenschaft mit
der Offenen Schule Waldau und der Reformschule Kassel dokumentiert, wie die Universität
Verantwortung für die Weiterentwicklung von Schulen der Region übernimmt („Lehrerbildung
für die Region“).
• Für den erfolgreichen Ausbau des Service Learning bildet die im Zuge der o. g. Förderung dauer
haft etablierte Kooperation mit der Liga der Freien Wohlfahrtspflege und dem Kasseler Freiwilligen
zentrum eine entscheidende Grundlage. Mit 25 Lehrveranstaltungen pro Semester gilt die
Universität Kassel in diesem Feld mittlerweile als führend in der deutschen Hochschullandschaft.
c) Für umfassend verstandene Personalentwicklung bietet die Universität Unternehmen und Organi-
sationen der Region fest etablierte Kooperations- und Angebotsstrukturen:
• Die Zusammenarbeit im ausbildungsintegrierten dualen Studium („Studium im Praxisver
bund“) für alle technik- und wirtschaftswissenschaftlichen Studiengänge konnte auf 25 Unter-
nehmen ausgedehnt werden.
• Die gemeinsam mit der nordhessischen Wirtschaft getragene Management School UNIKIMS
GmbH ist mit 9 berufsbegleitenden Master-Studiengängen und knapp 900 Studierenden einer
der erfolgreichsten Weiterbildungsanbieter bundesweit.
d) Gründungsförderung als strategischer Schwerpunkt des Wissenstransfers konnte spürbar intensi-
viert werden:
• Das neue Forschungs- und Lehrzentrum für unternehmerisches Denken und Handeln
(FLUDH) – das zentrale Vorhaben des Beitrags der Universität Kassel im EXIST-Wettbewerb
– hat die Integration entsprechender Lehrinhalte in die Studiengänge deutlich vorangebracht.
In 60 Prozent der Studiengänge können Studierende mittlerweile Veranstaltungen zu unterneh-
merischem Denken und Handeln belegen.
• Am jährlich stattfindenden UNIKAT Ideenwettbewerb werden zwischenzeitlich bis zu 60 Grün-
dungsideen eingereicht, fünf bis zehn neue Unternehmen werden pro Jahr von Studierenden
und Wissenschaftlerinnen bzw. Wissenschaftlern gegründet und erweitern den Kreis der etwa
400 Unternehmen, die bislang aus der Universität entstanden sind.
e) Ein Meilenstein für die strategische Entwicklung des Wissenstransfers der Universität Kassel ist
der Anfang 2015 eröffnete Science Park Kassel. Das Gründungs- und Innovationszentrum, in
dessen Bau auf dem Campus ca. 13 Mio. Euro investiert worden sind, ist mit 40 angesiedelten
Ausgründungen bereits nahezu ausgelastet.
5Auf Bundes- und auf Landesebene übernimmt die Universität Kassel besondere Verantwortung für die
Weiterentwicklung des hochschulübergreifenden Wissenstransfers:
• Die Universität Kassel ist Sprecherhochschule des Hochschulnetzwerkes Bildung durch Ver
antwortung e. V. und zugleich Sitz von dessen Geschäftsstelle. Ebenfalls an der Universität Kassel
angesiedelt ist die Geschäftsstelle des Bundesverbandes für wissenschaftliche Weiterbildung.
• Auf Landesebene organisiert die Universität Kassel im Auftrag des Hessischen Ministeriums für
Wissenschaft und Kunst den hessischen Ideenwettbewerb zur Gründungsförderung und den
hessischen Verbund zur Patentverwertung (WIPANO).
C. Strategische Weiterentwicklung 2016 bis 2020: „Gestaltungsorientierter Transfer“
Auch in den kommenden Jahren will die Universität Kassel den Wissenstransfer konzeptionell und
strategisch fortentwickeln. In einer nächsten Entwicklungsstufe strebt die Hochschule an, ihre Rolle
als gestaltender Akteur in gesellschaftlichen Veränderungs- und Innovationsprozessen weiter auszu-
bauen (→ Abbildung 2). Die Universität verbindet damit vor allem den Anspruch, zur Befähigung der
Region insbesondere im Umgang mit den sog. „großen gesellschaftlichen Herausforderungen“ bei-
zutragen. Sie möchte für die Zukunftsfähigkeit der Region im Hinblick auf diese herausgehobenen
Felder Verantwortung übernehmen. Die Hochschule bekräftigt hierzu den in ihrem Leitbild formulierten
Anspruch, aus ihrem wissenschaftlichen Profil heraus Lösungsansätze für die Region, aber auch für
die nationale und internationale Ebene zur Verfügung zu stellen und ihnen zu Wirksamkeit nicht nur
in Forschung und Lehre, sondern darüber hinaus in der Gesellschaft zu verhelfen. Hiermit wird noch
einmal die konzeptionelle Distanz zu einer Verwertungslogik (→ A.1) akzentuiert.
Wirkung
Gestaltungsorientiert
Angebotsorientiert
Nachfrageorientiert
Zeit
Einrichtungsbeschluss Transferstrategie I 2011–2015 Transferstrategie II 2016–2020
UniKasselTransfer 2003
Entwicklungsplan 2010–2014 Entwicklungsplan 2015–2019
Abbildung 2: Entwicklungsstufen des Wissenstransfers der Universität Kassel
Der Anspruch der Gestaltungsorientierung hat Konsequenzen sowohl für die strategisch-inhaltliche als
auch für die operative Ausgestaltung des Wissenstransfers der Universität:
• Die Universität definiert für den Wissenstransfer Transferschwerpunktthemen, die die bedeutsa-
men gesellschaftlichen Herausforderungen adressieren und unter denen sich bereits jetzt vielfältige
6Aktivitäten der Hochschule fassen lassen (→ C.1).
• Für die operative Ebene folgt daraus, dass entsprechende Potenziale in Forschung und Lehre,
wenn auch nicht ausschließlich, so doch gezielt für die definierten Schwerpunkte mobilisiert wer-
den können. Über die Nachfrage- und Angebotsorientierung hinausgehend entwickelt die Universi-
tät dafür im Dialog mit den Partnern in Wirtschaft und Gesellschaft das Repertoire von Strukturen
und Formaten des Transfers gestaltungsorientiert fort (→ C.2).
• Die Universität strebt an, die Entwicklung des gestaltungsorientierten Transfers durch eine wissen
schaftliche Evaluation zu begleiten (→ C.3).
C.1 Strategisch-inhaltliche Ausrichtung des Wissenstransfers
Ihr breites Fächerspektrum und der gelebte Anspruch der Interdisziplinarität in Forschung und Lehre
bilden für die Universität Kassel die Potenziale, die es ihr ermöglichen, in allen Feldern des gesell-
schaftlichen Wandels wissenschaftliche Expertise einzubringen: dem ökonomischen Wandel, dem
ökologischen Wandel, dem sozialen Wandel und dem kulturellen Wandel. Wo sie über entsprechende
wissenschaftliche Kompetenzen in Forschung und Lehre verfügt, will die Universität in diesen Wan-
delfeldern fundierte Beiträge leisten. Abgeleitet aus der Entwicklungsplanung der Universität und den
Strukturplanungen der Fachbereiche ergeben sich aus heutiger Sicht die in der Abbildung 3 dargestell-
ten Schwerpunktthemen. Diese sind mit Schlüsselthemen der gesellschaftlichen Entwicklung – den
„großen gesellschaftlichen Herausforderungen“ im Sinne und in der Terminologie des betreffenden
Positionspapiers des Wissenschaftsrates von 2015 – verbunden und adressieren insbesondere die
Bedarfsfelder der neuen Hightech-Strategie der Bundesregierung.
Ökonomischer Ökologischer Sozialer Kultureller
Wandel Wandel Wandel Wandel
Transfer Produktion / Sicher- Klimawandel Gesundheits- Kultur und Künste
schwerpunkte heit und Effizienz vorsorge / bewahren und ent-
der Universität Demographie wickeln
Kassel Material / Sicherheit Energiewende und Bildung und gesell- Sprache und kultu-
und Effizienz Ressourceneffizienz schaftliche Teilhabe relle Teilhabe
Industrie 4.0 Nachhaltige Land- Wahrnehmung und Förderung der Krea-
wirtschaft / Ernäh- Einstellung zur Digi- tivwirtschaft
rung talisierung
Abbildung 3: Schwerpunktthemen des Wissenstransfers nach den gesellschaftlichen Wandelfeldern
Die Schwerpunktthemen haben mit den hierunter jeweils subsumierten Aktivitäten durchgehend einen
starken Bezug zur Standortregion, sind aber grundsätzlich auch als Ausdruck besonderer (überregio-
naler) gesellschaftlicher Verantwortung der Hochschule aufzufassen.
Im Ergebnis wird der Wissenstransfer zwar weiterhin über alle fachlichen Zusammenhänge hinweg
unterstützt, in den definierten Schwerpunkten will die Universität ihre Kompetenzen und Ressourcen
7aber gezielter mit gesellschaftlichen Veränderungsprozessen verbinden. Diese Schwerpunktthemen
definieren den vorrangigen Raum, der es erlaubt, Umsetzungsprojekte, mit denen technologische und
soziale Innovationen unterstützt werden sollen, dialogisch und an den Bedarfen der Region entlang
neu zu entwickeln bzw. zu vertiefen. Die strategische Weiterentwicklung folgt damit der in der High-
tech-Strategie der Bundesregierung formulierten Forderung, Transparenz und Partizipation als grund-
legende Parameter für die gesellschaftliche Akzeptanz von Innovationen „noch konsequenter als bis-
her […] in die Gesellschaft einzubeziehen“.
C.2 Operative Umsetzung: Mobilisierung neuer Potenziale für den gestaltungsorientierten Transfer
C.2.1 Weiterentwicklung der regionalen Governance
In der Universität gut verankerte Forschungsthemen und Kompetenzfelder sind ein zentraler Faktor
für die Standortqualität und die Entwicklungschancen der Region. Während im bislang angebotsori-
entierten Wissenstransfer Transferleistungen nutzerorientiert entwickelt wurden, werden im zukünftig
gestaltungsorientierten Wissenstransfer Transferleistungen zunehmend nutzerintegriert definiert.
Die Universität setzt sich daher zum Ziel, die aus den gegenwärtigen Profilen abgeleiteten Trans-
ferschwerpunkte in der Zukunft systematischer mit den Perspektiven der Regionalentwicklung
abzustimmen und gemeinsam mit der Region jene Forschungs- und Transferfelder zu adressie-
ren, die für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung der Region besonders lohnend
sind. Die Universität möchte dabei mit ihren wissenschaftlichen Kompetenzen zu weitsichtigen
inhaltlichen Prioritätensetzung genauso beitragen wie zum gemeinsamen Dialog der regionalen
Akteure und dem abgestimmten Einsatz verfügbarer Ressourcen.
Es soll daher geprüft werden, ob über die bereits bestehende institutionelle Einbindung der Universität
hinaus (u. a. Mitgliedschaft im Aufsichtsrat des Regionalmanagements und der Vollversammlung der
Industrie- und Handelskammer, Vorstandspositionen in den Clustern der Mobilitätswirtschaft (MoWInet
e.V.) und der dezentralen Energietechnologien (deENet e.V.)) eine neue, durch die Universität Kassel
initiierte Arbeitsplattform zur Bearbeitung von Zukunftsfragen der Regionalentwicklung zielführend ist.
C.2.2 Anforderungen, Strukturen und Formate für dialogische Kooperation
Der Anspruch der Universität, sichtbar gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen und insbeson-
dere ihre Expertise in Forschung und Lehre zur Unterstützung gesellschaftlichen Wandels bzw. gesell-
schaftlicher Transformation sinnvoll einzubringen, lässt sich mit den Arbeitsweisen und Formaten des
nachfrage- und angebotsorientierten Wissenstransfers allein nicht realisieren.
Dies ergänzend und überschreitend muss die Universität für den gestaltungsorientierten Wissenstrans-
fer Strukturen und Formate (weiter)entwickeln und einsetzen, die durch eine inter- und transdisziplinäre
Arbeitsweise, kooperative Themenfindung und Projektentwicklung, gemeinsame Projektumsetzung,
-reflexion und -evaluation sowie eine nachhaltige Implementierung von Lösungen gekennzeichnet sind.
8Der gestaltungsorientierte Wissenstransfer fördert somit die erfolgreiche Realisierung konkreter
Transferthemen, indem Wirtschaft und Gesellschaft mit den Forschenden, Lehrenden und den Stu-
dierenden von der Themensuche bis zur Sicherstellung ihrer Wirksamkeit dialogisch interagieren.
Aus den Fächern heraus sollen die Schwerpunktthemen idealerweise durch organisierte Verbünde von
Fachgebieten bearbeitet werden, die folgende Merkmale aufweisen:
• Das disziplinäre Spektrum der Fachgebiete antwortet umfassend auf einen gesellschaftlichen Bedarf.
• Forschung wird systematisch mit Anwendungsfragen verbunden.
• Externe Partner sind dauerhaft strategierelevant eingebunden, um die Basis für die dialogische
Entwicklung des Transferschwerpunktes zu stärken.
Der gestaltungsorientierte Transfer sollte insbesondere dort ansetzen, wo derartige Voraussetzungen
bereits bestehen. Zu nennen sind hier beispielsweise das Wissenschaftliche Zentrum für Informations-
technikgestaltung (ITeG – Transferschwerpunkte Digitalisierung und Industrie 4.0), das Kompetenzzent-
rum für Klimaschutz und Klimaanpassung (CLiMA – Transferschwerpunkt Klimawandel) oder auch das
Transfer- und Anwendungszentrum Sport in Kassel (TASK – Transferschwerpunkt Gesundheitsvorsorge).
Damit sich der eigene Anspruch erfolgreich implementieren lässt, ist für UniKasselTransfer weiterhin
die arbeitsteilige Interaktion mit den Fachgebieten und deren Kooperationspartnern grundlegend. Hier-
bei ist es erforderlich, die Unterstützungsangebote methodisch weiterzuentwickeln, insbesondere im
Hinblick auf die Generierung und Moderation komplexerer Umsetzungsprojekte.
C.2.3 Transfer über Köpfe
Absolventinnen und Absolventen sind der kräftigste Transmissionsweg neuen Wissens in die Gesell-
schaft und der klassische Weg des Wissenstransfers. Im gestaltungsorientierten Transfer wird dieser
„Transfer über Köpfe“ genutzt, um Zielgruppen zu adressieren, für die entweder ein erhöhter Bedarf
für die innovative Entwicklung der Region konstatiert werden kann (Fachkräftemangel) oder für die
bislang Vermittlungshemmnisse in den Arbeitsmarkt bestehen.
C.3 Wirkungsanalyse
Die Universität betrachtet den Entwicklungsschritt zum gestaltungsorientierten Transfer als eine an-
spruchsvolle Aufgabe, die im Sinne eines lernenden Systems umgesetzt werden sollte. Daher soll
eine wissenschaftliche Wirkungsanalyse aufgebaut werden, mit der die Auswirkungen der jeweiligen
Maßnahmen auf verschiedene Akteursgruppen innerhalb und außerhalb der Universität verlässlich
abgeschätzt werden können. Damit wird eine Grundlage für die gemeinsame Evaluation und Reflexion
von Strukturen und Formaten des gestaltungsorientierten Transfers geschaffen.
9Sie können auch lesen