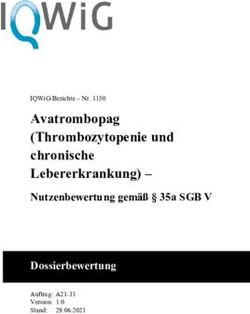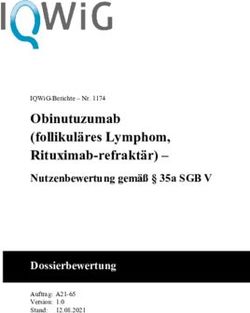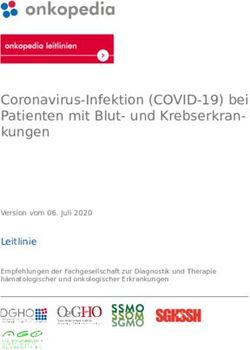Wertigkeit der Sonographie in der Diagnostik der Leistenhernie - eine retrospektive Follow-up-Studie
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Universität Ulm
Medizinische Klinik und Poliklinik
Abteilung für Innere Medizin I
Abteilung für diagnostische und interventionelle Radiologie
Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. med. Thomas Seufferlein
Wertigkeit der Sonographie in der Diagnostik
der Leistenhernie – eine retrospektive
Follow-up-Studie
Dissertation
zur Erlangung des Doktorgrades der Medizin
der Medizinischen Fakultät der Universität Ulm
vorgelegt von
Tanja Sabina Maisenbacher
geboren in Pforzheim
2017Amtierender Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Thomas Wirth 1. Berichterstatter: Prof. Dr. med. Wolfgang Kratzer 2. Berichterstatter: Priv.-Doz. Dr. med. Andreas Hillenbrand Tag der Promotion: 13.12.2018
Teile dieser Dissertation wurden bereits in folgendem Fachartikel veröffentlicht: Maisenbacher T, Kratzer W, Formentini A, Schmidberger J, Kaltenbach T, Henne-Bruns D, Graeter T, Hillenbrand A: Value of Ultrasonography in the Diagnosis of Inguinal Hernia – A Retrospective Study. Ultraschall in der in Medizin, 39: 690-696 (2018) DOI: 10.1055/a-0637-1526
Für meine Familie in Liebe und Dankbarkeit.
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis .................................................................................................... III
1 Einleitung ....................................................................................................................... 1
1.1 Epidemiologie......................................................................................................... 1
1.2 Pathophysiologie und Risikofaktoren .................................................................. 2
1.3 Die klinische Situation........................................................................................... 2
1.4 Bildgebung ............................................................................................................. 4
1.5 Fragestellung .......................................................................................................... 6
2 Material und Methoden ................................................................................................ 7
2.1 Studienrahmen und Studiendesign ...................................................................... 7
2.2 Studienkollektiv ..................................................................................................... 7
2.2.1 Auswahl der Patienten ................................................................................. 7
2.2.2 Ein- und Ausschlusskriterien ....................................................................... 7
2.3 Sonographischer Untersuchungsgang ................................................................. 9
2.4 Studienablauf ....................................................................................................... 12
2.4.1 Retrospektiver Studienteil .......................................................................... 12
2.4.2 Prospektiver Studienteil ............................................................................. 13
2.5 Datenmanagement ............................................................................................... 14
2.5.1 Referenzstandard ........................................................................................ 14
2.5.2 Statistische Auswertung ............................................................................. 16
3 Ergebnisse .................................................................................................................... 17
3.1 Charakterisierung des Patientenkollektivs ....................................................... 17
3.2 Klinische Befunde ................................................................................................ 18
3.3 Sonographische Befunde ..................................................................................... 19
3.3.1 Sonographische Herniengröße ................................................................... 20
3.3.2 Alternative sonographische Diagnosen ...................................................... 21
3.4 Intraoperative Befunde ....................................................................................... 22
3.5 Operationsrate abhängig von der klinischen Untersuchung und
der Sonographie................................................................................................... 23
3.6 Follow-up-Befunde .............................................................................................. 24
3.7 Diagnostische Wertigkeit der Sonographie ....................................................... 25
3.7.1 Vierfeldertafel mit dem Referenzstandard Operation ................................ 25
3.7.2 Vierfeldertafel mit dem Referenzstandard Operation und Follow-up ....... 27
3.7.3 Vierfeldertafel mit dem Referenzstandard Operation, Follow-up und
alternative sonographische Diagnosen ....................................................... 29
3.7.4 Patienten mit positivem Ultraschallbefund ohne Operation ...................... 30
3.7.5 Patienten mit negativem Ultraschallbefund ohne Operation ..................... 30
3.8 Zusammenfassung der Ergebnisse .................................................................... 30
IInhaltsverzeichnis
4 Diskussion ..................................................................................................................... 32
4.1 Diskussion der Methodik .................................................................................... 32
4.1.1 Patientenkollektiv....................................................................................... 32
4.1.2 Referenzstandard ........................................................................................ 32
4.2 Diskussion der Ergebnisse .................................................................................. 36
4.2.1 Charakterisierung des Patientenkollektivs ................................................. 36
4.2.2 Klinische Untersuchung ............................................................................. 37
4.2.3 Sonographische Untersuchung ................................................................... 38
4.2.4 Diagnostische Wertigkeit der Sonographie................................................ 39
4.2.5 Vergleich der Ergebnisse mit anderen Studien .......................................... 42
4.2.6 Vergleich der Ergebnisse mit anderen bildgebenden Verfahren ............... 44
4.3 Rolle der Sonographie im Diagnostikalgorithmus ........................................... 45
4.3.1 Patienten mit positivem Ultraschallbefund ................................................ 45
4.3.2 Patienten mit negativem Ultraschallbefund ............................................... 47
4.4 Limitationen ......................................................................................................... 47
4.5 Schlussfolgerung .................................................................................................. 48
5 Zusammenfassung ....................................................................................................... 50
6 Literaturverzeichnis .................................................................................................... 52
Anhang................................................................................................................................ 59
Abbildungsverzeichnis ................................................................................................. 59
Tabellenverzeichnis ...................................................................................................... 59
Übersicht der Studienlage im Vergleich zur vorliegenden Studie ............................... 61
Patientenanschreiben .................................................................................................... 62
Patienteninformation .................................................................................................... 64
Einwilligungserklärung zur Studie ............................................................................... 66
Einwilligungserklärung zur Einsicht in OP-Befunde ................................................... 67
Fragebogen ................................................................................................................... 68
Danksagung ........................................................................................................................ 70
Lebenslauf .......................................................................................................................... 71
IIAbkürzungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
A. Arteria
BMI Body Mass Index
COPD Chronic Obstuctive Pulmonary Disease
CT Computertomographie
EHS European Hernia Society
ICD International Classification of Diseases
KI Konfidenzintervall
KU Klinische Untersuchung
LH Leistenhernie
Lig. Ligamentum
LR+ positive Likelihood-Ratio
LR- negative Likelihood-Ratio
MRT Magnetresonanztomographie
NPV Negative Prediktive Value (deutsch: Negativ prädiktiver Wert)
OP Operation
PPV Positive Predictive Value (deutsch: Positiv prädiktiver Wert)
STD Standard Deviation (deutsch: Standardabweichung)
SQL Structured Query Language (deutsch: Strukturierte-Abfrage-
Sprache)
TAPP Transabdominelle präperitoneale Patchplastik
US Ultraschall
V. Vena
VPU View Point Ultraschall
IIIEinleitung
1 Einleitung
Leistenbeschwerden sind bei Frauen und Männern häufige Ursachen für eine
Arztkonsultation. Die korrekte Diagnosestellung kann sich hierbei herausfordernd
gestalten, da bei Leistenbeschwerden zahlreiche Differentialdiagnosen in Betracht, deren
genaue Differenzierung klinisch oft nur schwer möglich ist [54,66]. Zurückzuführen ist
dies auf die enge Nachbarschaft verschiedener anatomischer Strukturen in der
Leistenregion wie dem Hüftgelenk, dem Leistenkanal, den Adduktorenansätzen und der
Bauchwand und der daraus resultierenden Vielzahl möglicher Pathologien mit ähnlicher
Beschwerdesymptomatik [5,66]. Leistenhernien (ICD10 K40) nehmen dabei unter den
möglichen Differentialdiagnosen einen Spitzenplatz ein [12]. Der zuverlässige Nachweis
oder Ausschluss einer Leistenhernie ist wichtig, um die Lebensqualität der Betroffenen zu
verbessern und eine lebensbedrohliche Inkarzeration von Darmschlingen zu verhindern
[33].
1.1 Epidemiologie
Die Bedeutung der Erkrankung zeigt sich vor allem in der hohen Anzahl der Operationen,
die jedes Jahr zu deren Therapie durchgeführt werden. Mit mehr als 20 Millionen
Patienten, die weltweit jedes Jahr eine Leistenhernienoperation erhalten, ist diese
Operation international eine der häufigsten [32]. In Deutschland wurden im Jahr 2015
insgesamt 174.974 vollstationäre Patienten mit dieser Diagnose operiert [23]. Bei Männern
waren Leistenhernienoperationen in Deutschland 2015 auf Platz zwei der häufigsten
Operationen [62]. Die Versorgung von Leistenhernien stellt demzufolge einen hohen
Kostenfaktor im Gesundheitssystem dar [22].
Genaue Prävalenz- und Inzidenzzahlen sind nicht bekannt [58]. Trotzdem lassen sich
bezüglich der Epidemiologie der Leistenhernien beim Erwachsenen zwei Punkte
festhalten. Zum einen steigt die Inzidenz mit dem Alter an und zum anderen ist eine
deutliche Häufung bei Männern (etwa 8-10:1) zu beobachten [46,64]. Letzteres zeigt sich
auch in der Betrachtung des jeweiligen Lebenszeitrisikos. Dieses beträgt für Männer 27-
43% und für Frauen 3-6% [9,51,64].
1Einleitung
1.2 Pathophysiologie und Risikofaktoren
Die Pathogenese von Leistenhernien ist multifaktoriell, wobei angenommen wird, dass
einer Schwäche der Fascia transversalis eine grundlegende Rolle bei der Entstehung
zukommt [8,60]. Je nach Bruchpforte werden direkte und indirekte Leistenhernien
unterschieden. Während indirekte Leistenhernien in der Regel angeboren sind, sind direkte
Leistenhernien immer erworben [22]. Pathogenetische Unterschiede zwischen direkten und
indirekten Leistenhernien sind daher anzunehmen, in der Literatur bisher aber nicht
genauer definiert [4]. Ein angeborener Faktor in der Pathogenese der indirekten
Leistenhernie ist beispielsweise ein persistierender offener Processus vaginalis. Allerdings
müssen hier zusätzlich weitere Mechanismen eine Rolle spielen, da nicht jeder offene
Processus vaginalis zu einer Leistenhernie führt [51].
Unabhängig vom Leistenhernientyp existieren unterschiedliche Risikofaktoren für die
Entwicklung einer Leistenhernie, die teils besser, teils weniger gut erforscht sind. Ein
wichtiger intrinsischer Risikofaktor ist neben dem männlichen Geschlecht und dem
steigenden Alter eine positive Familienanamnese [36,64]. Diese wird mit einem achtfach
höheren Risiko assoziiert [36]. Auch eine vorherige Leistenhernie der Gegenseite und
Störungen des Kollagenmetabolismus erhöhen das Risiko an einer Leistenhernie zu
erkranken [3,27,64]. Übergewicht scheint Studien zufolge dagegen eher vor einer
Leistenhernie zu schützen, ist also mit dem Auftreten einer Leistenhernie invers korreliert
[38,56,57]. Ein weiterer Risikofaktor mit einem hohen Evidenzgrad ist eine Prostatektomie
in der Vorgeschichte [41,49,64].
Eine geringere Evidenz respektive eine weniger eindeutige Studienlage besteht für
Faktoren wie beispielsweise die Rasse, eine chronische Obstipation, das Rauchen und
COPD, schweres Heben und eine Schwangerschaft [38,56,64].
1.3 Die klinische Situation
Der Patient berichtet im Anamnesegespräch meist von einer Vorwölbung oder Schwellung
in der Leiste, die beim Hochheben schwerer Gegenstände, Husten oder Pressen aufgetreten
ist [48]. Weitere typische Symptome einer Leistenhernie sind Schmerzen oder ein
brennendes Gefühl in der Leiste [8,37]. Diese Symptome können sich langsam entwickeln
oder aber plötzlich auftreten wie beispielsweise bei einer Inkarzeration [37]. Allerdings
können Leistenhernien auch vollkommen asymptomatisch sein [8,17].
Die klinische Untersuchung beinhaltet die Inspektion und vor allem die Palpation der
Leistenregion. Bei der klassischen Symptomkonstellation mit Schmerzen und einer
2Einleitung
Vorwölbung in der Leiste mit positivem Hustenanprall kann die definitive Diagnose einer
Leistenhernie in der Regel bereits klinisch gestellt werden [8,22]. Jedoch ist die
Zuverlässigkeit der klinischen Diagnose eingeschränkt, wenn bereits ein Teil der
Charakteristika nicht nachweisbar ist, beispielsweise ein positiver Hustenanprall ohne eine
tastbare Vorwölbung [54]. Ein Patient mit Leistenschmerzen als einzigem Symptom stellt
ebenfalls eine diagnostische Herausforderung dar, da viele Differentialdiagnosen in
Betracht kommen [29].
Tabelle 1: Differentialdiagnose Leistenhernie (Die hier dargestellten Differential-
diagnosen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit) [37,50,59,60]
Schmerz Schwellung Leisten-/Skrotalregion
Appendizitis, Divertikulitis, chronisch
Narbenhernie, Schenkelhernie
entzündliche Darmerkrankungen
Coxarthrose, Tendinopathie der Adduktoren,
Lymphknotenschwellung, Lymphome,
lumbale Bandscheibenerkrankungen, Osteitis
Lymphknotenmetastase
pubis, Bursitis ileopectinea
Aneurysma der A. femoralis, Varikosis der V.
Harnwegsinfektion, Prostatitis
saphena
Endometriose Endometriose
Pubalgia athletica Weichteiltumor, Lipom, Hämatom
Hydrozele, Varikozele, ektoper Hoden,
Hodentorsion, testikuläre Neoplasie
Das Fehlen der typischen Befunde in der klinischen Untersuchung schließt das Vorliegen
einer Leistenhernie nicht aus. Leistenhernien, die symptomatisch sind, aber bei der
klinischen Untersuchung nicht getastet werden können, werden als okkulte Leistenhernien
bezeichnet [39,53]. Darüber hinaus stößt die klinische Untersuchung besonders bei
adipösen Patienten und Patienten, die erst kürzlich eine Operation hatten, an ihre Grenzen
[2,65]. Auch bei Frauen gestaltet sich die Diagnostik aufgrund der anatomischen
Gegebenheiten weitaus schwieriger, da durch die Labia majora ein direktes Tasten des
Leistenbodens mit dem Untersuchungsfinger nicht möglich ist [25]. Eine diagnostische
Laparoskopie ermöglicht in diesen Fällen eine zuverlässige Diagnosestellung und erlaubt
bei einem positiven Leistenhernienbefund die gleichzeitige Hernienreparatur [39]. Ein
solches Vorgehen bei allen Patienten mit Leistenbeschwerden würde aber für viele
Patienten eine unnötige Operation nach sich ziehen [31,47]. In allen diesen oben genannten
3Einleitung
Situationen erscheint eine genauere nicht-invasive Diagnostik mittels Bildgebung
notwendig, um die Patienten mit einer Leistenhernie zuverlässig zu erkennen und zu
behandeln und um denjenigen mit anderen Ursachen eine unnötige Hernienoperation zu
ersparen [54].
1.4 Bildgebung
Die Rolle der diagnostischen Bildgebung hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte rapide
verändert. Zurückzuführen ist das nicht nur auf die schnelle Weiterentwicklung der
einzelnen Modalitäten (z.B. hochauflösender Ultraschall und dynamische MRT), sondern
auch auf neue chirurgische Konzepte im Sinne einer für den Patienten individuell
optimierten Operation [66]. In einer Ära als die offene Hernienchirurgie noch die einzige
Option war, konnte der Chirurg intraoperativ den Hernientyp und die -größe festlegen und
daran angepasst die optimale Operationstechnik wählen [34]. Mit der Einführung von
laparoskopischen und endoskopischen Therapiemöglichkeiten wurde jedoch die
Notwendigkeit für genauere präoperative Kenntnisse über die zu operierende Hernie
immer bedeutender [34]. Nicht zuletzt aus diesem Grund wurden in den vergangenen
Jahren mehrere bildgebende Verfahren auf ihren Nutzen bei der Diagnostik von
Leistenhernien untersucht.
Vor 1961 konnte eine Leistenhernie nur indirekt dargestellt werden, indem ihr Inhalt
(Harnblase, Ureter, Darm) durch konventionelles Röntgen, Barium-Untersuchungen des
Verdauungstraktes oder Kontrastmittel-Untersuchungen der Harnwege sichtbar gemacht
wurde [66].
Um den Herniensack direkt zu zeigen, war die Herniographie die erste verfügbare
diagnostische Modalität. Sie wurde Ende der 60er Jahre von Ducharme entwickelt [14].
Mit einer Sensitivität bis 97% und einer Spezifität bis 98% galt sie lange als zuverlässiges
diagnostisches Werkzeug [15,20,26,63] und ist in einer Metaanalyse 2013 sogar wieder als
die empfindlichste Methode beschrieben worden [53]. Jedoch benötigt das Verfahren
Röntgenstrahlung und Kontrastmittel und ist aus diesem Grund mit möglichen
Komplikationen assoziiert, die von einem Hämatom an der Einstichstelle bis zu
vasovagalen Reaktionen auf das Kontrastmittel reichen [16]. Nachteilig sind außerdem die
Invasivität und die fehlende Darstellbarkeit anderer Pathologien benachbarter Strukturen
[2,66]. Aufgrund dieser Schwächen wird die Herniographie im klinischen Alltag heute
kaum noch verwendet [55].
4Einleitung
Auch die Computertomographie spielt in der Diagnostik von Leistenhernien eher eine
untergeordnete Rolle, obwohl Vorteile durch die relative Untersucherunabhängigkeit und
die Möglichkeit, adipöse Patienten gut zu beurteilen, vermutet wurden [21]. Allerdings ist
der Patient wiederum strahlenexponiert und kann nur liegend untersucht werden, was sich
auf die Darstellbarkeit einer Leistenhernie negativ auswirkt [66]. Die in den bisherigen
Studien ermittelte Sensitivität für die CT betrug 75-83% und die Spezifität erreicht eine
Spanne von 67-90% [28,44].
Untersuchungen zur Wertigkeit der Magnetresonanztomographie ergaben bei
Leistenhernien eine Sensitivität von 91-94,5% und eine Spezifität von 92-96% [47,65].
Limitierende Faktoren sind allerdings die schlechte Verfügbarkeit und der hohe
Kostenaufwand [40,54]. Auch die Wiederholbarkeit ist bei der MRT und ebenfalls bei der
CT nicht in gleichem Ausmaß wie bei der Sonographie gegeben [40]. Gerade diese
Wiederholbarkeit kann bei Patienten mit nur intermittierenden Herniationen aber
entscheidend sein.
Die Verwendung der Sonographie bei Verdacht auf eine Leistenhernie hat in den letzten
Jahren aufgrund der beschriebenen Limitationen der anderen bildgebenden Verfahren stark
zugenommen und wird im klinischen Alltag zur Bewertung unklarer klinischer
Leistenbefunde häufig verwendet [39]. Die Sonographie bietet eine sehr genaue
Weichteildarstellung und ermöglicht eine nicht-invasive dynamische real-time Bewertung
der Gewebe, was im Vergleich zu den anderen bildgebenden Verfahren unübertroffen ist
[6]. Somit können Bewegungen des Hernieninhalts z.B. beim Valsalva-Manöver
dargestellt werden, wodurch die Diagnose einer Leistenhernie vereinfacht wird. Darüber
hinaus ist die Sonographie das am besten verfügbare bildgebende Verfahren und sehr
kostengünstig [12,13]. Zudem ist es möglich weitere Informationen, z.B. über den Inhalt
der Leistenhernie oder das Ausmaß der Reponierbarkeit, zu erfassen [52,66]. Als Nachteile
sind jedoch die Untersucherabhängigkeit und die mangelnde Durchführbarkeit bei sehr
adipösen Patienten anzuführen [2,52,65]. Die erste Beschreibung des Ultraschalls zur
Diagnose von Leistenhernien wurde 1975 von Spangen publiziert [61]. Seither haben
mehrere Studien die diagnostische Wertigkeit des Ultraschalls bei Leistenhernien
untersucht. Die berichteten Sensitivitäten variieren von 33-100%, die Spezifitäten von 82-
100% [1,2,6,7,12,13,31,33,34,39,40,42,54,65,67]. Es gibt viele Anhaltspunkte dafür, dass
die Sonographie sehr genau klinisch tastbare Leistenhernien identifizieren kann [7].
Demgegenüber ist die Studiensituation bei okkulten Leistenhernien weniger eindeutig [39].
5Einleitung
1.5 Fragestellung
Ziel der Studie war die Untersuchung, Evaluierung und Bewertung der Sonographie im
Rahmen der Diagnostik von Leistenhernien, wobei der Schwerpunkt auf der Bestimmung
der diagnostischen Wertigkeit lag. Dies geschah vor dem Hintergrund, dass zu Beginn der
Studie bildgebende Verfahren in der Diagnostik der Leistenhernie in den Leitlinien der
„European Hernia Society“ keine relevante Bedeutung erlangt hatten [60]. Trotz
jahrzehntelanger Erforschung bestand kein Konsens über das weitere Vorgehen im Falle
einer unklaren klinischen Untersuchung und die zuverlässigste diagnostische bildgebende
Modalität. Der Stellenwert der Sonographie insbesondere bei negativen Befunden war aus
den bisherigen Studien aufgrund der Methodik nur sehr eingeschränkt auswertbar. Gegen
Ende der Studie wurde ein Entwurf für neue internationale Leitlinien zum Management
von Leistenhernien veröffentlicht [64]1. In diesem wird nun die Sonographie kombiniert
mit der klinischen Untersuchung bei unklaren Fällen empfohlen. Mit den gewonnenen
Ergebnissen der vorliegenden Studie sollte daher ergänzend ein Beitrag geleistet werden,
die Empfehlungen dieser Leitlinie zu beurteilen.
Ein weiteres Ziel der Studie war es herauszuarbeiten, inwieweit die Sonographie über die
Diagnostik hinaus die Therapie von Leistenhernien beeinflusst. Abgeleitet aus den
Erkenntnissen der Studie sollte die Sonographie in diesem Kontext bezüglich ihrer Rolle
im Diagnostikalgorithmus von Leistenhernien bewertet und ein Vorschlag für das
Management der Patienten abhängig vom jeweiligen Ultraschallbefund erarbeitet werden.
Als untergeordnetes Ziel dieser Studie war darüber hinaus die Evaluation möglicher
Parameter als Einflussfaktoren auf die sonographische Herniengröße vorgesehen. Die
Ergebnisse dieses Studienteils sollten dann mit den bekannten Risikofaktoren für das
Auftreten einer Leistenhernie korreliert werden.
1 Die dieser Arbeit zugrunde liegende Version stand bei Abgabe der Dissertation noch zur
Diskussion (Stand 07.07.2017)
6Material und Methoden
2 Material und Methoden
2.1 Studienrahmen und Studiendesign
Bei der vorliegenden Studie handelte es sich um eine retrospektive Follow-up-Studie zur
Ermittlung der Wertigkeit der Sonographie in der Diagnostik der Leistenhernie. Sie
gliederte sich in zwei Studienabschnitte und umfasste einen retrospektiven und einen
prospektiven Untersuchungsansatz. Retrospektiv ausgewertet wurden die Daten von Januar
2012 bis April 2016, die prospektive Datenerhebung mittels Fragebogen fand von Oktober
2016 bis Dezember 2016 statt. Die Studie erfolgte als single-center Studie im Zentralen
Ultraschall des Universitätsklinikums Ulm. Sie erhielt ein positives Votum der
Ethikkommission der Universität Ulm (Antrag Nr. 46/16) [43].
2.2 Studienkollektiv
2.2.1 Auswahl der Patienten
Die Auswahl der Patienten erfolgte retrospektiv im Rahmen des ViewPoint Ultraschall
Programms. Mittels einer SQL-Abfrage wurden alle Patienten ermittelt, die im Zeitraum
von Januar 2012 bis April 2016 im Zentralen Ultraschall eine Ultraschalluntersuchung mit
der Fragestellung einer Leistenhernie oder dem Befund einer Leistenhernie erhalten hatten.
Die SQL-Abfrage lieferte 551 Patienten, die zur sonographischen Bewertung der Leiste an
den Zentralen Ultraschall überwiesen worden waren und somit für die Studie in Frage
kamen [43].
2.2.2 Ein- und Ausschlusskriterien
Grundsätzlich in die Studie eingeschlossen wurden Patienten, wenn sie eine
Ultraschalluntersuchung der Leiste erhielten und anschließend operiert wurden oder die
Möglichkeit zur Teilnahme am Follow-up gegeben war [43].
Ausgeschlossen wurden davon alle minderjährigen Patienten, Patienten in einer
Palliativsituation und Patienten, die vor Beginn einer Peritonealdialyse überwiesen
wurden. Die Peritonealdialyse fördert möglicherweise die Entstehung von Leistenhernien
[60], weshalb diese vor Beginn der Dialyse sonographisch ausgeschlossen werden sollte
und Patienten zu diesem Zweck an den Zentralen Ultraschall überwiesen wurden. Da diese
Patienten asymptomatisch waren, klinisch kein Verdacht auf eine Leistenhernie bestand
und auch sonographisch keine Leistenhernie nachgewiesen werden konnte, passten sie
nicht in das eigentliche Studienkollektiv und wurden daher nicht zur Auswertung
7Material und Methoden
herangezogen. Das Gleiche galt für Patienten, die mit einer anderen Fragestellung im
Ultraschall vorgestellt wurden und bei denen der Ausschluss einer Leistenhernie im
Ultraschallbefund nur nebenbei erwähnt wurde. Bei Patienten, die mehrere
Ultraschalluntersuchungen der Leiste erhielten, wurde entweder nur die letzte
Untersuchung erfasst oder die, die eine operative Versorgung oder die Teilnahme am
Follow-up zur Konsequenz hatte. Patienten, die erst nach einer Leistenhernienoperation
mit anhaltenden Symptomen und der Fragestellung nach einem Verhalt oder Hämatom
vorgestellt wurden, wurden ebenfalls nicht in das Studienkollektiv aufgenommen.
Außerdem mussten alle Patienten aus der Studie ausgeschlossen werden, die
sonographisch nicht beurteilbar waren und folglich kein auswertbarer Ultraschallbefund
vorlag.
Eine Möglichkeit zur Teilnahme am Follow-up war nicht gegeben für Patienten, die
postalisch unter der in der Akte gespeicherten Adresse nicht mehr ermittelt werden
konnten. Dies traf auch auf Patienten zu, die inzwischen verstorben waren oder aufgrund
von Demenz nicht in der Lage waren, den Fragebogen auszufüllen. Darüber hinaus wurden
nach dem Follow-up alle Patienten mit fehlenden Daten zum BMI ausgeschlossen.
Diese Ein- und Ausschlusskriterien ergaben eine Studienpopulation von 326 Patienten
[43].
8Material und Methoden
Ultraschalluntersuchung der
Leiste
n=551
Ausschlusskriterien
• fehlende BMI-Daten (n=91)
• Patient postalisch für Follow-up nicht
ermittelbar (n=31)
• wiederholte Ultraschalluntersuchung (n=29)
• postoperative Ultraschalluntersuchung (n=18)
• Peritonealdialyse (n=13)
• Tod (n=13)
• Minderjährige (n=9)
• Palliativsituation (n=8)
• andere Fragestellung (n=6)
• sonographisch nicht beurteilbar (n=6)
• Demenz (n=1)
Studienkollektiv
n = 326
Abbildung 1: Auswahl des Studienkollektivs. Studie zur Wertigkeit der Sonographie in der
Diagnostik der Leistenhernie am Universitätsklinikum Ulm, Januar 2012 bis
Dezember 2016
BMI=Body-Mass-Index
In Anlehnung an: Maisenbacher et al: Value of Ultrasonography in the Diagnosis of Inguinal
Hernia – A Retrospective Study. Ultraschall in der Medizin, 39: 690-696 (2018) [43]
2.3 Sonographischer Untersuchungsgang
Die Ultraschalluntersuchung erfolgte hauptsächlich von drei erfahrenen Fachärzten
(DEGUM Stufe II und III) im Zentralen Ultraschall des Universitätsklinikums Ulm. Da die
Studie retrospektiv ausgewertet wurde, war es nicht möglich ein standardisiertes
Untersuchungsschema festzulegen. Dennoch wurden die Patienten unabhängig vom
Untersucher in ähnlicher Weise sonographisch untersucht. Dieser Ablauf soll im
Folgenden exemplarisch beschrieben werden:
Alle Patienten wurden initial in Rückenlage auf der symptomatischen Seite untersucht. In
unklaren Fällen fand die Untersuchung zusätzlich im Stehen statt, um die sonographischen
Zeichen einer Leistenhernie zu verdeutlichen und die Diagnosestellung zu erleichtern[43].
Zur Orientierung erfolgte die Ultraschalluntersuchung zunächst mit einem
Konvexschallkopf mit 1-6 MHz in einem leichten Schrägschnitt zwischen der Spina iliaca
9Material und Methoden
anterior superior und dem Pecten ossis pubis. In diesem Schnitt ließen sich Haut, Subkutis,
Muskulatur, Peritoneum, Darm und Omentum darstellen. Das Lig. inguinale erschien
hierbei als lineare echoreiche Struktur. Zur Identifizierung des tiefen Leistenrings wurde
der Punkt verwendet, an dem sich der Samenstrang beim Mann bzw. das Lig. teres uteri
bei der Frau im subkutanen Fettgewebe zeigte. Ferner diente als Orientierungspunkt für
den tiefen Leistenring die A. epigastrica inferior. In dieser Schnittebene ließen sich auch
die Strukturen des Leistenkanals darstellen. Der Samenstrang beim Mann stellte sich als
heterogene echoreiche Struktur mit echoarmen Tubuli und Gefäßen dar [43].
Als nächstes erfolgte in der gleichen Schnittebene die Untersuchung unter Belastung durch
das Valsalva-Manöver, Husten oder Pressen. Diese Manöver waren essentiell für die
Visualisierung transienter Leistenhernien, die in Ruhe komplett reponiert und damit
unsichtbar waren. Während dieser Manöver ruhte der Fokus auf der Durchtrittsstelle des
Samenstrangs, also dem inneren Leistenring. Eine Vergrößerung oder Aufweitung des
Kanals wurde hierbei als pathologisch, Bewegungen des Samenstrangs unter Belastung als
physiologisch betrachtet. Anschließend wurde der Leistenkanal in seinem Querschnitt, also
der anatomisch sagittalen Achse, wiederum in Ruhe und unter Pressbelastung beurteilt. In
gleicher Weise wurde nachfolgend der Ort der Schwellung oder des maximalen Schmerzes
untersucht [43].
Diesen Ablauf der Schnittführung wiederholte der Untersucher abschließend mit einer
hochauflösenden Linearsonde mit 3-12 MHz.
Die dynamische Untersuchung mit direkter Visualisierung ermöglichte die Erfassung von
Veränderungen der anatomischen Strukturen, z.B. das nur wenige Sekunden dauernde
Eintreten von Fett oder Darmstrukturen in den Bruchsack während des Valsalva-
Manövers.
Für die sonographische Diagnose einer Leistenhernie wurden folgende Kriterien
verwendet [43]:
1. Nachweis einer Bruchlücke
2. Nachweis eines Bruchsacks
3. Typische Bewegungen von Darm- und/oder Fettstrukturen in der Bruchlücke und dem
Bruchsack beim Valsalva-Manöver
4. Reponierbarkeit des Bruchinhalts
5. Nachweis einer inkarzerierten Leistenhernie
10Material und Methoden
Teilweise waren mehrere dieser Kriterien gemeinsam nachweisbar, für die Diagnose einer
Leistenhernie war jedoch der Nachweis einer dieser Punkte ausreichend.
Zeigte sich sonographisch eine Leistenhernie, wurde auch der Hernieninhalt differenziert.
Dabei deuteten peristaltische Bewegungen mit Lufteinschlüssen auf Darmstrukturen hin,
wohingegen sich das Omentum majus als unbewegliche reflexreiche Struktur darstellte.
Nach Möglichkeit wurden zusätzlich die Bruchlückengröße und die Bruchsackgröße
ausgemessen [43].
Für den Fall, dass sonographisch zwar keine Leistenhernie dargestellt werden konnte, sich
aber ein anderer pathologischer Befund wie Zysten, Lymphknoten oder Granulome fand,
wurde dieser ebenfalls dokumentiert.
Abbildung 2: Exemplarisches Ultraschallbild einer Leistenhernie
BL=Bruchlücke mit 8,4mm, Bruchsack mit 45,5mm x 20,6mm
Erstveröffentlichung in: Maisenbacher et al: Value of Ultrasonography in the Diagnosis of
Inguinal Hernia – A Retrospective Study. Ultraschall in der Medizin, 39: 690-696 (2018)
[43]
11Material und Methoden
2.4 Studienablauf
2.4.1 Retrospektiver Studienteil
Im retrospektiven Teil wurden die Ultraschallbefunde aller mittels der SQL-Abfrage für
die Studie in Frage kommenden 551 Patienten gesichtet und aus der elektronischen
Patientenakte (SAP) klinische Daten, Ultraschall- und Operationsbefunde zu den
jeweiligen Patienten dokumentiert [43]. Dabei wurden aus SAP hinsichtlich der
Fragestellung folgende Daten extrahiert:
Patientenalter, Patientengeschlecht, Gewicht und Größe zur Berechnung des BMI
Vorerkrankungen, Medikamenteneinnahme und Voroperationen
Symptome und deren Lokalisation
Befunde der klinischen Untersuchung
Befunde der Ultraschalluntersuchung
Zusätzliche Bildgebung mittels CT oder MRT
Operationsbefund und Art der Operation
Das Geburtsdatum und Geschlecht war bei jedem Patienten in der elektronischen
Krankenakte gespeichert. Größe und Gewicht oder der BMI wurden aus den
Anamnesebögen oder Anästhesieprotokollen herausgesucht. Jedoch ließen sich nicht bei
allen Patienten diesbezüglich Angaben finden. Zur Dokumentation der Vorerkrankungen,
Medikamenteneinnahme und Voroperationen wurden weitere Befunde und Arztbriefe
durchgesehen.
Die Symptome der Patienten und die Befunde der klinischen Untersuchung konnten
größtenteils aus dem eingescannten Anamnesebogen der chirurgischen Ambulanz
entnommen werden oder waren auf dem Anforderungsschein für die
Ultraschalluntersuchung als Überweisungsgrund vermerkt. Wurde hier eine tastbare
Leistenhernie beschrieben, wurde das als positive klinische Untersuchung gewertet.
Befunde der klinischen Untersuchung bei Patienten, die jedoch nur einen positiven
Hustenanprall aufwiesen, wurden zur klaren Abgrenzung nicht als klinisch tastbare Hernie
klassifiziert und stattdessen separat erfasst [43].
Wies der Ultraschallbefund die Diagnose einer Leistenhernie auf, entsprach dies einer
positiven Ultraschalluntersuchung. Die Lokalisation, der Inhalt und die Größe der
Leistenhernie wurden ebenfalls erfasst, wenn diese im Befund beschrieben waren. Als Maß
12Material und Methoden
für die Herniengröße wurden die Bruchlücken- und Bruchsackgröße betrachtet. Diese
waren teils als Fläche, teils als Volumen angegeben, sodass zur besseren Vergleichbarkeit
jeweils nur die größte Ausdehnung dokumentiert wurde. Konnte keine Hernie
nachgewiesen werden, entsprach dies einem negativen Ultraschallbefund. Fand sich
sonographisch zwar keine Leistenhernie, aber eine andere Pathologie, wurde diese als
alternative sonographische Diagnose gekennzeichnet und ebenfalls erfasst. Auch der
jeweilige Untersucher, der die Sonographie durchführte, wurde vermerkt.
Falls bei einem Patienten zusätzlich zur Sonographie eine weitere Bildgebung zu derselben
Fragestellung vorlag, wurden deren Berichte auf das Vorliegen einer Leistenhernie
durchsucht und gegebenenfalls weitere Befunde dokumentiert.
Die Klassifizierung der Operationsberichte erfolgte analog zu den Ultraschallbefunden
beim Vorliegen einer Leistenhernie als positiver und bei deren Fehlen als negativer
Befund. Eine Leistenhernie wurde nur dann als vorhanden betrachtet, wenn dies explizit
im Operationsbefund vermerkt war. Zudem wurden andere intraoperative Befunde erfasst,
wenn diese beschrieben wurden.
2.4.2 Prospektiver Studienteil
An die retrospektive Auswertung schloss sich eine prospektive Datenerhebung im Sinne
eines Follow-up mit Fragebogen an. Bei den kontaktierten Personen handelte es sich
ausschließlich um Patienten des Universitätsklinikums Ulm, die laut den Aufzeichnungen
bisher keine Operation erhalten hatten. Dies war sowohl für einige Patienten mit positivem
Ultraschallbefund als auch auf die Mehrheit der Patienten mit einem negativen
Ultraschallbefund zutreffend. Das Ziel dieser zusätzlichen Datenerhebung war eine bessere
Beurteilbarkeit der Wertigkeit der Sonographie insbesondere bei negativen
Ultraschallbefunden.
Im Rahmen des Follow-up erhielten die Patienten postalisch einen Aufklärungsbogen mit
Informationen zur Studie, zwei Einwilligungserklärungen und einen Fragebogen mit einem
frankierten Rückumschlag (vgl. Anhang). Zur Teilnahme an der Umfrage wurden die
Patienten gebeten, die Informationen zur Studie sorgfältig zu lesen, die
Einwilligungserklärung und den Fragebogen auszufüllen und in dem dafür vorgesehenen
Rückumschlag an das Universitätsklinikum Ulm zurückzusenden. Die zweite
Einwilligungserklärung war nur dann relevant, wenn eine Operation in einem anderen
Krankenhaus außerhalb des Universitätsklinikums Ulm durchgeführt wurde, um Einsicht
in die Operationsbefunde erlangen zu können.
13Material und Methoden
In der Patienteninformation wurde der Inhalt, die Vorgehensweise und das Ziel der Studie
erläutert und darauf hingewiesen, dass das Studienteam bei Fragen jederzeit telefonisch
kontaktiert werden könne.
Der Fragebogen erfasste Daten zu Gewicht, Größe, Berufstätigkeit, Begleiterkrankungen
und Medikamenteneinnahme sowie Rauchgewohnheiten und Voroperationen, da zu diesen
Punkten in der elektronischen Patientenakte teilweise keine Daten vorlagen und diese
Angaben Hinweise auf mögliche andere Symptomursachen und Risikofaktoren liefern
konnten. Außerdem wurden die Patienten zu Leistenhernienoperationen, deren Datum, Ort
und Befund befragt. Diese Frage war wichtig, um Patienten zu erfassen, die trotz der
Untersuchung im Universitätsklinikum Ulm in einem anderen Krankenhaus evtl. auch
notfallmäßig operiert wurden. Weiterhin wurde das Fortbestehen der Symptomatik in der
Leiste, deren Dauer, Lokalisation, Art und Assoziation mit bestimmten Situationen
abgefragt [43].
2.5 Datenmanagement
Die Daten, die aus den Ultraschallbefunden, der elektronischen Patientenakte und durch
den Fragebogen gewonnen wurden, wurden in einer Microsoft-Excel-Datei abgespeichert
und zur Auswertung kodiert.
2.5.1 Referenzstandard
Als Goldstandard für den Nachweis einer Leistenhernie wurden die Operationsbefunde
betrachtet. Patienten ohne eine Operation wurden nicht ausgeschlossen, um keine zu große
Verzerrung hin zu einem Kollektiv mit hauptsächlich positiven Leistenhernienbefunden zu
erhalten. Da demzufolge aber nicht alle eingeschlossenen Patienten operiert wurden und
speziell nur wenige Patienten mit einem negativen Ultraschallbefund eine Operation
erhielten, war nicht bei allen Patienten eine Validierung mittels intraoperativer Befunde
möglich. Um dennoch Rückschlüsse auf die Rolle der Sonographie insbesondere auch bei
negativen sonographischen Befunden ziehen zu können, wurden Follow-up-Befunde und
alternative sonographische Diagnosen in die Auswertung miteinbezogen [43].
Zur Berechnung der Wertigkeit der Sonographie im Hinblick auf die Diagnose einer
Leistenhernie wurden die Patienten daher in Subgruppen eingeteilt und bei Patienten mit
mehreren möglichen Referenzbezügen eine Staffelung des Referenzstandards
vorgenommen. Lag ein Operationsbefund als Referenz vor, wurde stets dieser zur
Berechnung herangezogen. Bei nicht operierten Patienten wurde nach Möglichkeit der
14Material und Methoden
Follow-up-Fragebogen als Referenz eingesetzt. Entsprechend den Angaben aus dem
Fragebogen und den Ultraschallbefunden wurden die Follow-up-Patienten für die Wertung
in verschiedene Kategorien eingeteilt [43]:
Sonographisch keine Leistenhernie und im Follow-up keine Beschwerden
War die Sonographie negativ und eine Besserung der Symptomatik aus dem
Fragebogen ersichtlich, wurde diese Konstellation als Diagnose „keine Leistenhernie“
und damit „richtig negativ“ gewertet. Es wurde davon ausgegangen, dass sich die
Symptome zum Zeitpunkt der Ultraschalluntersuchung höchstwahrscheinlich auf eine
andere Ursache zurückführen ließen. Der Versuch eine solche Ursache zu
identifizieren, wurde ebenfalls unternommen.
Sonographisch keine Leistenhernie und im Follow-up Symptompersistenz
Ein Fortbestehen der Symptome bei einem sonographisch negativen Befund ließ
zunächst rein durch die Symptomatik keine eindeutige Schlussfolgerung zu. Konnte in
diesen Fällen anamnestisch eine mögliche andere Symptomursache identifiziert
werden, wurden die betreffenden Patienten als „richtig negativ“ gewertet. Kam keine
andere Ursache in Betracht, wurden die Patienten nicht in die Berechnung der
Wertigkeit miteinbezogen.
Sonographisch diagnostizierte Leistenhernie und im Follow-up keine Beschwerden
Die Patienten, bei denen sonographisch eine Leistenhernie diagnostiziert worden war,
die aktuell aber keine Beschwerden mehr angaben, waren nicht eindeutig als richtig-
oder falsch-positiver Befund bewertbar und gingen daher auch nicht in die
Vierfeldertafel ein.
Sonographisch diagnostizierte Leistenhernie und im Follow-up Symptompersistenz
Das Fortbestehen der Symptome wurde als Folge der diagnostizierten Leistenhernie
gewertet und die Patienten daher der Gruppe der richtig-positiven Befunde
zugeordnet.
Als weitere Referenz bei nicht operierten Patienten, die auch nicht am Follow-up
teilnahmen, kamen weitere Ultraschallbefunde als Erklärung für die Symptomatik der
Patienten in Frage. Diese werden im Folgenden als alternative sonographische Diagnosen
bezeichnet [43].
15Material und Methoden Der Rest der Patienten, der weder operiert wurde noch am Follow-up teilnahm und bei dem auch keine alternative Diagnose als mögliche Symptomursache in Frage kam, konnte aufgrund der fehlenden Validierungsmöglichkeit in der Berechnung der Wertigkeit der Sonographie keine Berücksichtigung finden. Die Referenzen zur Validierung der Ultraschallbefunde in dieser Studie waren zusammenfassend: Intraoperative Befunde Follow-up-Befunde Alternative sonographische Diagnosen 2.5.2 Statistische Auswertung Die statistische Analyse erfolgte mit der Statistiksoftware SAS in der Version 9.2. Die Patientendaten wurden deskriptiv ausgewertet. Für qualitative Merkmale wurden relative und absolute Häufigkeiten berechnet. Bei allen numerischen Parametern wurden Mittelwert, Standardabweichung, Minimum und Maximum ermittelt. In dieser Studie handelte es sich dabei um das Patientenalter, den BMI, die Bruchlücken- und Bruchsackgröße. Die Sensitivität, die Spezifität, der PPV, der NPV, die positive LR und die negative LR wurden getrennt für den jeweiligen Referenzstandard mithilfe einer Vierfeldertafel berechnet und mit dem 95%-Konfidenzintervall angegeben. Um Unterschiede zwischen zwei Gruppen wie etwa Frauen und Männern zu zeigen, wurde für stetige Parameter der T-Test bzw. Wilcoxon-Rangsummentest und für kategoriale Parameter der Chi-Quadrat-Test angewandt. Mittels der Korrelationsmatrix nach Pearson wurden die Bruchlückengröße und die Bruchsackgröße untereinander und mit den potentiellen Einflussfaktoren Alter und BMI korreliert. Eine statistische Signifikanz wurde bei einem p-Wert
Ergebnisse
3 Ergebnisse
3.1 Charakterisierung des Patientenkollektivs
Das untersuchte Kollektiv setzte sich aus 266 Männern (81,6%) und 60 Frauen (18,4%)
zusammen. Dies entsprach einem Verhältnis männlich zu weiblich von ungefähr 9:2 [43].
Das mittlere Patientenalter betrug 54,7 Jahre (± 17,7 Jahre STD) mit einer Altersspanne
von 18 bis 94 Jahren zum Zeitpunkt der Ultraschalluntersuchung [43].
Tabelle 2: Aufteilung des Patientenkollektivs nach Alter (n=326). Studie zur Wertigkeit
der Sonographie in der Diagnostik der Leistenhernie am
Universitätsklinikum Ulm, Januar 2012 – Dezember 2016.
absolute Patientenzahl relative Patientenzahl
18 bis 30 Jahre 32 9,8%
31 bis 50 Jahre 102 31,3%
51 bis 70 Jahre 115 35,3%
> 70 Jahre 77 23,6%
Der mittlere BMI betrug 26,1 kg/m² (± 4,3 kg/m² STD). Die Werte für den BMI reichten
dabei von 15,2 kg/m² bis 49,3 kg/m² [43].
Tabelle 3: Aufteilung des Patientenkollektivs nach Body-Mass-Index (n=326). Studie
zur Wertigkeit der Sonographie in der Diagnostik der Leistenhernie am
Universitätsklinikum Ulm, Januar 2012 – Dezember 2016.
BMI=Body-Mass-Index
absolute Patientenzahl relative Patientenzahl
BMI 31 kg/m² 49 15%
17Ergebnisse
3.2 Klinische Befunde
Bei der klinischen Untersuchung waren rund 6% der Patienten asymptomatisch,
wohingegen 87% der Patienten Symptome angaben (bei 7% der Patienten ließ sich keine
Angabe zur klinischen Symptomatik finden). Unter den symptomatischen Patienten war
Schmerz mit über 80% der Hauptgrund, der zu einer Vorstellung des Patienten in der
Klinik führte [43].
Vorwölbung
13%
Vorwölbung +
Schmerz
4%
Schmerz
83%
Abbildung 3: Art der Symptome in der Anamnese bei symptomatischen Patienten (n=283).
Studie zur Wertigkeit der Sonographie in der Diagnostik der Leistenhernie
am Universitätsklinikum Ulm, Januar 2012 – Dezember 2016.
In den meisten Fällen (87%) waren die Symptome in der Leiste lokalisiert, wobei hier eine
leichte Dominanz der rechten Seite zu beobachten war [43].
andere
Hoden 1%
2%
Unterbauch
10%
Leiste beidseits
10%
Leiste links
34%
Leiste rechts
43%
Abbildung 4: Lokalisation der Symptome in der klinischen Untersuchung bei
symptomatischen Patienten (n=283). Studie zur Wertigkeit der Sonographie
in der Diagnostik der Leistenhernie am Universitätsklinikum Ulm,
Januar 2012 – Dezember 2016.
andere = Oberbauch, Oberschenkel
18Ergebnisse
Die Mehrheit der Patienten (75%) wurde zu einer sonographischen Untersuchung der
Leiste überwiesen, wenn die Anamnese eine Leistenhernie vermuten lies, eine solche in
der klinischen Untersuchung aber nicht eindeutig tastbar war.
Leistenhernie
tastbar
positiver
20%
Hustenanprall
5%
Leistenhernie
nicht tastbar
75%
Abbildung 4: Tastbefund in der klinische Untersuchung (n=326). Studie zur Wertigkeit
der Sonographie in der Diagnostik der Leistenhernie am
Universitätsklinikum Ulm, Januar 2012 – Dezember 2016.
3.3 Sonographische Befunde
Bei 248 Patienten (76,1%) wurde in der Ultraschalluntersuchung eine Leistenhernie
diagnostiziert [43]. Davon waren 43% links, 39% rechts und 18% beidseits lokalisiert.
In Fällen, in denen der Bruchinhalt erfasst wurde, waren Darmanteile und Fettgewebe am
häufigsten zu finden.
keine Angabe
Gefäße 28% Darmanteile
1% 36%
Flüssigkeit
2%
Bindegewebe
1% Fettgewebe
32%
Abbildung 5: Inhalt des Bruchsacks in der Sonographie bei Patienten mit sonographisch
diagnostizierter Leistenhernie (n=248). Studie zur Wertigkeit der
Sonographie in der Diagnostik der Leistenhernie am Universitätsklinikum
Ulm, Januar 2012 – Dezember 2016.
19Ergebnisse
Die Reponierbarkeit der Leistenhernie wurde bei 58% der Patienten beschrieben. Hierbei
waren rund 33% reponibel, 13% nur mäßig reponibel und 8% nicht reponibel, aber ohne
Zeichen der Inkarzeration. Bei 4% der Patienten erschien die Leistenhernie sonographisch
inkarzeriert.
3.3.1 Sonographische Herniengröße
Die Bruchlückengröße wurde bei 164 Patienten (66%) im Ultraschallbefund beschrieben.
Als Mittelwert ergab sich hier eine Bruchlückengröße von 12,8 mm (± 8,2 mm STD). Die
gemessenen Werte für die Bruchlücke reichten von 2 mm bis 46 mm. Die
Bruchlückengröße zeigte eine statistische Signifikanz mit dem Geschlecht, dem Alter, der
Bruchsackgröße und bei Patienten mit einer beidseitigen Leistenhernie auch mit der
Lokalisation. Tendenziell war die Bruchlücke dabei auf der linken Seite kleiner, ebenso
wie bei Frauen (vgl. Tabelle 4 und 5). Der Zusammenhang mit dem Alter war schwach
positiv, mit der Bruchsackgröße hingegen stark positiv (vgl. Tabelle 6).
Die Bruchsackgröße wurde bei 124 Patienten (50%) beschrieben. Die mittlere
Bruchsackgröße betrug 37,07 mm (± 21,57 mm STD) mit einem Minimum von 4 mm und
einem Maximum von 122 mm. Die Bruchsackgröße korrelierte statistisch signifikant mit
dem Alter, dem BMI und der Bruchlückengröße. Die Stärke der Korrelation war mit dem
BMI schwach, mit dem Alter mittel und mit der Bruchlückengröße stark positiv (vgl.
Tabelle 6).
Tabelle 4: Einfluss des Geschlechts auf die sonographisch gemessene Herniengröße.
Studie zur Wertigkeit der Sonographie in der Diagnostik der Leistenhernie am
Universitätsklinikum Ulm, Januar 2012 – Dezember 2016.
STD=Standardabweichung, Wilcoxon=Wilcoxon-Rangsummentest, statistische
Signifikanz bei p-WertErgebnisse
Tabelle 5: Einfluss der Lokalisation auf die sonographisch gemessene Herniengröße bei
Patienten mit beidseitiger Leistenhernie. Studie zur Wertigkeit der
Sonographie in der Diagnostik der Leistenhernie am Universitätsklinikum
Ulm, Januar 2012 – Dezember 2016.
STD=Standardabweichung, Wilcoxon=Wilcoxon-Rangsummentest, statistische
Signifikanz bei p-WertErgebnisse
Von den Patienten mit anderweitigen Symptomursachen wurden vier Patienten operiert.
Dabei wurde intraoperativ das Lipom und eine der Narbenhernie bestätigt. Die Fistel und
eine der weichen Leisten stellten sich intraoperativ hingegen als Leistenhernie dar.
3.4 Intraoperative Befunde
Eine Operation wurde bei 201 Patienten (62%) aufgrund ihrer Leistensymptomatik
durchgeführt [43]. Davon erfolgten rund 6% als Notfalloperationen. Die Hälfte der
Operationen wurde laparoskopisch mittels TAPP durchgeführt.
abdominell im keine Angabe
Rahmen einer 7%
anderen OP
2%
Lichtenstein
26%
Shouldice
TAPP
15%
50%
Abbildung 6: Verwendete Operationsverfahren (n=201). Studie zur Wertigkeit der
Sonographie in der Diagnostik der Leistenhernie am Universitätsklinikum Ulm,
Januar 2012 – Dezember 2016.
OP=Operation, TAPP=Transabdominelle präperitoneale Patchplastik
Intraoperativ wurde bei 188 Patienten (94%) eine Leistenhernie beschrieben, während sich
bei 13 Patienten (6%) intraoperativ keine Leistenhernie fand. Von den operativ bestätigten
Leistenhernien waren 39% links, 41% rechts und 17% beidseits lokalisiert (keine Angabe
im Operationsbefund bei 3%) [43].
22Ergebnisse
Bei etwas mehr als der Hälfte der Patienten mit operativ bestätigter Leistenhernie konnte
aus dem Operationsbericht die Hernienart ermittelt werden. Indirekte Leistenhernien waren
am häufigsten vertreten, gefolgt von direkten Leistenhernien und Rezidiven [43].
indirekte
Leistenhernie
21%
keine Angabe
44% direkte
Leistenhernie
14%
Rezidiv-
leistenhernie
14% kombinierte
Leistenhernie
Skrotalhernie 3%
4%
Abbildung 7: Art der Leistenhernie intraoperativ (n=188). Studie zur Wertigkeit der
Sonographie in der Diagnostik der Leistenhernie am Universitätsklinikum
Ulm, Januar 2012 – Dezember 2016.
3.5 Operationsrate abhängig von der klinischen Untersuchung und der
Sonographie
Für das gesamte Kollektiv ergab sich eine Operationsrate von 62%. Bei der Betrachtung
der Operationsraten der klinischen Untersuchung ohne den Ultraschallbefund wurden bei
klinisch nachweisbaren Leistenhernien 62 von 66 Patienten operiert (94%), bei einem
positiven Hustenanprall 15 von 17 (88%) und bei einer negativen klinischen Untersuchung
124 von 243 (51%).
Bei einer sonographisch darstellbaren Leistenhernie lag die Operationsrate unabhängig
vom Ergebnis der klinischen Untersuchung bei 78% und bei einem negativen
Ultraschallbefund bei 10%. War die klinische Untersuchung negativ, die Sonographie
jedoch positiv wurden 120 von 170 Patienten (71%) operiert [43].
23Ergebnisse
Tabelle 7: Korrelation klinischer, sonographischer und intraoperativer Leistenhernien-
befunde. Studie zur Wertigkeit der Sonographie in der Diagnostik der
Leistenhernie am Universitätsklinikum Ulm, Januar 2012 – Dezember 2016.
positiv=Leistenhernie, negativ=keine Leistenhernie, LH=Leistenhernie
Anzahl Anzahl
Klinische
Ultraschall Anzahl operierter intraoperativer
Untersuchung
Patienten LH-Befunde
positiv positiv 62 58 56
negativ/anderer
positiv 4 4 2
Befund
Hustenanprall
positiv 16 15 14
positiv
Hustenanprall negativ/anderer
1 0 0
positiv Befund
negativ positiv 170 120 113
negativ/anderer
negativ 73 4 3
Befund
3.6 Follow-up-Befunde
Im Rahmen des Follow-up wurden 261 Patienten angeschrieben, die nach Durchsicht der
klinischen Aufzeichnungen bisher keine Leistenhernienoperation erhalten hatten. Wie im
vorangegangenen Kapitel „Material und Methoden“ beschrieben, mussten aufgrund
fehlender Teilnahmemöglichkeit 45 Patienten nach Abschluss des Follow-up aus der
Studie ausgeschlossen werden, sodass von 216 angeschriebenen Patienten eine
Rückantwort möglich war. Die tatsächliche Teilnahme am Follow-up erfolgte von 47
Patienten, was einer Rücklaufquote von 22% entsprach [43].
Im Fragebogen gaben acht Patienten an, in einem Krankenhaus außerhalb des
Universitätsklinikums Ulm eine Operation erhalten zu haben, in der die Diagnose einer
Leistenhernie bestätigt wurde. Diese wurden bei der Berechnung der Wertigkeit der
Sonographie unter dem Referenzstandard Operation geführt.
24Sie können auch lesen