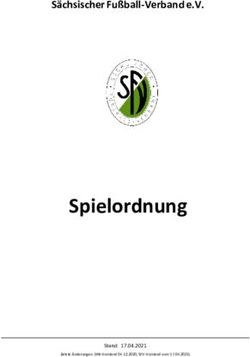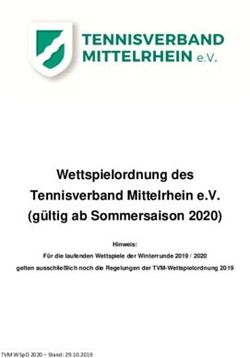Spielordnung - Sächsischer Fußball-Verband e.V - Westlausitzer Fussballverband
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Sächsischer Fußball-Verband e.V.
Spielordnung
Stand: 01.07.2022
(letzte Änderungen: DFB-Bundestag 11.03.2022, SFV-Vorstand vom 08.04.2022 und 13.06.2022)Inhaltsverzeichnis
Teil 1 Allgemeinverbindlicher Teil der DFB-Spielordnung
(Stand: DFB-Bundestag 11.03.2022)
(§§ 1 – 39)
§1 - Spielregeln
§2 - Vorläufige Sperre bei Feldverweis
§3 - Allgemeinverbindlichkeit von Entscheidungen und Strafen
§4 - Gruppenstärke und Spielwertung
§ 4a/b - Mannschaftsstärke / Spielerwechsel
§5 - Doping
§6 - Verein/Kapitalgesellschaft in Insolvenz
§7 - Spieljahr – Spielpause
§8 - Status der Fußballspieler
§9 - Geltungsumfang der Spielerlaubnis
§ 10 - Spielerlaubnis – Spielerpass
§10a - Nachweis der Spielberechtigung
§ 11 - Spielberechtigung von Spielern in anderen Mannschaften des Vereins nach dem Einsatz in einer
Lizenzspieler-Mannschaft
§ 11a - Spielberechtigung nach einem Einsatz in einer Mannschaft der 3.Liga, Regionalliga oder der 4. oder 5.
Spielklassenebene
§ 12 - Spielberechtigung in Zweiten Mannschaften von Lizenzvereinen
§ 12a - Spielberechtigung in der 3. Liga und Einsatzregelungen in den Entscheidungsspielen um den Aufstieg
in die 3. Liga
§ 12b - Rechtsfolgen bei Verstößen gegen § 12 und § 12a der DFB-Spielordnung
§ 13 - Besondere Bestimmungen für Zweite Mannschaften in Leistungszentren der Lizenzligen
§ 14 - Spielberechtigung nach dem Einsatz in einer Mannschaft der Frauen-Bundesliga und der 2. Frauen-
Bundesliga
§14a - Spielberechtigung in Zweiten Mannschaften von Frauen-Bundesliga- Vereinen in
Meisterschaftsspielen der 2. Frauen-Bundesliga
§ 15 - Spielberechtigung als Gastspieler in Amateur-Mannschaften
§ 16 - Spielerlaubnis bei Vereinswechsel von Amateuren
§ 16a - Grundsätze für die Erteilung einer Spielerlaubnis mittels DFBnet Pass Online
§ 16b - Grundsätze für die Erteilung einer Spielerlaubnis mittels DFBnet Pass Online bei Mitgliedsverbänden,
die keine Spielerpässe mehr ausstellen
§ 17 - Wegfall der Wartefristen beim Vereinswechsel von Amateuren
§ 18 - Übergebietlicher Vereinswechsel
§ 19 - Tochtergesellschaften der Lizenzligen, der 3.Liga und der Regionalliga
§ 20 - Internationaler Vereinswechsel, internationales Ausbildungsentschädigungssystem und
Solidaritätsmechanismus
§ 21 - Spielerlaubnis für Spieler, die aus einem anderen Nationalverband kommen und Vereinswechsel zu
einem anderen Nationalverband§ 22 - Vertragsspieler
§ 23 - Vereinswechsel eines Vertragsspielers (einschließlich Statusveränderung)
§ 24 - Strafbestimmungen für Amateure und Vereine
§ 25 - Strafbestimmungen für Vertragsspieler und Vereine
§ 26 - Zuständigkeit der Rechtsorgane bei Verstößen gegen die §§ 24 und 25
§ 26a - Beilegung und Schlichtung von Streitigkeiten
§ 27 - Überfällige Verbindlichkeiten
§ 28 - Beeinflussung von Vereinen durch Drittparteien
§ 28a - Dritteigentum an wirtschaftlichen Spielerrechten
§ 29 - Reamateurisierung eines Lizenzspielers oder Nicht-Amateurs, der von einem der FIFA
angeschlossenen Nationalverband freigegeben wird, als Amateur.
§ 30 - Verpflichtung eines Lizenzspielers oder Nicht-Amateurs, der von einem der FIFA abgeschlossenen
Verband freigegeben wird, als Vertragsspieler.
§ 31 - Spielen in ausländischen oder nicht in der FIFA organisierten Vereinen und Mannschaften.
§ 32 - Spiele mit ausländischen Mannschaften
§ 33 - Spielbetrieb mit Auswahlmannschaften und unzulässiger Spielbetrieb
§ 34 - Abstellung von Spielern
§ 35 - Beteiligung an DFB-Wettbewerben
§ 36 - Sicherheit
§ 37 - Rahmenbedingungen für die 4. Spielklassenebene
§ 38 - Spielervermittlung
§ 39 - Spiel- und Schiedsrichterkleidung
§ 39a - Beachsoccer
§ 39b - Einhaltung allgemeinverbindlicher Vorschriften und Verstöße gegen sie
Teil 2
Allgemeinverbindlicher Teil des SFV
(Stand: SFV-Vorstand 08.04. 2022 und 13.06.2022)
(§§ 40 - 72)
§ 40 - Allgemeines
§ 41 - Spielbetrieb
§ 42 - Altersklassen
§ 43 - Spielklassen und Staffeln
§ 44 - untere Mannschaften
§ 45 - Spielwertung und Feststellung des Meisters
§ 46 - Teilnahme am Spielbetrieb
§ 47 - Neugründungen und Fusionen
§ 47a - Jugendfördervereine
§ 48 - Schiedsrichtersoll
§ 49 - Auf- und Abstieg§ 50 - An- und Absetzung von Pflichtspielen § 51 - Platzbedingungen § 52 - Platzkommission § 53 - Platzordnung § 54 - Spielkleidung § 55 - Spielführer § 56 - Spielerlaubnis § 57 - Freigabe von Juniorinnen für Frauen- und Junioren für Herrenmannschaften § 58 - Verwarnung und Spielsperren § 59 - Spieldurchführung § 60 - Nichtantreten und Ausscheiden von Mannschaften § 61 - Spielabbruch § 62 - Platzsperre durch Rechtsorgane § 63 - Schiedsrichter § 64 - Pokalbestimmungen § 65 - Freundschaftsspiele § 66 - Auswahlspiele § 67 - Pass- und Spielrecht § 67a - Zweispielrechte für Juniorinnen und Junioren § 67b - Zweitspielrechte für Personen mit wechselnden Aufenthaltsorten § 67c - Zweitspielrechte für Altherren-Spielbetrieb bzw. Ü-Mannschaften § 68 - Wechsel innerhalb des Vereins/Einschränkung der Spielerlaubnis § 69 - Vereinswechsel von Junioren/Juniorinnen § 70 - Spielgemeinschaften im Herrenbereich § 71 - Spielgemeinschaften für Frauen, Juniorinnen und Junioren § 72 - Inkrafttreten
Teil 1
Allgemeinverbindlicher Teil der DFB-Spielordnung
§1
Spielregeln
1. Die von den Mitgliedsverbänden, ihren Vereinen und deren Tochtergesellschaften veranstalteten
Fußballspiele sind nach den Spielregeln der FIFA durchzuführen.
2. Wenn ein Spieler nach einer ersten Verwarnung durch Vorzeigen der Gelben Karte ein weiteres Mal
hätte verwarnt werden müssen, so ist er vom Schiedsrichter durch Vorweisen der Gelben und Roten
Karte des Feldes zu verweisen und für den Rest der Spielzeit dieses Spieles gesperrt.
3. Wird ein Spieler in einem Meisterschaftsspiel der Lizenzligen, 3. Liga, Frauen-Bundesliga, 2. Frauen-
Bundesliga, Junioren-Bundesligen (A- und B-Junioren) oder B-Juniorinnen- Bundesliga infolge zweier
Verwarnungen (gelb/rot) im selben Spiel des Feldes verwiesen, ist er bis zum Ablauf der automatischen
Sperre auch für das jeweils nächstfolgende Meisterschaftsspiel jeder anderen Mannschaft seines
Vereins/Tochtergesellschaft gesperrt, längstens jedoch bis zum Ablauf von zehn Tagen.
Die Mitgliedsverbände können diese Regelung auf ihre Spielklassen im Verbandsgebiet mit der
Maßgabe übertragen, dass die automatische Sperre für andere Mannschaften des Vereins/
Tochtergesellschaft nicht für Spiele der Lizenzligen und der 3. Liga gelten darf.
4. Ein Spiel ist vom Schiedsrichter anzupfeifen, wenn zur festgesetzten Anstoßzeit mindestens sieben
Spieler jeder Mannschaft auf dem Spielfeld sind.
Das Spiel wird nicht angepfiffen oder fortgesetzt, wenn eines der Teams weniger als sieben Spieler hat.
§2
Vorläufige Sperre bei Feldverweis
1. Bei einem Feldverweis (Rote Karte) ist der Spieler bis zur Entscheidung durch die zuständige Instanz
gesperrt, ohne dass es eines besonderen Verfahrens oder einer besonderen Benachrichtigung bedarf. §
11 der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB bleibt unberührt.
2. Erfolgt ein Feldverweis eines Spielers (Rote Karte) einer deutschen Mannschaft bei einem Spiel im
Ausland, so kann bei der zuständigen Instanz beantragt werden, die vorläufige Sperre bis zur Ermittlung
des Tatbestandes auszusetzen.
§3
Allgemeinverbindlichkeit von Entscheidungen und Strafen
Spieltechnische Entscheidungen und Strafen der zuständigen Organe des DFB und seiner Mitgliedsverbände
unter Einschluss der sich aus ihren Vorschriften unmittelbar ergebenden Folgen wirken für und gegen den
DFB, seine Mitgliedsverbände, deren Vereine sowie deren Mitglieder. Das gleiche gilt für
Tochtergesellschaften hinsichtlich der spieltechnischen Entscheidungen und Strafen der zuständigen Organe
des DFB.
§4
Gruppenstärke und Spielwertung
1. Einer Spielgruppe gehören grundsätzlich 16 Mannschaften an.
2. Für Rundenspiele im Rahmen einer Spielklasse oder Spielgruppe (Aufstiegsspiele) – bei denen jeder
gegen jeden in Vor- und Rückspiel bei wechselseitigem Platzvorteil anzutreten hat – gilt folgende
Regelung:
2.1. Ein gewonnenes Spiel wird für den Sieger mit drei Punkten, ein unentschiedenes Spiel für beide
Mannschaften mit je einem Punkt gewertet.
2.2. Meister der Runde ist, wer nach Durchführung aller Spiele die meisten Gewinnpunkte erzielt hat.
Absteiger sind die Mannschaften, die die wenigsten Gewinnpunkte erzielt haben.3. Bei Entscheidungsspielen aller Art wird bei unentschiedenem Ausgang eines Spieles trotz
Verlängerung und gegebenenfalls trotz Wiederholung der Sieger durch Elfmeterschießen
ermittelt. Es gelten die in den Fußballregeln festgelegten Durchführungsbestimmungen (Schüsse
von der Strafstoßmarke).
§4a
Mannschaftsstärke
In den vier untersten Spielklassen – im Frauen-Bereich in den beiden untersten Spielklassen – können die
Landesverbände Mannschaften mit unterschiedlicher Spielerzahl an Meisterschaftsrunden teilnehmen lassen
und festlegen, dass bei einem Aufeinandertreffen von Mannschaften mit unterschiedlicher Spielerzahl
sich die Anzahl der Spieler nach dem Team mit der geringeren Spielerzahl richtet. Die DFB-Landesverbände
legen die Anzahl der Spieler, die mindestens einer Mannschaft angehören müssen, fest.
Das Aufstiegsrecht von Mannschaften mit weniger als elf Spielern kann eingeschränkt werden.
§4b
In Pflicht- und Freundschaftsspielen der vier untersten Spielklassen – im Frauen-Bereich in den beiden
untersten Spielklassen – kann ein wiederholtes Ein- und Auswechseln von Spielern erlaubt werden.
§5
Doping
1. Doping ist verboten. Als Doping gilt das Vorliegen eines Verstoßes gegen eine oder mehrere Anti-
Doping-Vorschriften gemäß Nr. 2.
In Nr. 2. sind die Tatbestände und Handlungen aufgeführt, die einen Verstoß gegen Anti-Doping-
Bestimmungen begründen. Anhörungen in Dopingfällen werden auf Grundlage der Behauptung
durchgeführt, dass eine bzw. mehrere dieser spezifischen Regeln verletzt wurden.
Spieler oder andere Personen sind selbst dafür verantwortlich, davon Kenntnis zu haben, was einen
Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen darstellt und welche Substanzen und Methoden in die
Verbotsliste aufgenommen worden sind.
2. Als Verstoß gegen Anti-Doping-Vorschriften gilt:
a) Das Vorhandensein einer verbotenen Substanz, ihrer Metaboliten oder Marker in einer dem
Körper entnommenen Probe.
aa) Es ist die persönliche Pflicht jedes Spielers, sich zu vergewissern, dass keine verbotenen
Substanzen in seinen Körper gelangen. Die Spieler sind verantwortlich für verbotene
Substanzen, deren Metaboliten oder Marker, die sich in den ihrem Körper entnommenen
Proben befinden. Dementsprechend muss eine Absicht, ein Verschulden, eine Fahrlässigkeit
oder eine bewusste Anwendung durch den Spieler nicht nachgewiesen werden, damit ein
Verstoß gegen Anti-Doping-Vorschriften vorliegt.
bb) Die beiden nachstehenden Sachverhalte stellen einen ausreichenden Nachweis eines
Verstoßes gegen Anti-Doping-Vorschriften dar:
Das Vorhandensein einer verbotenen Substanz, ihrer Metaboliten oder Marker in der A-
Probe eines Spielers, wenn der Spieler auf die Analyse der B-Probe verzichtet und die B-
Probe nicht analysiert wird, oder die Bestätigung des Vorhandenseins einer verbotenen
Substanz oder ihrer Metaboliten oder Marker in der A-Probe eines Spielers anhand der
Analyse der B-Probe oder, wenn die A- und B-Probe des Spielers in zwei Teilen aufgeteilt ist,
die Bestätigung des Vorhandenseins der verbotenen Substanz oder von deren Metaboliten
oder Markern im ersten Teil der aufgeteilten Probe anhand der Analyse des zweiten Teils
oder bei Verzicht des Spielers auf die Analyse der Bestätigung der aufgeteilten Probe.
cc) Mit Ausnahme von Substanzen, für die in der Verbotsliste oder einem technischen
Dokument der WADA eigens eine Entscheidungsgrenze aufgeführt ist, begründet das
Vorhandensein einer verbotenen Substanz, ihrer Metaboliten oder Marker in der Probe
eines Spielers – unabhängig von ihrer Menge – einen Verstoß gegen Anti-Doping-
Vorschriften.
dd) Als Ausnahme zu Nr. 2., a) können in der Verbotsliste, den Internationalen Standards oder
technischen Dokumenten der WADA spezielle Kriterien für die Evaluation von verbotenen
Substanzen festgelegt werden, die auch endogen produziert werden können.b) Die Anwendung oder versuchte Anwendung einer verbotenen Substanz oder einer
verbotenen Methode durch einen Spieler.
aa) Es ist die persönliche Pflicht jedes Spielers, sich zu vergewissern, dass keine verbotenen
Substanzen in seinen Körper gelangen oder keine verbotene Methode an ihm angewendet
wird. Dementsprechend ist es nicht erforderlich, dass eine Absicht, ein Verschulden, eine
Fahrlässigkeit oder eine bewusste Anwendung durch den Spieler nachgewiesen wird, damit
ein Verstoß gegen Anti-Doping-Vorschriften wegen der Anwendung einer verbotenen
Substanz oder Methode vorliegt.
bb) Es ist nicht entscheidend, ob die Anwendung oder versuchte Anwendung einer verbotenen
Substanz oder Methode leistungssteigernd wirkt oder nicht. Ein Verstoß gegen Anti-Doping-
Vorschriften liegt vor, wenn eine verbotene Substanz oder eine verbotene Methode
verwendet wurde oder ein diesbezüglicher Versuch erfolgte.
c) Die Weigerung oder das Versäumnis, sich nach entsprechender Benachrichtigung durch
eine ordnungsgemäß bevollmächtigte Person der Abgabe bzw. der Probenahme zu
unterziehen, ein Fernbleiben von der Probenahme ohne zwingenden Grund oder eine
anderweitige Umgehung der Probenahme.
d) Meldepflichtverstöße
Jede Kombination von drei versäumten Kontrollen und/oder Verstößen gegen die
Meldepflicht gemäß dem Internationalen Standard für das Ergebnismanagement eines
Spielers, der einem Registered Testing Pool im Sinne des NADA-Codes (NADC) angehört, die
innerhalb eines 12-Monats-Zeitraums erfolgt, stellt einen Verstoß gegen die Anti-Doping-
Vorschriften dar.
e) Die unzulässige Einflussnahme oder der Versuch der unzulässigen Einflussnahme auf
irgendeinen Teil des Dopingkontrollverfahrens durch einen Spieler oder eine andere Person.
f) Der Besitz von verbotenen Substanzen und Methoden.
aa) Der Besitz von Substanzen oder die Anwendung von Methoden, die im Wettbewerb bzw.
Wettkampf (d. h. innerhalb der Zeitspanne ab 23.59 Uhr des Vortags eines Spiels, an dem
der Spieler voraussichtlich teilnehmen wird, bis zum Ende dieses Spiels und des Probe-
nahmeprozesses in Verbindung mit diesem Spiel) verboten sind, durch einen Spieler bzw.
– außerhalb von Wettbewerben – der Besitz von Substanzen oder die Anwendung von
Methoden, die außerhalb von Wettbewerben verboten sind, durch einen Spieler, es sei
denn, der Spieler belegt, dass der Besitz einen therapeutischen Zweck hat, für den eine
medizinische Ausnahmegenehmigung gemäß den WADA-/NADA-Vorschriften erteilt wurde,
oder er bringt eine andere annehmbare Rechtfertigung vor.
bb) Der Besitz von Substanzen oder die Anwendung von Methoden, die im Wettbewerb
verboten sind, durch eine Betreuungsperson bzw. – außerhalb von Wettbewerben – Besitz
von Substanzen oder die Anwendung von Methoden, die außerhalb von Wettbewerben
verboten sind, durch eine Betreuungsperson im Zusammenhang mit einem Spieler, Spiel
oder Training, es sei denn, die Betreuungsperson belegt, dass der Besitz einen
therapeutischen Zweck hat, für den eine Ausnahmegenehmigung für einen Spieler gemäß
den WADA-/NADA-Vorschriften erteilt wurde, oder sie bringt eine andere annehmbare
Rechtfertigung vor.
g) Der Handel oder versuchte Handel mit verbotenen Substanzen oder Methoden durch einen
Spieler oder eine andere Person.
h) Die Verabreichung oder versuchte Verabreichung im Wettbewerb von verbotenen
Substanzen oder die Anwendung von Methoden an Spieler oder, außerhalb von
Wettbewerben, die Verabreichung oder versuchte Verabreichung von Substanzen oder die
Anwendung von Methoden, die außerhalb von Wettbewerben verboten sind, an Spieler.
i) Die Beihilfe, Unterstützung, Anleitung, Anstiftung, Verschleierung, Verabredung oder
sonstige Tatbeteiligung oder versuchte Beihilfe im Zusammenhang mit einem Verstoß oder
einem versuchten Verstoß gegen Anti-Doping-Vorschriften oder einem Verstoß gegen § 8f
Nr. 1. der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB (Teilnahmeverbot während einer Sperre
oder vorläufigen Sperre) durch eine andere Person.
j) Der Umgang eines Spielers, Trainers, Betreuers, Offiziellen oder einer anderen Person, derbzw. die an die Anti-Doping-Bestimmungen des DFB gebunden ist, in beruflicher oder
sportlicher Funktion mit einem Trainer oder Betreuer,
aa) der an die Anti-Doping-Regelwerke eines Fußball-Verbandes oder einer Anti-Doping-
Organisation gebunden ist und gesperrt ist oder
bb) der nicht an die Anti-Doping-Regelwerke eines Fußball-Verbandes oder einer Anti-Doping-
Organisation gebunden ist und der nicht aufgrund eines Ergebnismanagement- und
Disziplinarverfahrens gesperrt wurde, jedoch dem in einem Straf-, Disziplinar- oder
standesrechtlichen Verfahren ein Verhalten nachgewiesen oder der für ein solches
Verhalten verurteilt wurde, das einen Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen dargestellt
hätte, soweit diese Anti-Doping-Bestimmungen zur Anwendung gelangt wären.
Die Dauer des Umgangsverbots entspricht der im Straf-, Disziplinar- oder im
standesrechtlichen Verfahren festgelegten Strafe, beträgt mindestens jedoch sechs Jahre ab
dem Zeitpunkt der Entscheidung oder
cc) der als Stroh- oder Mittelsmann für eine in aa) oder bb) beschriebene Person tätig wird.
Für einen Verstoß gegen j) muss nachgewiesen werden, dass der Spieler, Trainer, Betreuer oder
Offizielle von der Sperre des Trainers oder Betreuers wusste.
Der Spieler oder die andere Person muss beweisen, dass der Umgang mit dem in aa) und bb)
beschriebenen Trainer oder Betreuer nicht in beruflicher oder sportlicher Funktion erfolgt
und/oder dass ein solcher Umgang vernünftigerweise nicht hätte vermieden werden können.
Der DFB ist verpflichtet, seine Erkenntnis von Trainern und Betreuern, die den in aa), bb) oder cc)
genannten Kriterien entsprechen, an die NADA weiterzugeben, die ihrerseits die WADA in
Kenntnis setzt.
k) Die treuwidrige oder unverhältnismäßige Handlung eines Spielers oder einer anderen
Person zwecks Abschreckung vor oder Vergeltung für Anzeigen bei Behörden. Hierzu zählt:
aa) jede Handlung, die eine andere Person bedroht oder einzuschüchtern versucht, damit diese
einen möglichen Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen des DFB, das FIFA-Anti-Doping-
Reglement und/oder den NADA- und/oder WADA-Codes nicht bei seinem Mitgliedsverband,
dem DFB, der NADA, WADA, der FIFA oder einer anderen Anti-Doping-Organisation, einer
Strafverfolgungsbehörde, einem Aufsichts-, Disziplinar- oder Anhörungsorgan oder einer
Person, die für die NADA, WADA, die FIFA oder eine andere Anti-Doping-Organisation eine
Untersuchung durchführt, anzeigt
bb) Vergeltung gegen eine Person, die dem Mitgliedsverband, dem DFB, der NADA, der WADA,
der FIFA oder einer anderen Anti-Doping-Organisation, einer Strafverfolgungsbehörde,
einem Aufsichts-, Disziplinar- oder Anhörungsorgan oder einer Person, die für den
Mitgliedsverband, den DFB, die NADA, die WADA, die FIFA oder eine andere Anti-Doping-
Organisation eine Untersuchung durchführt, gutgläubig Beweise oder Informationen zu
einem möglichen Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen des DFB, das FIFA-Anti-Doping-
Reglement und/oder den NADA- und/oder WADA-Codes vorlegt.
3. Verbotene Substanzen und Methoden
Verboten sind alle Substanzen und Methoden, die in der Verbotsliste aufgeführt sind, die von der
WADA periodisch herausgegeben wird und vom DFB im Anhang A der Anti-Doping-Richtlinien in der
jeweiligen Fassung übernommen wird. In dieser Liste sind alle Wirkstoffe und Methoden aufgeführt,
die wegen ihres leistungssteigernden Potenzials in künftigen Spielen oder ihres
Maskierungspotenzials jederzeit (bei und außerhalb von Wettbewerben) als Dopingmittel verboten
sind, sowie jene Substanzen und Methoden, die nur bei Wettbewerben verboten sind. Die jeweils
gültige Dopingliste ist auf der Website der WADA unter www.wada-ama.org einzusehen. Sofern die
jeweils veröffentlichte Verbotsliste nichts Abweichendes vorsieht, treten diese und ihre
Überarbeitungen drei Monate nach Veröffentlichung durch die WADA in Kraft, ohne dass es hierzu
weiterer Maßnahmen seitens der NADA oder des DFB bedarf. Der DFB veröffentlicht diese als
Anhang zu den Anti-Doping-Richtlinien.
Die von der WADA erstellte Liste von verbotenen Substanzen und Methoden, die Einordnung der
Substanzen in bestimmte Kategorien, die Einordnung einer Substanz als jederzeit oder innerhalb
eines Wettkampfs verboten sowie die Einstufung der Substanzen und Methoden als spezifische
Substanz, spezifische Methode oder Suchtmittel im Rahmen der Verbotsliste sind verbindlich undkönnen nicht von einem Spieler oder einer anderen Person mit der Begründung angefochten
werden, insbesondere nicht mit der Begründung, dass es sich bei der Substanz bzw. der Methode
nicht um ein Maskierungsmittel handelt oder dass die Substanz bzw. die Methode nicht das
Potenzial hat, die Leistung zu steigern, dass sie kein Gesundheitsrisiko darstellt oder dass sie nicht
gegen den Sportsgeist verstößt.
Alle verbotenen Substanzen gelten als „spezifische Substanzen“, mit Ausnahme von Substanzen, die
nicht als spezifische Substanzen in der Verbotsliste aufgeführt sind. Eine verbotene Methode ist
keine spezifische Methode, es sei denn, sie ist ausdrücklich als spezifische Methode in der
Verbotsliste aufgeführt.
Suchtmittel gelten als verbotene Substanzen, wenn sie in der Verbotsliste konkret als Suchtmittel
gekennzeichnet sind.
4. Medizinische Ausnahmegenehmigung (TUE)
Einem Spieler kann eine Medizinische Ausnahmegenehmigung erteilt werden, mit der die
Anwendung einer in der WADA-Verbotsliste aufgeführten Substanz oder Methode zugelassen wird.
Das Vorhandensein einer verbotenen Substanz oder ihrer Metaboliten oder Marker, und/oder der
Gebrauch oder der Versuch des Gebrauchs einer verbotenen Substanz oder verbotenen Methode,
der Besitz einer verbotenen Substanz oder verbotenen Methode oder die Verabreichung oder der
Versuch der Verabreichung einer verbotenen Substanz oder einer verbotenen Methode stellt keinen
Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen dar, wenn eine gültige Medizinische
Ausnahmegenehmigung (TUE) nach den Vorgaben des International Standard for Therapeutic Use
Exemptions und/oder dem Standard für Medizinische Ausnahmegenehmigungen vorliegt.
5. Beweislast und Beweisstandards
a) Der DFB muss nachweisen, dass gegen eine Anti-Doping-Vorschrift verstoßen wurde.
Das Beweismaß besteht darin, dass der DFB im sportgerichtlichen Verfahren gegenüber
dem jeweiligen Rechtsorgan überzeugend nachweisen kann, dass ein Verstoß gegen Anti-
Doping-Bestimmungen vorliegt, wobei die Schwere des Vorwurfs zu berücksichtigen ist.
Die Anforderungen an das Beweismaß sind in jedem Fall höher als die leicht überwiegende
Wahrscheinlichkeit, jedoch geringer als ein Beweis, der jeden vernünftigen Zweifel
ausschließt.
Liegt die Beweislast bei dem Spieler oder der anderen Person, dem bzw. der ein Verstoß
gegen Anti-Doping-Vorschriften vorgeworfen wird, genügt, vorbehaltlich der
nachstehenden Regelungen, für den entsprechenden Beweis die leicht überwiegende
Wahrscheinlichkeit.
b) Im Zusammenhang mit dem Verstoß gegen Anti-Doping-Vorschriften kann der Sachverhalt
mit allen verlässlichen Mitteln, einschließlich Geständnissen, festgestellt werden. Folgende
Beweisregeln sind in Dopingfällen anwendbar:
Analyseverfahren oder Entscheidungsgrenzen, die nach Beratung innerhalb der relevanten
wissenschaftlichen Gemeinschaft von der WADA genehmigt wurden oder die Gegenstand
einer Prüfung durch unabhängige Gutachter (Peer Review) waren, gelten als
wissenschaftlich valide.
Ein Spieler oder die andere Person, der bzw. die bestreiten will, dass die Voraussetzungen
für eine solche Vermutung erfüllt sind oder die Vermutung der wissenschaftlichen Validität
widerlegen möchte, muss zunächst die WADA und die NADA über die Anfechtung und ihre
Grundlage in Kenntnis setzen.
Das DFB-Sportgericht, das DFB-Bundesgericht oder der CAS darf auf eigene Veranlassung
die WADA über eine solche Anfechtung in Kenntnis setzen. Innerhalb von 10 Tagen nach
Eingang einer solchen Mitteilung und der Fallakte bei der WADA hat die WADA ebenfalls
das Recht, dem Rechtsstreit als Partei beizutreten, als Amicus Curiae im Sinne des NADA-
Codes am Verfahren teilzunehmen oder in anderer Form Beweise in einem solchen
Verfahren vorzulegen. In Fällen, die vor dem CAS verhandelt werden, ernennt der CAS auf
Anforderung der WADA, einen geeigneten wissenschaftlichen Sachverständigen, der den
CAS bei der Bewertung der Anfechtung unterstützt.
Es wird davon ausgegangen, dass WADA-akkreditierte oder auf andere Weise von der
WADA genehmigte Labors die Analysen sowie die Aufbewahrung der Proben nach demInternationalen Standard der WADA für Labors durchgeführt haben. Der Spieler oder eine
andere Person kann diese Vermutung widerlegen, indem er bzw. sie eine Abweichung vom
Internationalen Standard für Labors nachweist, die nach vernünftigem Ermessen ein von
der Norm abweichendes Analyseergebnis verursacht haben könnte.
Widerlegt ein Spieler oder eine andere Person die oben genannte Annahme, indem er bzw.
sie nachweist, dass eine Abweichung vom Internationalen Standard für Labors vorlag, die
nach vernünftigem Ermessen das von der Norm abweichendes Analyseergebnis verursacht
haben könnte, muss der DFB gegebenenfalls unter Hinzuziehung der NADA beweisen, dass
diese Abweichung nicht Ursache des von der Norm abweichendes Analyseergebnis war.
c) Abweichungen vom Internationalen Standard für Dopingkontrollen, die nicht die Ursache
für ein von der Norm abweichendes Analyseergebnis oder für andere Verstöße gegen Anti-
Doping-Vorschriften darstellen, haben keinen Einfluss auf die Gültigkeit der
Analyseergebnisse. Erbringt der Spieler oder eine andere Person den Nachweis, dass eine
Abweichung von den nachfolgenden Bestimmungen des Internationalen Standards für
Dopingkontrollen erfolgt ist, die nach vernünftigem Ermessen den positiven Befund oder
einen anderen Verstoß gegen die Anti-Doping-Vorschriften verursacht haben könnte, so
geht die Beweislast auf den DFB bzw. die NADA über, der/die nachweisen muss, dass die
Abweichung nicht die Ursache für das von der Norm abweichendes Analyseergebnis war
bzw. worin der tatsächliche Grund für den Verstoß gegen die Anti-Doping-Vorschriften
bestand. Im Einzelnen gilt:
aa) eine Abweichung vom Internationalen Standard für Dopingkontrollen und Untersuchungen
hinsichtlich der Probenahme oder Handhabung der Probe, die einen Verstoß gegen Anti-
Doping-Bestimmungen auf der Grundlage eines von der Norm abweichenden
Analyseergebnisses hinreichend hätte bewirken können; in diesem Fall trägt der DFB bzw.
die NADA die Beweislast dafür, dass das von der Norm abweichende Analyseergebnis nicht
auf diese Abweichung zurückzuführen ist;
bb) Eine Abweichung vom Internationalen Standard für das Ergebnismanagement oder vom
Internationalen Standard für Dopingkontrollen und Untersuchungen in Bezug auf ein von
der Norm abweichendes Ergebnis des Biologischen Athletenpasses, die nach vernünftigem
Ermessen einen Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen verursacht haben könnte: In
diesem Fall obliegt es dem DFB bzw. NADA nachzuweisen, dass diese Abweichung den
Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen nicht verursacht hat
cc) eine Abweichung vom Internationalen Standard für das Ergebnismanagement hinsichtlich
der Pflicht, den Spieler über die Öffnung der B-Probe zu benachrichtigen, die einen Verstoß
gegen Anti-Doping-Bestimmungen auf der Grundlage eines von der Norm abweichenden
Analyseergebnisses hinreichend hätte bewirken können; in diesem Fall trägt der DFB bzw.
die NADA die Beweislast dafür, dass das von der Norm abweichende Analyseergebnis nicht
auf diese Abweichung zurückzuführen ist;
dd) eine Abweichung vom Internationalen Standard für das Ergebnismanagement hinsichtlich
der Benachrichtigung des Spielers, die einen Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen auf
der Grundlage eines Meldepflicht- und Kontrollversäumnisses hinreichend hätte bewirken
können; in diesem Fall trägt der DFB bzw. die NADA die Beweislast dafür, dass das
Meldepflicht- und Kontrollversäumnis nicht auf diese Abweichung zurückzuführen ist.
d) Sachverhalte, die durch die Entscheidung eines Gerichts oder des zuständigen Berufs-
Disziplinargerichts, welche nicht Gegenstand eines laufenden Rechtsbehelfsverfahrens sind,
festgestellt wurden, gelten als unwiderlegbarer Beweis gegen den Spieler oder die andere
Person, den bzw. die die entsprechende Entscheidung betroffen hat. Dies gilt nicht, sofern
der Spieler oder die andere Person nachweisen kann, dass die Entscheidung gegen den
deutschen Ordre Public verstoßen hat.
e) Das Disziplinarorgan kann in einem Verfahren wegen eines Verstoßes gegen Anti-Doping-
Bestimmungen negative Rückschlüsse aus der Tatsache ziehen, dass der Spieler oder die
andere Person, dem bzw. der ein Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen vorgeworfen
wird, sich nach einer mit angemessener Vorlaufzeit ergangenen Aufforderung weigert, an
der Anhörung (gemäß den Anweisungen des Disziplinarorgans entweder persönlich oder
telefonisch) teilzunehmen und Fragen des Disziplinarorgans oder der Anti-Doping-Organisation zu beantworten, die ihm bzw. ihr den Verstoß gegen Anti-Doping-
Bestimmungen vorwirft.
6. Jeder Spieler ist verpflichtet, sich einer angeordneten Dopingkontrolle zu unterziehen. Zuständig für
die Anordnung und Durchführung sämtlicher Dopingkontrollen ist die NADA. Dabei ist jeder Spieler
verpflichtet, auf Anfrage der NADA die Identität seiner Betreuungspersonen mitzuteilen. Des
Weiteren sind Spieler und Betreuungspersonen verpflichtet, an Untersuchungen von Verstößen
gegen Anti-Doping-Bestimmungen mitzuwirken.
7. Jeder Verein und jede Tochtergesellschaft hat zu gewährleisten, dass die Spieler seiner bzw. ihrer
Mannschaft nicht gedopt werden und sich angeordneten Dopingkontrollen unterziehen. Dem Verein
oder der Tochtergesellschaft ist das Handeln der Angestellten und beauftragten Personen sowie
dem Verein zusätzlich das Handeln seiner Mitglieder zuzurechnen.
8. Im Übrigen gelten die Anti-Doping-Richtlinien des DFB.
Bei Unstimmigkeiten zwischen den Anti-Doping-Regelungen des DFB und dem FIFA-Anti-Doping-
Reglement gehen die Bestimmungen des FIFA-Anti-Doping-Reglements vor.
§6
Verein/Kapitalgesellschaft in Insolvenz
1. Die klassenhöchste Herren-Mannschaft eines Vereins, über dessen Vermögen das Insolvenzverfahren
eröffnet oder bei dem die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt wird, gilt als
Absteiger in die nächste Spielklasse und rückt insoweit am Ende des Spieljahrs an den Schluss der
Tabelle. Verfügt der Verein ausschließlich über Frauen-Mannschaften, so gilt die klassenhöchste
Frauen-Mannschaft als Absteiger. Die Anzahl der aus sportlichen Gründen absteigenden Mannschaften
vermindert sich entsprechend.
Für Vereine und Kapitalgesellschaften der 3. Liga, der Regionalliga, der Frauen-Bundesliga und 2.
Frauen-Bundesliga gilt Nr. 6. Die Regional- und Landesverbände können eine Regelung gemäß Nr. 6.
auch für tiefere Spielklassen in ihrem Zuständigkeitsbereich einführen und insofern von den Nrn. 1. bis
5. abweichen.
2. Die von einer solchen Mannschaft ausgetragenen oder noch auszutragenden Spiele werden nicht
gewertet. Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder seine
Ablehnung nach dem letzten Spieltag, aber vor Ende des Spieljahrs (30.6.), getroffen wird.
3. Scheidet diese Mannschaft vor oder während des laufenden Spieljahrs aus dem Spielbetrieb aus, gelten
die für diesen Fall vorgesehenen Bestimmungen des für die jeweilige Spielklasse zuständigen
Verbandes.
4. Wird die klassenhöchste Mannschaft vor dem ersten Pflichtspiel des neuen Spieljahrs vom Spielbetrieb
zurückgezogen und für die folgende Spielzeit nicht mehr zum Spielbetrieb gemeldet, so hat dies auf die
Spielklassenzugehörigkeit der anderen Mannschaften des Vereins keine Auswirkung.
5. Vorstehende Bestimmungen gelten für zum Spielbetrieb zugelassene Kapitalgesellschaften
entsprechend, nicht jedoch für die Vereine und Kapitalgesellschaften der Lizenzligen.
6. Für Vereine und Kapitalgesellschaften der 3. Liga, Frauen-Bundesliga, 2. Frauen-Bundesliga und
Regionalliga sowie gegebenenfalls weiterer Spielklassen, bei denen diese Bestimmung von den
Regional- und Landesverbänden statt der vorstehenden Nrn. 1. bis 5. eingeführt wurde, gilt:
Beantragt ein Verein dieser Spielklassen selbst die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gegen sich oder
wird auf Antrag eines Gläubigers gegen einen solchen Verein im Zeitraum vom 1.7. eines Jahres bis
einschließlich des letzten Spieltags einer Spielzeit rechtskräftig ein Insolvenzverfahren eröffnet oder die
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt oder zeigt ein Verein seine
Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung während der Rechtshängigkeit einer Restrukturierungssache
nach Stabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz (StaRUG) beim Restrukturierungsgericht an, so
werden der klassenhöchsten Mannschaft mit Stellung des eigenen Antrags des Vereins auf Eröffnung
des Insolvenzverfahrens, sonst mit Rechtskraft des Beschlusses des Insolvenzgerichts bzw. mit der
Anzeige der Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung beim Restrukturierungsgericht, neun
Gewinnpunkte im Herrenspielbetrieb bzw. sechs Gewinnpunkte im Frauenspielbetrieb mit sofortiger
Wirkung aberkannt. Spielt der Verein in der 3. Liga oder Regionalliga und der Frauen-Bundesliga
und/oder 2. Frauen-Bundesliga, so wird der Abzug von Gewinnpunkten nur in der 3. Liga bzw.Regionalliga vorgenommen, anderenfalls nur in der Frauen-Bundesliga bzw. 2. Frauen-Bundesliga.
Beantragt der Verein selbst das Insolvenzverfahren nach Abschluss des letzten Spieltags bis
einschließlich zum 30.6. eines Jahres ergeht der Beschluss des Insolvenzgerichts auf Antrag eines
Gläubigers in diesem Zeitraum, oder zeigt der Verein die Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung dem
Restrukturierungsgericht in diesem Zeitraum an, erfolgt die Aberkennung der Gewinnpunkte gemäß
Absatz 1 mit Wirkung zu Beginn der sich anschließenden Spielzeit. Die Aberkennung der Gewinnpunkte
entfällt, sofern der Verein in eine tiefere Spielklasse abgestiegen ist. Maßgeblich ist der Status in der
laufenden Spielzeit. Der Verein ist verpflichtet, die Träger aller Spielklassen seiner Mannschaften über
einen eigenen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens bzw. über eine Anzeige der
Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung beim Restrukturierungsgericht unverzüglich schriftlich zu
unterrichten.
Die Entscheidung über den Punktabzug trifft der DFB-Spielausschuss für die 3. Liga, der DFB-Ausschuss
für Frauen- und Mädchenfußball für die Frauen- Bundesliga/2. Frauen-Bundesliga bzw. der für die
jeweilige Spielklasse zuständige Ausschuss auf Ebene der DFB-Mitgliedsverbände. Der DFB-
Spielausschuss/DFB-Ausschuss für Frauen-und Mädchenfußball bzw. der für die jeweilige Spielklasse
zuständige Ausschuss auf Ebene der DFB-Mitgliedsverbände, kann von dem Punktabzug absehen, wenn
gegen den Hauptsponsor oder einen anderen vergleichbaren Finanzgeber des Vereins zuvor ein
Insolvenzverfahren eröffnet, die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt wurde,
oder sich der Hauptsponsor bzw. Finanzgeber in einer Restrukturierung gemäß StaRUG befindet.
Vorstehende Bestimmungen gelten für zum Spielbetrieb zugelassene Kapitalgesellschaften
entsprechend.
§7
Spieljahr – Spielpause
1. Das Spieljahr beginnt in der Regel am 1. Juli und endet mit dem 30. Juni des folgenden Jahres. Sofern im
Jugendbereich einzelne Spielansetzungen über den 30. Juni hinaus notwendig werden, können die
zuständigen Verbände abweichende Regelungen treffen.
Für die Spielzeiten 2019/2020 und 2020/2021 gilt:
Sofern Spielansetzungen über den 30. Juni 2020 hinaus notwendig werden, um das Spieljahr
abschließen zu können, können der DFB und seine Mitgliedsverbände für ihre Spielklassen abweichende
Regelungen für das Ende des Spieljahres und den Beginn des folgenden Spieljahres 2020/2021
beschließen. Zuständig für einen solchen Beschluss hinsichtlich vom DFB veranstalteter Bundesspiele (§
42 DFB-Spielordnung) ist das DFB-Präsidium.
2. Die Mitgliedsverbände sind verpflichtet, innerhalb eines Spieljahres einen Zeitraum von vier Wochen
von verbandsseitig angesetzten Spielen freizuhalten. Jeder Verband bestimmt diese Spielpause selbst.
Für die Spielzeiten 2019/2020 und 2020/2021 gilt:
Die Regelung in Nr. 2., Satz 1 wird außer Kraft gesetzt.
3. Durch die Spielpause darf die Veranstaltung von Bundesspielen und die Teilnahme von Mannschaften
oder einzelner Spieler an Bundesspielen nicht beeinträchtigt werden.
4. Bei der Spielansetzung haben Bundesspiele Vorrang vor Spielen auf Regional- und Landesverbandsebene.
§8
Status der Fußballspieler
Der Fußballsport wird von Amateuren und Berufsspielern (Nicht-Amateuren) ausgeübt. Als Berufsspieler
gelten Vertragsspieler und Lizenzspieler. Die Begriffe Amateur und Berufsspieler gelten für männliche und
weibliche Spieler.
1. Amateur ist, wer aufgrund seines Mitgliedschaftsverhältnisses Fußball spielt und als Entschädigung kein
Entgelt bezieht, sondern seine nachgewiesenen Auslagen und allenfalls einen pauschalierten
Aufwendungsersatz bis zu 249,99 € im Monat erstattet erhält.
2. Vertragsspieler ist, wer über sein Mitgliedschaftsverhältnis hinaus einen schriftlichen Vertrag mit
seinem Verein abgeschlossen hat und über seine nachgewiesenen Auslagen hinaus (Nr.1.)
Vergütungen oder andere geldwerte Vorteile von mindestens 250,00 € monatlich erhält. Er muss sich
im Vertrag verpflichten, die steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Abgaben für die gesamteLaufzeit des Vertrages abführen zu lassen und die Erfüllung dieser Verpflichtungen zusammen mit
dem Antrag auf Spielerlaubnis, spätestens jedoch binnen drei Monaten nach Vertragsbeginn, durch
den Verein nachweisen oder zumindest glaubhaft machen; andernfalls hat er nachzuweisen, dass
diese Abführungspflicht nicht besteht. Darüber hinaus ist auf Anforderung des zuständigen Landes-
bzw. Regionalverbandes die ordnungsgemäße Abführung der steuerlichen und sozialversicherungs-
rechtlichen Abgaben während der gesamten Vertragslaufzeit nachzuweisen.
Bei Kapitalgesellschaften ist der Vertrag mit dem Verein oder dessen Tochtergesellschaft, die am
Spielbetrieb teilnimmt, zu schließen. Der Spieler muss Mitglied des Vereins sein.
3. Lizenzspieler ist, wer das Fußballspiel aufgrund eines mit einem Lizenzverein oder einer
Kapitalgesellschaft geschlossenen schriftlichen Vertrages betreibt und durch Abschluss eines
schriftlichen Lizenzvertrages mit dem Ligaverband zum Spielbetrieb zugelassen ist. Das Nähere regelt
das Ligastatut; dies gilt insbesondere für den nationalen Vereinswechsel von Lizenzspielern.
§9
Geltungsumfang der Spielerlaubnis
1. Amateure und Vertragsspieler können unter Beachtung der für den Erwerb und den Umfang der
Spielberechtigung maßgebenden Vorschriften der Landes- und Regionalverbände in allen Mannschaften
der Vereine und Tochtergesellschaften aller Spielklassen mitwirken.
2. Die Spielberechtigung für vom DFB veranstaltete Bundesspiele ist in § 44 der DFB-Spielordnung geregelt,
der Spielereinsatz in Mannschaften von Lizenzspielern (Lizenzspieler-Mannschaft) in § 53 der DFB-
Spielordnung. Die §§ 11 bis 14 der DFB-Spielordnung bleiben unberührt.
§ 10
Spielerlaubnis- Spielerpass
1. Spielerlaubnis
1.1 Spielberechtigt ist nur dasjenige Vereinsmitglied, das nach den Vorschriften seines Mitgliedsverbandes
eine Spielerlaubnis für seinen Verein erhalten hat und damit registriert ist. Frühester Tag der
Spielberechtigung ist der Tag des Eingangs des Antrags auf Erteilung der Spielerlaubnis bei der Passstelle
des zuständigen Mitgliedsverbandes.
Durch die Registrierung verpflichtet sich ein Spieler, die Statuten und Reglements der FIFA und der
UEFA, sowie die Satzungen und Ordnungen des DFB und seines jeweiligen Landesverbandes bzw. des
Ligaverbandes einzuhalten.
1.2 Die Spielberechtigung wird erteilt für Pflicht- und Freundschaftsspiele. Pflichtspiele sind
Meisterschaftsspiele, Pokalspiele sowie Entscheidungsspiele über Auf- und Abstieg. Für
Pokalwettbewerbe der Mitgliedsverbände des DFB kann in der Spielordnung des zuständigen Verbandes
festgelegt werden, dass auch Spieler eingesetzt werden können, die lediglich für
Freundschaftsspiele ihres Vereins eine Spielberechtigung besitzen.
1.3 Ein Spieler kann in einem Spieljahr nur für einen Verein eine Spielerlaubnis erhalten, es sei denn, der
abgebende Verein stimmt einem Vereinswechsel zu. § 17 Nr. 2.7 der DFB-Spielordnung bleibt
unberührt.
1.4 Die Spielerlaubnis für Lizenzspieler richtet sich nach den Bestimmungen des Ligastatuts, diejenige für
Juniorenspieler mit einer Ausnahmegenehmigung für die Teilnahme an Bundesspielen der Vereine und
Kapitalgesellschaften der Lizenzligen zusätzlich nach den Vorgaben des § 6 Nr. 2. der DFB-
Jugendordnung. Die Ausstellung eines Spielerpasses ist nicht erforderlich.
1.5 Bei der Erteilung der ersten Spielerlaubnis für reamateurisierte Spieler ist § 29 der DFB-Spielordnung zu
beachten.
1.6 Die Mitgliedsverbände des DFB sind verpflichtet, sämtliche Spielberechtigungszeiten der Spieler in ihrem
Verbandsbereich elektronisch zu erfassen und die für die Abwicklung nationaler sowie internationaler
Vereinswechsel, einschließlich etwaiger hieran anknüpfender verbandsrechtlicher Zahlungspflichten
gemäß dem FIFA-Reglement bezüglich Status und Transfer von Spielern und dessen Anhängen 4 und 5,
notwendigen Daten zur Verfügung zu stellen.
Für internationale Vereinswechsel ist bei der Erfassung der Spielberechtigungszeiten insbesondere
Folgendes zu beachten:Auf einem Dokument, das dem aufnehmenden Nationalverband zur Verfügung zu stellen ist, müssen die
Spielberechtigungszeiten aller Vereine und deren Trainingskategorie auf der Grundlage des FIFA-
Reglements bezüglich Status und Transfer von Spielern zum Zeitpunkt der jeweiligen Registrierung
vermerkt sein, für die der Spieler seit der Spielzeit seines 12. Geburtstags gespielt hat. Fällt der
Geburtstag eines Spielers in den Zeitraum zwischen dem letzten Meisterschaftsspieltag des
abgelaufenen Spieljahrs und dem ersten Meisterschaftsspieltag des neuen Spieljahrs, so muss derjenige
Verein/diejenige Kapitalgesellschaft vermerkt sein, für den/die der Spieler in der Spielzeit nach seinem
Geburtstag spielberechtigt war.
1.7 Die Spielerlaubnis als Amateurspieler für einen Verein der 3. Liga, der 4. Spielklassenebene, der
Junioren-Bundesligen, der 2. Frauen-Bundesliga oder der B-Juniorinnen-Bundesliga darf für einen Nicht-
EU-Ausländer erst nach Vorlage einer Niederlassungs- oder Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, die
mindestens bis zum Ende des jeweiligen Spieljahres gültig ist.
Die Spielerlaubnis als Vertragsspieler darf erst nach Vorlage eines Aufenthaltstitels zum Zwecke der
Beschäftigung erteilt werden, der ihm die berufliche Tätigkeit als Fußballspieler gestattet. Die
Spielerlaubnis darf nur bis zum Ende der Spielzeit (30.6.) erteilt werden, die von der Laufzeit des
Aufenthaltstitels vollständig umfasst wird. Dies trifft auch auf Spieler aus den Ländern zu, die zum
1.5.2004 der EU beitreten, solange für das betreffende Land die Arbeitnehmerfreizügigkeit noch nicht
gewährt wurde.
2. Spielberechtigungsliste in der 3. Liga
2.1 Spielberechtigt für die 3. Liga sind nur Spieler, die auf der von der DFB-Zentralverwaltung
herausgegebenen jeweiligen Spielberechtigungsliste für die 3. Liga aufgeführt sind.
Auf der jeweiligen Spielberechtigungsliste dürfen nicht mehr als drei Nicht-EU-Ausländer aufgeführt
werden.
Von der Regelung in Absatz 2 bleiben bestehende Arbeitsverträge mit Nicht-EU-Ausländern unberührt.
Dies gilt auch bei vereinbarter Option, wenn sie vom Spieler wahrgenommen wird. Nimmt der Verein
eine vereinbarte Option wahr, muss er sich den Spieler auf die zulässige Zahl von Nicht-EU-Ausländern
anrechnen lassen. Neue Arbeitsverträge mit Nicht-EU-Ausländern dürfen nur dann abgeschlossen
werden, wenn die zulässige Zahl von Nicht-EU-Ausländern damit nicht überschritten wird.
Die Absätze 2 bis 4 finden keine Anwendung auf rechtmäßig beschäftigte Vertrags- oder Lizenzspieler,
die Staatsangehörige eines Landes sind, das mit der EU ein Abkommen geschlossen hat, durch das eine
Gleichbehandlung von Staatsangehörigen dieses Landes hinsichtlich der Arbeitsbedingungen, der
Entlohnung oder der Entlassung mit Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der EU gewährt wird.
2.2 Zur Aufnahme in die Spielberechtigungsliste hat der Verein eine Aufstellung mit den Namen aller Spieler,
die in der 3. Liga eingesetzt werden sollen, mit Angabe der Geburtsdaten, der Spielerpassnummer bzw.
Registriernummer, des Spielerstatus und der Nationalität des Spielers bis zum Beginn der
Meisterschaftsspiele an die DFB-Zentralverwaltung zu senden. Diese Aufstellung des Vereins ist vorab
vom zuständigen Landesverband schriftlich zu bestätigen.
Nachträge und Veränderungen sind der DFB-Zentralverwaltung unverzüglich schriftlich zu melden.
2.3 Die Aufnahme eines Spielers in die Spielberechtigungsliste für die 3. Liga erfolgt erst, wenn
- neben den vorstehenden Unterlagen die von dem betreffenden Spieler unterzeichnete Erklärung über
die Anerkennung der Rechtsgrundlagen der 3. Liga vorliegt. Der Unterzeichnung dieser
Anerkennungserklärung bedarf es nicht, wenn ein Lizenzspieler die entsprechenden Rechtsgrundlagen
bereits durch den mit dem Ligaverband abgeschlossenen Lizenzvertrag (Lizenzvertrag Spieler) anerkannt
hat;
- der Spieler die Sporttauglichkeit durch Vorlage einer ärztlichen Bestätigung nachweist. Hierzu muss
sich der Spieler einer internistisch-allgemeinmedizinischen Untersuchung unterziehen. Die genauen
Untersuchungsanforderungen legt der DFB-Spielausschuss auf Vorschlag der Kommission Sportmedizin
fest;
- bei einem Vertragsspieler eine Kopie des zwischen dem Spieler und seinem Verein bzw. seiner
Kapitalgesellschaft abgeschlossenen Vertrags bei der DFB-Zentralverwaltung eingereicht wurde.
Handelt es sich bei einem Spieler einer Zweiten Mannschaft eines Lizenzvereins um einen nicht
freizügigkeitsberechtigten Ausländer, ergibt sich die Spielberechtigung für die Zweite Mannschaft aus
dem Geltungsumfang der erteilten Arbeitsaufenthaltserlaubnis, die den Einsatz in der ZweitenMannschaft ausdrücklich beinhalten muss.
2.4 Die Vereine tragen die Rechtsfolgen, wenn sie Spieler in der 3. Liga zum Einsatz bringen, die auf der
Spielberechtigungsliste nicht aufgeführt sind.
3. Spielberechtigungsliste in der Frauen-Bundesliga und 2. Frauen-Bundesliga
3.1 Spielberechtigt für die Frauen-Bundesliga und 2. Frauen-Bundesliga sind nur Spielerinnen, die auf der
von der DFB-Zentralverwaltung herausgegebenen Spielberechtigungsliste aufgeführt sind. Auf der
Spielberechtigungsliste dürfen im Spieljahr 2005/2006 nicht mehr als fünf Nicht-EU-Ausländerinnen,
vom Spieljahr 2006/2007 an nicht mehr als drei Nicht-EU-Ausländerinnen aufgeführt werden.
§ 10 Nr. 2.1, Absätze 3, 4 und 5 gelten entsprechend.
3.2 Zur Aufnahme in die Spielberechtigungsliste hat der Verein eine Aufstellung mit den Namen aller
Spielerinnen, die in der Frauen-Bundesliga oder 2. Frauen-Bundesliga eingesetzt werden sollen, mit
Angabe der Geburtsdaten, der Spielerpassnummer bzw. Registriernummer, des Spielerstatus und der
Nationalität der Spielerin bis zum Beginn der Meisterschaftsspiele an die DFB-Zentralverwaltung zu
senden. Diese Aufstellung des Vereins ist vorab vom zuständigen Landesverband schriftlich zu
bestätigen. Nachträge und Veränderungen sind der DFB-Zentralverwaltung unverzüglich, spätestens
jedoch freitags bis 12.00 Uhr, schriftlich zu melden.
3.3 Voraussetzung zur Aufnahme in die Spielberechtigungsliste der Frauen-Bundesliga und 2. Frauen-
Bundesliga ist zudem, dass die Sporttauglichkeit nach einer vorgeschriebenen ärztlichen Untersuchung
auf orthopädischem und kardiologisch-internistischem Gebiet nachgewiesen wird. Diese schließt die
Verpflichtung ein, jährlich zu Beginn eines jeden neuen Spieljahres in die Frauen-Bundesliga oder 2.
Frauen-Bundesliga die Sporttauglichkeit vom Verein, vom beauftragten Arzt und von der Spielerin
gemeinsam zu unterzeichnen ist.
3.4 Die Aufnahme einer Spielerin in die Spielberechtigungsliste für die Frauen-Bundesliga oder die 2.
Frauen-Bundesliga erfolgt erst, wenn neben den nach 3.2 erforderlichen Unterlagen die von der
Spielerin unterzeichnete Erklärung über die Anerkennung des § 34 der DFB-Spielordnung (Abstellung
von Spielern) vorliegt.
3.5 Zusätzliche Voraussetzung zur Aufnahme in die Spielberechtigungsliste bei einer Vertragsspielerin ist die
Einreichung einer Kopie des zwischen der Spielerin und ihrem Verein bzw. seiner Kapitalgesellschaft
abgeschlossenen Vertrags bei der DFB-Zentralverwaltung.
3.6 Vereine mit je einer Mannschaft in der Frauen-Bundesliga und 2. Frauen-Bundesliga können entweder
eine gemeinsame oder für jede Mannschaft eine getrennte Spielberechtigungsliste abgeben. Eine
Spielerin kann gleichzeitig auf beiden Spielberechtigungslisten gemeldet werden.
3.7 Die Vereine tragen die Rechtsfolgen, wenn sie Spielerinnen in der Frauen-Bundesliga oder 2. Frauen-
Bundesliga zum Einsatz bringen, die auf der Spielberechtigungsliste nicht aufgeführt sind.
4. Spielgemeinschaften
Wo die örtlichen Verhältnisse es notwendig erscheinen lassen, können die Mitgliedsverbände
Spielgemeinschaften zulassen. Spielgemeinschaften haben nur ein eingeschränktes Aufstiegsrecht. Sie
sind nicht für DFB-Spielklassen und für die fünfte Spielklassenebene der Herren zugelassen.
5. Zweitspielrecht
Unter folgenden Voraussetzungen ist einem Spieler durch den zuständigen Mitgliedsverband bis zum
Ende der jeweiligen Spielzeit ein Zweitspielrecht für einen weiteren Verein (Zweitverein) zu erteilen:
5.1 Wechselnde Aufenthaltsorte
– Der Spieler ist Student, Berufspendler oder gehört einer vergleichbaren Personengruppe an.
– Der Zweitverein nimmt mit seiner ersten Herren-Mannschaft am Spielbetrieb auf Ebene der
Kreisklassen teil.
Für den Frauen-Bereich gilt insoweit Folgendes: Der Zweitverein nimmt mit seiner ersten Frauen-
Mannschaft in einer der beiden unteren Spielklassen am Spielbetrieb teil.
– Die Entfernung vom Stammverein zum Zweitverein beträgt mindestens 100 Kilometer.
– Der Stammverein stimmt der Erteilung des Zweitspielrechts schriftlich zu.
– Der Spieler stellt beim zuständigen Mitgliedsverband einen zu begründenden Antrag auf Erteilungeines Zweitspielrechts und weist das Vorliegen der vorstehenden Voraussetzungen für die Erteilung
eines Zweitspielrechts nach.
5.2 Ü-Bereich Für Mannschaften des Ü-Bereichs ist ein Zweitspielrecht unabhängig von den
Voraussetzungen von Nr. 5.1 zu erteilen, sofern der Stammverein in der Altersklasse des jeweiligen
Spielers keine Mannschaft gemeldet hat.
5.3 Die Spielerlaubnis für den Stammverein bleibt von der Erteilung eines Zweitspielrechts unberührt.
5.4 Der Antrag auf Erteilung eines Zweitspielrechts ist bis spätestens 15.4. eines Jahres einzureichen, um für
die laufende Spielzeit Berücksichtigung zu finden.
5.5 Das Zweitspielrecht wird auch mitgliedsverbandsübergreifend ermöglicht.
5.6 Hinsichtlich einer Verkürzung der Wartefrist gemäß § 17 Nr. 2.7 sind bei späteren Vereinswechseln
sämtliche Spiele sowohl beim Stamm- als auch beim Zweitverein zu berücksichtigen.
5.7 Mit der Abmeldung beim Stammverein erlischt automatisch das Zweitspielrecht des Spielers.
5.8 Mit dem Ziel einer weitergehenden Flexibilisierung und Öffnung des Zweitspielrechts können die
Mitgliedsverbände des DFB von den vorstehenden Bestimmungen (Nr. 5.1 bis 5.4) abweichende
Regelungen treffen. Regelungen der Mitgliedsverbände des DFB, die die allgemeinverbindlichen
Mindeststandards (Nr. 5.1 bis 5.4) unterschreiten, sind unbeachtlich.
§ 10a
Nachweis der Spielberechtigung
1. Nachweis der Spielberechtigung mittels DFBnet
1.1 Die Spielberechtigung wird grundsätzlich über das DFBnet nachgewiesen, wobei im DFBnet
1.1.1 Lichtbild
1.1.2 Name und Vorname(n)
1.1.3 Geburtstag
1.1.4 Beginn der Spielberechtigung, eventuell ihre Befristung
1.1.5 Registriernummer des Ausstellers
1.1.6 Name und FIFA-ID des Vereins
1.1.7 FIFA-ID
des Spielers hinterlegt sind.
1.2 Alternativ kann die Spielberechtigung in Form eines Ausdrucks aus der zentralen Passdatenbank des
DFBnet nachgewiesen werden, der ebenfalls die oben genannten Daten enthalten muss.
2. Nachweis der Spielberechtigung mittels Spielerpass
Sofern Landesverbände Spielerpässe ausstellen, kann der Nachweis der Spielberechtigung ersatzweise
anhand dieses Spielerpasses erfolgen.
Der Spielerpass muss mindestens folgende Erkennungsmerkmale und Daten des Inhabers enthalten:
2.1 Lichtbild
2.2 Name und Vorname(n)
2.3 Geburtstag
2.4 Eigenhändige Unterschrift
2.5 Beginn der Spielberechtigung, eventuell ihre Befristung
2.6 Registriernummer des Ausstellers
2.7 Name des Vereins und Vereinsstempel
Neben den Daten auf dem Spielerpass wird aufgrund der Internationalen Bestimmungen jedem Spieler
und jedem Verein eine FIFA-ID zugewiesen. Diese sind im DFBnet hinterlegt. Der Spielerpass ist
Eigentum des ausstellenden Verbandes. Der Verein ist zur sorgfältigen Aufbewahrung des Spielerpasses
verpflichtet.
3. Nachweis der Identität bei fehlendem Lichtbild.
Die Identität des Spielers soll bei einem fehlenden Lichtbild im DFBnet bzw. Spielerpass über einen
gültigen Lichtbildausweis nachgewiesen werden.Sie können auch lesen