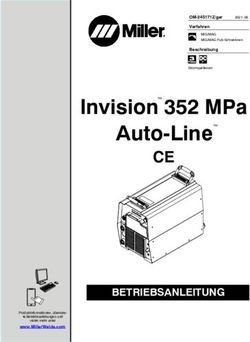ARTENSCHUTZRECHTLICHER FACHBEITRAG - Bebauungsplan Stadt Haigerloch Zollernalbkreis - Stadt ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Stadt Haigerloch
Zollernalbkreis
Bebauungsplan
„Hinter den Gärten ll“
in Haigerloch-Hart
ARTENSCHUTZRECHTLICHER FACHBEITRAG
Fassung vom 11.03.2021Bebauungsplan
„Hinter den Gärten ll“
in Haigerloch-Hart
Inhaltsübersicht
I. Einleitung und Rechtsgrundlagen....................................................................................................... 1
1. Untersuchungszeitraum und Methode..................................................................................................... 2
2. Rechtsgrundlagen.................................................................................................................................... 5
II. Beschreibung der vom Vorhaben betroffenen Biotop- und Habitatstrukturen................................6
1. Lage des Untersuchungsgebietes........................................................................................................... 6
2. Nutzung des Untersuchungsgebietes...................................................................................................... 7
3. Schutzgebiete im Bereich des Untersuchungsgebietes.........................................................................10
3.1. Ausgewiesene Schutzgebiete nach dem Naturschutzrecht...........................................................10
3.2. Ausgewiesene FFH-Lebensraumtypen außerhalb von FFH-Gebieten...........................................11
3.3. Biotopverbund................................................................................................................................ 12
3.4. Nach § 33a NatSchG geschützte Streuobstbestände....................................................................14
III. Vorhabensbedingte Betroffenheit von planungsrelevanten Arten..................................................15
1. Farn- und Blütenpflanzen (Pteridophyta et Spermatophyta)..................................................................17
2. Fledermäuse (Microchiroptera).............................................................................................................. 19
3. Vögel (Aves).......................................................................................................................................... 26
4. Reptilien (Reptilia)................................................................................................................................. 32
5. Wirbellose (Evertebrata)........................................................................................................................ 35
5.1. Käfer (Coleoptera)......................................................................................................................... 35
5.2. Hautflügler (Hymenoptera)............................................................................................................. 39
5.3. Schmetterlinge (Lepidoptera)......................................................................................................... 40
IV. Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung..................................................................................41
V. Zielartenkonzept des Landes Baden-Württemberg für Haigerloch.................................................45
VI. Literaturverzeichnis............................................................................................................................. 48Bebauungsplan
„Hinter den Gärten ll“
in Haigerloch-Hart
I. Einleitung und Rechtsgrundlagen
Anlass für den vorliegenden Artenschutzbeitrag ist die Aufstellung des Bebauungsplanes ‚Hinter den Gärten
ll‘ in Haigerloch-Hart im Zollernalbkreis.
Abb. 1: Übersichtskarte mit der Lage des Plangebietes (schwarz gestrichelt).
Durch die Planaufstellung könnten Eingriffe vorbe-
reitet werden, die auch zu Störungen oder Verlus-
ten von geschützten Arten nach § 7 Abs. 2
BNatSchG oder deren Lebensstätten führen kön-
nen. Die Überprüfung erfolgt anhand des vorliegen-
den artenschutzrechtlichen Fachbeitrages.
Nachdem mit der Neufassung des Bundesnatur-
schutzgesetzes (BNatSchG) vom Dezember 2007
das deutsche Artenschutzrecht an die europäi-
schen Vorgaben angepasst wurde, müssen bei al-
len genehmigungspflichtigen Planungsverfahren
und bei Zulassungsverfahren nunmehr die Arten-
Abb. 2: Ausschnitt aus dem Abgrenzungsplan mit dem
Geltungsbereich des Bebauungsplanes (schwarz schutzbelange entsprechend den europäischen Be-
gestrichelt)
stimmungen durch eine artenschutzrechtliche Prü-
fung berücksichtigt werden.
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Seite 1Bebauungsplan „Hinter den Gärten ll“ in Haigerloch-Hart 1. Untersuchungszeitraum und Methode Die artenschutzrechtlich relevanten Untersuchungen erfolgten zwischen dem 18.04.2019 und 15.09.2020 (Tab. 1). In der nachfolgenden Tabelle sind alle Begehungstermine innerhalb des Untersuchungsraumes aufgeführt, in denen das angetroffene Inventar an biotischen und abiotischen Strukturen auf eine mögliche Nutzung durch artenschutzrechtlich indizierte Spezies untersucht und die angetroffenen relevanten Arten dokumentiert wur- den. Neben der fortlaufenden Nummer sind die Erfassungszeiträume (Datum und Uhrzeit), der Bearbeiter und die Witterungsverhältnisse angegeben. Den Erfassungsterminen sind jeweils die abgehandelten The- men in Anlehnung an die arten- und naturschutzrechtlich relevanten Artengruppen und Schutzgüter zugeord- net. Die Angabe Übersichtsbegehung wird für eingehende Kartierungen gewählt, bei welchen eine Einschät- zung des Gebietes anhand der vorhandenen Habitatstrukturen hinsichtlich der Eignung als Lebensraum für Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie, für europäische Vogel- und Fledermausarten sowie für die nach dem Bundesnaturschutzgesetz besonders oder streng geschützten Arten erfolgt. Während der Begehungen im Untersuchungsraum wird zudem grundsätzlich immer auf Beibeobachtungen aller planungsrelevanter Ar- ten geachtet, wenngleich die Artengruppe in der Themenspalte nicht aufgelistet wird. Während der Begehungen wurde das vorhandene Inventar an biotischen und abiotischen Strukturen auf eine mögliche Nutzung durch artenschutzrechtlich indizierte Spezies untersucht und die vorgefundenen rele- vanten Arten dokumentiert. Innerhalb des Acker-, Grünland-, Streuobst- und Gebäudebestandes als Haup- teinheiten wurden Kleinstrukturen definiert, die als Habitate für Arten des Anhanges ll und IV der FFH-Richtli - nie, für europäische Vogel- und Fledermausarten sowie für die nach dem Bundesnaturschutzgesetz beson- ders oder streng geschützten Arten geeignet sein könnten. So wurden auch sämtliche Strukturen nach vorjährigen Neststandorten, nach Bruthöhlen, nach Rupfplätzen etc. abgesucht. Die Einstufung von Bäumen als Habitatbaum erfolgt in Anlehnung an die Definition des Alt- und Totholzkonzeptes Baden-Württemberg (z. B. Bäume mit Stammhöhlen, Stammverletzungen, mit hohem Alter oder starker Dimensionierung, stehendes Totholz mit BHD > 40 cm, Horstbäume). Im Vordergrund der Ermittlung von potenziellen Arten stand auch die Selektion des Zielartenkonzeptes des Landes Baden-Württemberg (ZAK). Diese erfolgt durch die Eingabe der kleinsten im Portal des ZAK vorge- gebenen Raumschaft in Verknüpfung mit den Angaben des Naturraumes und der im Gebiet vorkommenden Habitatstrukturen. Im Ergebnis lieferte das ZAK die zu berücksichtigenden Zielarten. Außer 16 europäischen Vogel- und 16 Fledermausarten standen nach der Auswertung des ZAK zunächst bei den Säugetieren die Haselmaus (Muscardinus avellanarius), bei den Reptilien die Zauneidechse (Lacerta agilis) sowie bei den Schmetterlingen der Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling (Maculinea nausithous), der Große Feuerfalter (Lycaena dispar) und der Nachtkerzenschwärmer (Proserpinus proserpina) im Vorder- grund. Von den Arten des Anhanges II der FFH-Richtlinie sollten nach dem ZAK der Hirschkäfer (Lucanus cervus) berücksichtigt werden. Die detaillierte Erfassungsmethode sowie die Ergebnisse der Kartierung sind in den jeweiligen nachfolgen - den Kapiteln zu den einzelnen Artengruppen vermerkt. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Seite 2
Bebauungsplan
„Hinter den Gärten ll“
in Haigerloch-Hart
Tab. 1: Begehungstermine im Untersuchungsgebiet
Nr. Datum Bearbeit Uhrzeit Wetter Thema
er
(1) 18.04.2019 Kohnle 12:40 - 13:50 Uhr 17 °C, sonnig, windig Übersichtsbegehung
(2) 09.05.2019 Kohnle 10:40 - 11:35 Uhr 9 °C, Regen, windig Prüfung Höhlenbäume
(3) 10.05.2019 Kohnle 07:30 - 08:25 Uhr 7,5 °C, 90 % bewölkt, windstill Prüfung Höhlenbäume
(4) 13.05.2019 Kohnle 22:30 - 23:00 Uhr 5 °C, klar, windstill F, V
(5) 04.12.2019 Kohnle 12:00 - 14:00 Uhr 1 °C, sonnig, windstill Prüfung Höhlenbäume
(6) 03.03.2020 Kohnle 19:10 - 20:10 Uhr 4 °C, 50 % bewölkt, windstill V (v. a. Steinkauz)
(7) 11.03.2020 Kohnle 08:00 - 09:00 Uhr 6 °C, 95 % bewölkt, schwach windig V (v. a. Grauspecht)
(8) 24.03.2020 Kohnle 08:00 - 08:45 Uhr -2 °C, sonnig, schwacher Wind V (v. a. Grauspecht)
(9) 27.03.2020 Kohnle 14:20 - 15:00 Uhr 13,5 °C, sonnig, schwacher Wind R, V
(10) 02.04.2020 Kohnle, 13:20 - 13:50 Uhr 12 °C, sonnig, windstill R
Reginka
(11) 15.04.2020 Kohnle, 12:30 - 13:20 Uhr 12 °C, sonnig, schwacher Wind R
Mezger
(12) 21.04.2020 Kohnle 07:10 - 08:10 Uhr 8,5 °C, 50 % bewölkt, schwache Böen V (v. a. Grauspecht)
(13) 23.04.2020 Kohnle 21:30 - 22:15 Uhr 12 °C, klar, windstill V (v. a. Steinkauz)
(14) 12.05.2020 Mezger 11:00 - 11:40 Uhr 7 °C, 60 % bewölkt, schwacher Wind R, V
(15) 27.05.2020 Kohnle 10:00 - 11:15 Uhr 16 °C, sonnig, windig R, V
(16) 09.06.2020 Kohnle 13:50 - 14:30 Uhr 11,5 °C, 100 % bewölkt, windstill P, R
(17) 12.06.2020 Mezger 08:00 - 08:55 Uhr 10,5 °C, 80 % bewölkt, windstill R, V
Mezger,
(18) 12.06.2020 21:40 - 22:40 Uhr 21,5 °C, klar, windstill F, V (Steinkauz)
Reinhardt
(19) 17.06.2020 Kohnle 04:30 - 05:20 Uhr 13 °C, 100 % bewölkt, windstill V (v. a. Kuckuck)
(20) 22.06.2020 Kohnle 21:00 - 22:35 Uhr 18,5 °C, klar, windstill F, V
(22) 29.06.2020 Kohnle, 21:15 - 22:30 Uhr 16,5 °C, klar, schwacher Wind F, V
Mezger
(23) 07.07.2020 Kohnle, 04:00 - 05:10 Uhr 7 °C, klar, windstill F, V
Mezger
22,5 °C, 50 % bewölkt, schwacher
(24) 09.07.2020 Kohnle 09:50 - 10:20 Uhr S
Wind
(25) 14.07.2020 Kohnle 04:25 - 05:15 Uhr 10,5 °C, klar, windstill F, V
(26) 15.09.2020 Kohnle 21:25 – 21:55 17,5 °C, klar, windstill F
Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen
Übersichtsbegehung: Erfassung aller angetroffenen artenschutzrechtlich relevanten Arten und Strukturen
F: Fledermäuse P: Pflanzen R: Reptilien S: Schmetterlinge V: Vögel
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Seite 3Bebauungsplan
„Hinter den Gärten ll“
in Haigerloch-Hart
Ergänzend zu den eigenen Erhebungen wird das landesweite Zielartenkonzept (ZAK) für Haigerloch im Na-
turraum ‚Obere Gäue‘ dargestellt und bei der Ergebnisfindung mit diskutiert. Als zutreffende Habitatstruktu-
ren wurden ausgewählt:
• D2.2.1 Grünland frisch und (mäßig) nährstoffreich (typische Glatthaferwiesen und
verwandte Typen),
• D2.2.2 Grünland frisch und nährstoffreich (Flora nutzungsbedingt gegenüber D2.2.1 deutlich ver-
armt),
• D3.2 Streuobstwiesen frisch und (mäßig) nährstoffreich (typische Glatthaferwiesen und verwandte
Typen),
• D4.1 Lehmäcker,
• D6.1.2 Gebüsche und Hecken mittlerer Standorte,
• F1 Außenfassaden, Keller, Dächer, Schornsteine, Dachböden, Ställe, Hohlräume, Fensterläden
oder Spalten im Bauwerk mit Zugänglichkeit für Tierarten von außen; ohne dauerhaft vom
Menschen bewohnte Räume.
Im Zielartenkonzept für diese Auswahl sind 37 (38) Tierarten aus 4 (5) Artengruppen aufgeführt. Die zu be-
rücksichtigenden Arten nach dem Zielartenkonzept des Landes Baden-Württemberg (ZAK) sind in Tabelle 14
im Anhang dieses Gutachtens dargestellt. Die Angaben in Klammer schließen den Hirschkäfer aus dem An-
hang II der FFH-Richtlinie mit ein, welcher in jener Tabelle nicht mit aufgeführt ist.
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Seite 4Bebauungsplan
„Hinter den Gärten ll“
in Haigerloch-Hart
2. Rechtsgrundlagen
Die rechtliche Grundlage für den vorliegenden Artenschutzbeitrag bildet der artenschutzrechtliche Verbotstat-
bestand des § 44 Abs. 1 BNatSchG der folgendermaßen gefasst ist:
"Es ist verboten,
• wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten, nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre
Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,
• wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Auf-
zucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn
sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,
• Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten der Natur zu entnehmen,
zu beschädigen oder zu zerstören,
• wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen,
sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören."
Die Verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG werden um den Absatz 5 ergänzt, mit dem bestehende und von
der Europäischen Kommission anerkannte Spielräume bei der Auslegung der artenschutzrechtlichen Vor-
schriften der FFH-Richtlinie genutzt und rechtlich abgesichert werden sollen, um akzeptable und im Vollzug
praktikable Ergebnisse bei der Anwendung der Verbotsbestimmungen des Absatzes 1 zu erzielen. Danach
gelten für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im Sinne des
§ 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind, folgende Bestimmun-
gen:
1. Sind in Anhang IVa der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten oder europäische Vogelarten betroffen, liegt ein
Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 (Schädigungsverbot) nicht vor, wenn die Beeinträchtigung durch
den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signi-
fikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen
nicht vermieden werden kann. Weiterhin liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 (Störungsverbot)
nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ru -
hestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt bleibt. Die ökologische Funktion kann vorab durch vorge-
zogene Ausgleichsmaßnahmen (so genannte CEF-Maßnahmen) gesichert werden. Entsprechendes gilt für Stand-
orte wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten.
2. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eing riffs oder Vor-
habens ein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- / Vermarktungsverbote nicht vor. Die artenschutzrechtlichen Verbote
bei nach § 15 zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu-
lässigen Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten somit nur für die in Anhang IV der FFH-RL aufgeführ-
ten Tier- und Pflanzenarten sowie europäischen Vogelarten.
Bei den nur nach nationalem Recht geschützten Arten ist durch die Änderung des NatSchG eine Vereinfa-
chung der Regelungen eingetreten. Eine artenschutzrechtliche Prüfung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist für
diese Arten nicht erforderlich. Die Artenschutzbelange müssen insoweit im Rahmen der naturschutzrechtli-
chen Eingriffsregelung (Schutzgut Tiere und Pflanzen) über die Stufenfolge von Vermeidung, Minimierung
und funktionsbezogener Ausgleich behandelt werden. Werden Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m.
Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten erfüllt, müssen die Ausnahmevor-
aussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sein.
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Seite 5Bebauungsplan „Hinter den Gärten ll“ in Haigerloch-Hart II. Beschreibung der vom Vorhaben betroffenen Biotop- und Habitatstrukturen 1. Lage des Untersuchungsgebietes Das Untersuchungsgebiet befindet sich auf ca. 480 m ü. NHN am nordöstlichen Ortsrand des Haigerlocher Stadtteiles Hart. Im Westen grenzt es an die bestehende Bebauungsgrenze an. Nach Norden, Süden und Osten hin öffnet es sich in die freie Landschaft mit Acker-, Grünland- und Streuobstbeständen. Im Norden und Süden des Gebietes verläuft jeweils ein direkt angrenzender Feldweg. Abb. 3: Ausschnitt aus der topografischen Karte (Plangebiet schwarz gestrichelt) (Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19). Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Seite 6
Bebauungsplan „Hinter den Gärten ll“ in Haigerloch-Hart 2. Nutzung des Untersuchungsgebietes Das Plangebiet gliedert sich in die Nutzungstypen ‚Acker‘, ‚Streuobstbestand mit Wiesen- und Weidebewirt - schaftung‘ sowie ‚Gebäudebestand‘. Der mit Sommergetreide (2019) und einer einjährigen Blühmischung (2020) eingesäte Acker nimmt einen Großteil des Untersuchungsgebietes im Osten ein. Westlich dieses Ackers befindet sich eine ausgedehnte Streuobstwiese. Der Unterwuchs ist relativ artenarm und starkwüchsig und wird von Löwenzahn, Wiesen- fuchsschwanz, Wiesen-Rispengras, Goldhahnenfuß, Zaunwicke, Spitzwegerich sowie vereinzelt Ruchgras und Schnittlauch aufgebaut. Im Süden des Gebietes befindet sich eine vergleichbar aufgebaute Fettwiese sowie eine Fettweide mit noch artenärmerer Zusammensetzung der Vegetation. Beide sind mit Obstbäumen bestanden. Der Fettweidenbestand im Süden weist kleinflächig auch ausgemagerte Bereiche auf, wo ver- mehrt Feld-Hainsimse (Luzula campestris), Bach-Nelkenwurz (Geum rivale) und Knolliger Hahnenfuß (Ra- nunculus bulbosus) vorkommen. Bei dem Streuobstbestand handelt sich v. a. um Apfel- und Birnbäume; nur ganz vereinzelt sind Zwetschgen eingestreut. Die Stammdurchmesser bewegen sich v. a. im Bereich zwischen 40 und 60 cm in Brusthöhe. Drei Birnbäume im Südwesten und Südosten des Gebietes heben sich allerdings mit Stammdurchmessern zwischen 80 und 100 cm besonders hervor. Relativ zentral im Plangebiet ist ein niedriges Gebüsch aus Hartriegel und Rosensträuchern aufgewachsen. Im Nordwesten des Gebietes steht eine Scheune, welche u. a. zur Lagerung von Holz verwendet wird. Abb. 4. Mit Sommergetreide eingesäter Acker im Osten des Geltungsbereiches (Jahr 2019) Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Seite 7
Bebauungsplan „Hinter den Gärten ll“ in Haigerloch-Hart Abb. 5. Streuobstbestand und Scheune im Nordwesten des Geltungsbereiches Abb. 6. Bestand der Fettwiese, es dominieren Löwenzahn, Wiesenfuchsschwanz und Gold-Hahnenfuß Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Seite 8
Bebauungsplan „Hinter den Gärten ll“ in Haigerloch-Hart Abb. 7: Südwestlicher Teil des Plangebietes mit Streuobstbestand über Fettwiese und Fettweide; zentral im Bild zwei Birnbäume mit Stammdurchmessern von ca. 80 und 90 cm (Pfeile) Abb. 8: Südöstlicher Teil des Plangebietes; links im Bild ein Birnbaum mit ca. 1 m Stammdurchmesser Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Seite 9
Bebauungsplan
„Hinter den Gärten ll“
in Haigerloch-Hart
3. Schutzgebiete im Bereich des Untersuchungsgebietes
3.1. Ausgewiesene Schutzgebiete nach dem Naturschutzrecht
4
2
6
1
7
3 5
Abb. 9: Orthofoto des Planungsraumes mit Eintragung der Schutzgebiete in der Umgebung
(Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19).
Tab. 2: Schutzgebiete in der Umgebung des Geltungsbereiches
Lfd. Nr. Biot.-Nr. Bezeichnung Lage
(1) 1-7619-417-8192 Offenlandbiotop: Uferschilfröhrichte im Gewann Brühläcker östlich von Hart 140 m S
(2) 1-7619-417-0564 Offenlandbiotop: Gehölze nordöstlich Hart 330 m O
(3) 176194170544 Offenlandbiotop: Salenhofweiher und östlich angrenzende Feuchtflächen 940 m SW
(4) 1-7619-417-0563 Offenlandbiotop: Doline nordöstlich Hart 580 m NO
(5) 1-7619-417-8197 Waldbiotop: Feldhecke im Gewann Ziegeläcker östlich von Hart 680 m SO
(6) 84170250106 Naturdenkmal: 1 Linde, 1 Eiche, 2 Ahorn, 1 Esche 440 m SW
(7) 84170250027 Naturdenkmal: Salenwiesen 870 m SW
Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen
Lage : kürzeste Entfernung vom Mittelpunkt des Geltungsbereiches zum Schutzgebiet mit der entsprechenden Richtung
Innerhalb des Geltungsbereiches bestehen keine Schutzgebiete. Das nächst gelegene ist ein Offenlandbio -
top in 140 m in südlicher Richtung. Es wird konstatiert, dass vom Vorhaben keine erheblichen negativen Aus-
wirkungen auf die Schutzgebiete und ihre Inventare in der Umgebung ausgehen.
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Seite 10Bebauungsplan
„Hinter den Gärten ll“
in Haigerloch-Hart
3.2. Ausgewiesene FFH-Lebensraumtypen außerhalb von FFH-Gebieten
1 2
3
Abb. 10: Orthofoto mit Eintragung der Mageren Flachland-Mähwiesen (gelbe Flächen) in der Umgebung
(Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19).
Tab. 3: Magere Flachland-Mähwiesen (FFH LRT 6510) in der Umgebung des Geltungsbereiches
Lfd. Nr. Biot.-Nr. Bezeichnung Lage
(1) 65108-000-46054614 Glatthafer-Wiese nordöstlich von Hart angrenzend
(2) 65108-000-46054613 Glatthafer-Wiese nordöstlich von Hart 150 m NO
(3) 65108-000-46054668 Glatthafer-Wiese östlich von Hart 190 m SO
Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen
Lage : kürzeste Entfernung vom Mittelpunkt des Geltungsbereiches zum Schutzgebiet mit der entsprechenden Richtung
Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine ausgewiesenen FFH-Lebensraumtypen. Die nächst
gelegene Magere Flachland-Mähwiese grenzt direkt in nordwestlicher Richtung an. Vom Vorhaben gehen
keine erheblichen negativen Wirkungen auf die FFH-Lebensraumtypen und deren Inventare in der Umge-
bung aus.
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Seite 11Bebauungsplan „Hinter den Gärten ll“ in Haigerloch-Hart 3.3. Biotopverbund Der Fachplan „Landesweiter Biotopverbund‟ versteht sich als Planungs- und Abwägungsgrundlage, die ent- sprechend dem Kabinettsbeschluss vom 24.04.2012 bei raumwirksamen Vorhaben in geeigneter Weise zu berücksichtigen ist. Die Biotopverbundplanung ist auf der Ebene der kommunalen Bauleitplanung eine Ar- beits- und Beurteilungsgrundlage zur diesbezüglichen Standortbewertung und Alternativen-Prüfung sowie bei der Ausweisung von Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen-Flächen. Der Fachplan „Landesweiter Biotopverbund‟ stellt im Offenland drei Anspruchstypen dar – Offenland trocke- ner, mittlerer und feuchter Standorte. Innerhalb dieser wird wiederum zwischen Kernflächen, Kernräumen und Suchräumen unterschieden. Kernbereiche werden als Flächen definiert, die aufgrund ihrer Bioto - pausstattung und Eigenschaften eine dauerhafte Sicherung standorttypischer Arten, Lebensräume und Le- bensgemeinschaften ermöglichen können. Die Suchräume werden als Verbindungselemente zwischen den Kernflächen verstanden, über welche die Ausbreitung und Wechselwirkung untereinander gesichert werden soll. Abb. 11: Biotopverbund (farbige Flächen) in der Umgebung des Geltungsbereiches (schwarz gestrichelte Linie) Der Geltungsbereich tangiert zwei Kernflächen innerhalb eines Kernraumes des ‚Biotopverbundes mittlerer Standorte‘. Bei diesen Kernflächen handelt es sich um Streuobstbestände, welche vollständig beansprucht (überbaut) werden. Bei den betroffenen Anteilen des Kernraumes handelt es sich um eine Ackerfläche sowie ebenfalls um Streuobstwiesen. Die innerhalb der Kernflächen und des Kernraumes befindlichen Streuobstbestände enthalten zahlreiche Ha- bitatbäume. Diese stellen ein Brut- und Nahrungshabitat für die Avifauna mit z. T. streng geschützten Arten dar, sowie ein Quartier- und Jagdhabitat mit Leitstrukturen in Ost-West- und Nord-Südrichtung für Fleder- mäuse. Mit dem Streuobstbestand verschwindet ein wichtiges verbindendes Element des Streuobstgürtels um Hart. Kernflächen des Biotopverbundes sind potenzieller Lebensraum für standorttypische Arten, zu de- nen beispielsweise die Zauneidechse zählt, die im Gebiet auch nachgewiesen wurde. Es handelt sich hierbei Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Seite 12
Bebauungsplan „Hinter den Gärten ll“ in Haigerloch-Hart um eine wenig mobile Art, die bei Habitatverlust nicht ohne Weiteres entfernte Lebensräume aufsuchen kann. Ein Ausgleich des Zauneidechsenhabitates erfolgt als CEF-Maßnahme auf den Flurstücken Nr. 267/268 und 4633. Im Landschaftsplan zum FNP Haigerloch 2025 wird angeregt, dass Eingriffe in den Streuobstbestand 1:1 ausgeglichen werden müssen. Der § 33a NatschG schreibt nun Neupflanzungen im Verhältnis 1:1 vor. Er- folgt die Anlage sinnvoll im Verbund mit bereits vorhandenen Streuobstflächen um Hart, entstehen mittel- bis langfristig wieder neue Biotopverbundflächen in der Raumschaft. Die Neupflanzungen sind direkt östlich des Plangebietes vorgesehen. Durch Großbaumverpflanzung der wertvollsten Habitatbäume aus dem Eingriffs- bereich in diese Ausgleichsflächen hinein kann der zeitweilige Verlust an Biotopverbundfläche an Ort und Stelle abgemildert werden, indem hierdurch kurzfristig ein verbindendes Element aus erwachsenen Bäumen in Nord-Süd-Richtung geschaffen wird. Zudem erfolgt die Erschließung in zwei Bauabschnitten. Dabei wird der Großteil des bestehenden Streuobstbestandes für die nächsten 5 Jahre erhalten bevor dann frühestens der 2. Bauabschnitt realisiert wird. So können die neu gepflanzten Bäume bereits eine gewisse Wertigkeit er- reichen. Unabhängig von diesem Verfahren wird angemerkt, dass gemäß des neuen §22 im NatSchG für die Gemeinden über die Berücksichtigung des Biotopverbundes in Planungsangelegenheiten hinaus eine Ver- pflichtung besteht, eigene Biotopverbundpläne zu erstellen und die im Fachplan Landesweiter Biotopverbund dargestellten Elemente „durch Biotopgestaltungsmaßnahmen und durch Kompensationsmaßnahmen mit dem Ziel zu ergänzen, den funktionalen Biotopverbund zu stärken“. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Seite 13
Bebauungsplan „Hinter den Gärten ll“ in Haigerloch-Hart 3.4. Nach § 33a NatSchG geschützte Streuobstbestände Nach dem Naturschutzgesetz sind Streuobstflächen, die eine Mindestfläche von 1500 m² umfassen, zu er- halten. Mit Genehmigung können solche Bestände in eine andere Nutzungsart umgewandelt werden. Die Genehmigung soll jedoch versagt werden, wenn die Erhaltung des Streuobstbestandes im überwiegenden öffentlichen Interesse liegt, insbesondere wenn der Streuobstbestand für die Leistungsfähigkeit des Natur - haushalts oder für den Erhalt der Artenvielfalt von wesentlicher Bedeutung ist. Eine Umwandlung eines Streuobstbestandes in eine andere Nutzungsform erfordert einen Ausgleich, welcher vorrangig durch eine Neupflanzung innerhalb einer angemessenen Frist erfolgen muss. Die Streuobstfläche im Plangebiet beträgt exakt 8848 m². Somit wird für deren Umwandlung eine Genehmi- gung benötigt. Diese ist an einen 1:1-Ausgleich der beanspruchten Fläche gebunden. Dabei ist es sinnvoll, die Flächen für die Neupflanzung so zu wählen, dass bestehende Teile des Streuobstgürtels um Hart neu verbunden werden bzw. verstärkt werden. Die Untere Naturschutzbehörde geht bei ihrer Vermessung des Bestandes von rund 0,88 ha Streuobstfläche aus und fordert einen Ausgleich von 1:2 um zusätzlich auch der Bedeutung als Jagdhabitat für Fledermäuse Rechnung zu tragen. Aufgrund der Bedeutung des Streuobstbestandes als Jagdhabitat für Fledermäuse wird ein Ausgleich von 1:2 notwendig. Abb. 12: Luftbild mit Darstellung des vom Eingriff betroffenen Streuobstbestandes (rote Linie) Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Seite 14
Bebauungsplan
„Hinter den Gärten ll“
in Haigerloch-Hart
III. Vorhabensbedingte Betroffenheit von planungsrelevanten Arten
Im Nachfolgenden wird dargestellt, inwiefern durch das geplante Vorhaben planungsrelevante Artengruppen
betroffen sind. Bezüglich der streng geschützten Arten, der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie sowie
den europäischen Vogelarten (= planungsrelevante Arten) ergeben sich aus § 44 Abs.1 Nr. 1 bis 3 i.V.m.
Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote:
Schädigungsverbot:
Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit verbundene vermeidbare
Verletzung oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen.
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vor -
haben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird.
Störungsverbot:
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wan-
derungszeiten.
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs -
zustandes der lokalen Population führt.
Tab. 4: Durch das Vorhaben potenziell betroffene Artengruppen und die Eignung des Gebietes als Habitat
Arten / Artengruppe Habitateignung § gesetzlicher Schutzstatus
Farn- und potenziell geeignet – Das Vorkommen von planungsrelevan- besonders / streng geschützt,
Blütenpflanzen ten Farn- und Blütenpflanzen war nicht grundsätzlich auszu- Anhang IV FFH-RL
schließen. Der Untersuchungsraum liegt innerhalb des Haupt-
verbreitungsgebietes der Dicken Trespe (Bromus grossus)
und Bestände von der Art in der weiteren Umgebung sind be-
kannt. Die Ackerflora im Gebiet wurde erfasst.
➢ Es erfolgt eine nachfolgende Darstellung der Er-
gebnisse (Kap. III.1).
Säugetiere potenziell geeignet – Eine potenzielle Nutzung durch Fleder- besonders / streng geschützt,
(inkl. Fledermäuse) mäuse als Jagdhabitat, Leitstruktur und Quartier war gegeben. Anhang IV und II FFH-RL
Begehungen mit Ultraschall- und Aufzeichnungsgerät wurden
vorgenommen.
➢ Es erfolgt eine nachfolgende Darstellung der Er-
gebnisse (Kap. III.2).
nicht geeignet – Ein Vorkommen der im ZAK aufgeführten
Haselmaus (Muscardinus avellanarius) kann im Plangebiet
ausgeschlossen werden. Die Art benötigt als Lebensraum
dichte Hecken und Gebüsche in gutem Verbund, mit einem
hohen Anteil an früchtetragenden Gehölzarten. Im Geltungs-
bereich kommt lediglich ein kleinflächiges Hartriegelgebüsch
vor, welches nicht an größere Heckenstrukturen angebunden
ist. Auch Streuobstbestände werden gelegentlich von der Art
genutzt. Der Streuobstbestand im Plangebiet ist jedoch von
weiteren Streuobstwiesen durch Wege bzw. dazwischen lie-
gende Freiflächen abgetrennt.
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Seite 15Bebauungsplan
„Hinter den Gärten ll“
in Haigerloch-Hart
Tab. 4: Durch das Vorhaben potenziell betroffene Artengruppen und die Eignung des Gebietes als Habitat
Arten / Artengruppe Habitateignung § gesetzlicher Schutzstatus
Säugetiere Zudem stehen die Bäume überwiegend so locker, dass eine besonders / streng geschützt,
(inkl. Fledermäuse) Fortbewegung für die Haselmaus in der Kronenschicht nicht Anhang IV und II FFH-RL
durchgehend möglich ist.
➢ Es erfolgt keine weitere Prüfung.
Vögel geeignet – Es stehen potenzielle und tatsächlich genutzte alle Vögel mind. besonders
Nistgelegenheiten für Höhlenbrüter, Zweigbrüter, Nischenbrü- geschützt, VS-RL, BArtSchV
ter sowie für wenig störungsempfindliche Bodenbrüter zur Ver-
fügung.
➢ Es erfolgt eine nachfolgende Darstellung der Un-
tersuchungsergebnisse (Kap. III.3).
Reptilien potenziell geeignet – Planungsrelevante Reptilienarten konn- besonders / streng geschützt,
ten in Teilen des Plangebietes erwartet werden. Anhang IV FFH-RL
Die im ZAK aufgeführte Zauneidechse (Lacerta agilis) wurde
mithilfe künstlicher Verstecke und per Sichtbeobachtung nach-
gesucht.
➢ Es erfolgt eine nachfolgende Darstellung der Un-
tersuchungsergebnisse (Kap. III.4).
Amphibien nicht geeignet – Das Vorkommen von planungsrelevanten besonders / streng geschützt,
Amphibienarten kann aufgrund fehlender Biotopeigenschaften Anhang IV FFH-RL
(keine Laichgewässer, keine geeigneten Überwinterungsplät-
ze) ausgeschlossen werden.
➢ Es erfolgt keine weitere Prüfung.
Wirbellose nicht / ggf. geeignet – Ein Auftreten der vom ZAK genannten besonders / streng geschützt,
Falterarten Großer Feuerfalter (Lycaena dispar), Dunkler Wie- Anhang IV FFH-RL
senknopf-Ameisen-Bläuling (Maculinea nausithous) und
Nachtkerzenschwärmer (Proserpinus proserpina) im Plange-
biet wird ausgeschlossen. Es kommen keine nennenswerten
Bestände der von diesen Arten benötigten Fraßpflanzen
(nicht-saure Ampfer-Arten, Großer Wiesenknopf, Nachtkerzen-
und Weidenröschenarten) im Gebiet vor und zudem sind auch
nicht die entsprechenden Biotoptypen vorhanden (Frischwie-
sen, Wiesen- oder Ackerbrachen, trockene und feuchte Stau-
denfluren). Auf Vorkommen besonders geschützter Vertreter
der Artengruppe wurde geachtet.
➢ Es erfolgt eine nachfolgende Darstellung der Er-
gebnisse (Kap. III.5.3).
potenziell geeignet – Ein Vorkommen des Hirschkäfers im
Plangebiet kann ausgehend von den vorhandenen Biotop-
strukturen nicht völlig ausgeschlossen werden.
➢ Es erfolgt eine nachfolgende Diskussion
(Kap. III.5.2).
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Seite 16Bebauungsplan
„Hinter den Gärten ll“
in Haigerloch-Hart
1. Farn- und Blütenpflanzen (Pteridophyta et Spermatophyta)
Ein Vorkommen von planungsrelevanten Arten dieser Gruppe im Wirkungsbereich wird aufgrund der Lage
des Planungsraumes außerhalb des Verbreitungsgebietes der Art (V) und aufgrund nicht vorhandener Le-
bensraumstrukturen für ein Habitat der Art im Planungsraum (H) abgeschichtet.
Der Status der Dicken Trespe (Bromus grossus) (gelb hinterlegt) wird überprüft.
Tab. 5: Abschichtung der Farn- und Blütenpflanzen des Anhanges IV der FFH-Richtlinie nach dem Verbreitungsgebiet
und den Habitat-Eigenschaften (ggf. mit Angabe zum Erhaltungszustand) 1
Eigenschaft Erhaltungszustand
Deutscher Name Wissenschaftliche Bezeichnung
V H 1 2 3 4 5
! ? Dicke Trespe Bromus grossus + - - - -
X X Frauenschuh Cypripedium calceolus - - + + -
X X Sumpf-Siegwurz Gladiolus palustris + + + + +
X X Sand-Silberscharte Jurinea cyanoides - + - - -
X X Liegendes Büchsenkraut Lindernia procumbens - ? - - -
X X Sumpf-Glanzkraut Liparis loeselii + + - - -
X X Kleefarn Marsilea quadrifolia - - - - -
X X Bodensee-Vergissmeinnicht Myosotis rehsteineri + + + + +
X X Biegsames Nixenkraut Najas flexilis ? ? ? ? ?
X X Sommer-Schraubenstendel Spiranthes aestivalis + + + + +
X X Europäischer Dünnfarn Trichomanes speciosum + + + + +
Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen
V mit [ X ] markiert: Plangebiet liegt außerhalb des Verbreitungsgebietes der Art.
H mit [ X ] markiert: Habitat-Eigenschaften für ein Artvorkommen fehlen im Wirkungsbereich des Plangebietes.
[!] Vorkommen nicht auszuschließen; [ ? ] Überprüfung erforderlich
LUBW: Die Einstufung erfolgt über ein Ampel-Schema, wobei „grün“ [ + ] einen günstigen, „gelb“ [ - ] einen ungünstig-unzureichenden und „rot“ [ - ] einen
ungünstig-schlechten Erhaltungszustand widerspiegeln. Lässt die Datenlage keine genaue Bewertung eines Parameters zu, wird dieser als unbekannt
(grau) [ ? ] eingestuft. Die Gesamtbewertung, also die Zusammenführung der vier Parameter, erfolgt nach einem festen Schema. Beispielsweise ist der
Erhaltungszustand als ungünstig-schlecht einzustufen, sobald einer der vier Parameter mit „rot“ bewertet wird.
1 Verbreitung 2 Population 3 Habitat
4 Zukunft 5 Gesamtbewertung (mit größerer Farbsättigung)
Der Geltungsbereich befindet sich innerhalb des südwestdeutschen Hauptverbreitungsgebietes der Dicken
Trespe (Bromus grossus). Die Art beansprucht grundsätzlich einen ‚extensiven‘ Feldfruchtanbau, bei wel-
chem zunächst auf eine tiefe Bodenbearbeitung (z.B. Schälpflügen) zugunsten einer flachgründigen Stoppel-
bearbeitung (z.B. durch Scheibeneggen) verzichtet wird. Darüber hinaus sollte der Dünger- und Herbizidein -
satz vor allem in den Randlagen dosiert werden bzw. nur bei Ausfall-Gefahren angewandt werden. Als
Fruchtanbau ist vor allem Wintergetreide geeignet und innerhalb diesem bevorzugt der Dinkelanbau, da die-
ser Anbau-Zyklus dem biologischen Zyklus von Bromus grossus am nächsten kommt.
Im Untersuchungszeitraum wurde die Ackerfläche mit Sommergetreide sowie einer einjährigen Blühmi-
schung bewirtschaftet. Es erfolgte Mitte Juni 2020 eine Nachsuche der Dicken Trespe auf dem Acker im Os-
ten des Plangebietes. Die Art wurde nicht festgestellt, dafür eine Vielzahl anderer Ackerbeikräuter, v. a. da
der südliche Teil des Ackers noch mit Stoppeln brach lag. Die Arten sind in Tab. 6 dargestellt.
1 gemäß: LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.) (2013): FFH-Arten in Baden
Württemberg – Erhaltungszustand 2013 der Arten in Baden-Württemberg.
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Seite 17Bebauungsplan
„Hinter den Gärten ll“
in Haigerloch-Hart
Der als Einzelexemplar festgestellte Acker-Hahnenfuß (Abb. 14) gilt in Baden-Württemberg als gefährdet
(Rote Liste BaWü: 3).
Tab. 6: Festgestellte Ackerbeikräuter im Plangebiet
Name wissenschaftlich Name deutsch Name wissenschaftlich Name deutsch
Alopecurus myosuroides Acker-Fuchsschwanz Myosotis arvensis Acker-Vergissmeinnicht
Anagallis arvensis Acker-Gauchheil Papaver rhoeas Klatschmohn
Centaurea cyanus Kornblume Polygonum aviculare Vogelknöterich
Chenopodium album Weißer Gänsefuß Polygonum maculosa Floh-Knöterich
Convolvulus arvensis Ackerwinde Ranunculus arvensis Acker-Hahnenfuß
Elymus repens Kriechende Quecke Rumex crispus Krauser Ampfer
Equisetum arvense Ackerschachtelhalm Sonchus asper Raue Gänsedistel
Euphorbia helioscopia Sonnwend-Wolfsmilch Sonchus oleraceus Kohl-Gänsedistel
Euphorbia peplus Garten-Wolfsmilch Thlaspi arvense Acker-Hellerkraut
Fumaria officinalis Gewöhnlicher Erdrauch Tripleurospermum inodorum Geruchlose Kamille
Geranium dissectum Schlitzblättr. Storchschnabel Veronica arvensis Feld-Ehrenpreis
Lactuca serriola Kompass-Lattich Vicia tetrasperma Viersamige Wicke
Abb. 13; Stoppelacker im Süden des Plangebietes mit reichhaltiger Beikrautflora
✔ Aufgrund des Vergleichs der artspezifi-
schen Habitatansprüche mit den Gegeben-
heiten vor Ort sowie aufgrund der Untersu-
chungsergebnisse wird ein Vorkommen
der indizierten Arten ausgeschlossen. Da-
mit wird auch ein Verstoß gegen die Ver-
botstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und
1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG und § 44 Abs. 1
Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ausgeschlos-
sen.
Abb. 14: Acker-Hahnenfuß
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Seite 18Bebauungsplan
„Hinter den Gärten ll“
in Haigerloch-Hart
2. Fledermäuse (Microchiroptera)
Die nachfolgenden Nennungen der Fledermausarten für den Bereich des Messtischblattes 7619 (NW) stam-
men entweder aus der Dokumentation der LUBW, Ref. 25 – Arten- und Flächenschutz, Landschaftspflege
oder sind dem Zielartenkonzept (ZAK) entnommen.
Wie in Tab. 7 dargestellt, liegen der LUBW für das Messtischblatt-Viertel jüngere Nachweise (l) von 12 Fle-
dermausarten vor. Die Artnachweise in den Nachbarquadranten sind mit "NQ" dargestellt, die aus dem ZAK
stammenden Arten sind mit "ZAK" angegeben. Datieren die Meldungen aus dem Berichtszeitraum vor dem
Jahr 2000, so ist zusätzlich "1990-2000" vermerkt.
Tab. 7: Die Fledermausarten Baden-Württembergs mit der Einschätzung eines potenziellen Vorkommens im Untersu-
chungsraum sowie der im ZAK aufgeführten Spezies (Quadranten der TK 1:25.000 Blatt 7619 NW) mit den An-
gaben zum Erhaltungszustand. 2
Deutscher Name Wissenschaftliche Vorkommen3 4 bzw. Rote Liste FFH- Erhaltungszustand
Bezeichnung Nachweis B-W 1) Anhang
1 2 3 4 5
Mopsfledermaus Barbastella barbastellus l / ZAK 1 II / IV - - - - -
Nordfledermaus Eptesicus nilssonii ZAK 2 IV + ? ? ? ?
Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus l / ZAK 2 IV + ? ? + ?
Nymphenfledermaus Myotis alcathoe NQ k.A. IV - - - - -
Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii l / ZAK 2 II / IV + + - - -
Wasserfledermaus Myotis daubentonii l / ZAK 3 IV + + + + +
Großes Mausohr Myotis myotis l / ZAK 2 II / IV + + + + +
Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus l / ZAK 3 IV + + + + +
Fransenfledermaus Myotis nattereri l / ZAK 2 IV + + + + +
Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri l / ZAK 2 IV + ? - - -
Großer Abendsegler Nyctalus noctula l / ZAK i IV + - + ? -
Rauhhautfledermaus Pipistrellus nathusii l / ZAK i IV + + + + +
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus l / ZAK 3 IV + + + + +
Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus NQ (1990-2000) / ZAK G IV + ? + + +
Braunes Langohr Plecotus auritus l / ZAK 3 IV + + + + +
Graues Langohr Plecotus austriacus NQ / ZAK G IV + ? - - -
Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus NQ (1990-2000) / ZAK i IV + ? ? ? ?
Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen
1): BRAUN ET AL. (2003): Rote Liste der gefährdeten Säugetiere in Baden-Württemberg. In: BRAUN, M. & F. DIETERLEIN (Hrsg.) (2003): Die
Säugetiere Baden-Württembergs, Band 1.
1: vom Aussterben bedroht 2: stark gefährdet 3: gefährdet
G: Gefährdung unbekannten Ausmaßes i: gefährdete wandernde Tierart
FFH-Anhang IV: Art nach Anhang IV der FFH-Richtlinie FFH-Anhang II / IV: Art nach Anhang II und IV der FFH-Richtlinie
BNatSchG §§: streng geschützte Art nach dem Bundesnaturschutzgesetz.
2 gemäß: LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.) (2013): FFH-Arten in Baden
Württemberg – Erhaltungszustand 2013 der Arten in Baden-Württemberg.
3 gemäß LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg - Geodaten für die Artengruppe der
Fledermäuse; Ref. 25 – Arten- und Flächenschutz, Landschaftspflege; Stand 01.03.2013
4 BRAUN & DIETERLEN (2003): Die Säugetiere Baden-Württembergs, Band I, Allgemeiner Teil Fledermäuse (Chiroptera). Eugen Ulmer
GmbH & Co., Stuttgart, Deutschland.
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Seite 19Bebauungsplan
„Hinter den Gärten ll“
in Haigerloch-Hart
Tab. 7: Die Fledermausarten Baden-Württembergs mit der Einschätzung eines potenziellen Vorkommens im Untersu-
chungsraum sowie der im ZAK aufgeführten Spezies (Quadranten der TK 1:25.000 Blatt 7619 NW) mit den An-
gaben zum Erhaltungszustand.
Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen
LUBW: Die Einstufung erfolgt über ein Ampel-Schema, wobei „grün“ [ + ] einen günstigen, „gelb“ [ - ] einen ungünstig-unzureichenden und „rot“ [ - ] einen
ungünstig-schlechten Erhaltungszustand widerspiegeln. Lässt die Datenlage keine genaue Bewertung eines Parameters zu, wird dieser als unbekannt
(grau) [ ? ] eingestuft. Die Gesamtbewertung, also die Zusammenführung der vier Parameter, erfolgt nach einem festen Schema. Beispielsweise ist der
Erhaltungszustand als ungünstig-schlecht einzustufen, sobald einer der vier Parameter mit „rot“ bewertet wird.
1 Verbreitung 2 Population 3 Habitat
4 Zukunft 5 Gesamtbewertung (mit größerer Farbsättigung)
Untersuchungen zur lokalen Gemeinschaft von Fledermäusen innerhalb eines Untersuchungsraumes kön-
nen grundsätzlich nur im aktiven Zyklus der Arten vorgenommen werden. Dieser umfasst den Zeitraum von
(März -) April bis Oktober (- November) eines Jahres. Außerhalb diesem herrscht bei den mitteleuropäischen
Arten die Winterruhe.
Die aktiven Phasen gliedern sich in den Frühjahrszug vom Winterquartier zum Jahreslebensraum im
(März-) April bis Mai. Diese mündet in die Wochenstubenzeit zwischen Mai und August. Die abschließende
Phase mit der Fortpflanzungszeit endet mit dem Herbstzug in die Winterquartiere im Oktober (- November).
Diese verschiedenen Lebensphasen können allesamt innerhalb eines größeren Untersuchungsgebietes statt
finden oder artspezifisch unterschiedlich durch ausgedehnte Wanderungen in verschiedenen Räumen. Im
Zusammenhang mit einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung sollten vor allem die Zeiträume der Wo-
chenstuben und des Sommerquartiers mit der Fortpflanzungsphase genutzt werden. Besonders geeignet
sind dabei die Monate Mai bis September.
Abb. 15: Höhle mit am Stamm herabgelaufener Flüssigkeit (links) sowie weiter oben am Baum befindliche flache
Astausfaulungen (Mitte, rechts)
Quartierkontrollen: Zur Ermittlung der lokalen Fledermausfauna wurden zunächst die Bäume im Gebiet
nach Höhlen und Spalten abgesucht. Die Höhlen wurden mit einer Endoskopkamera untersucht um eine
Nutzung oder Nutzungsspuren festzustellen. Es wurden keine konkreten Hinweise auf eine aktuelle Nutzung
gefunden. Ein Baum wies austretende Flüssigkeit aus einem Riss am Stamm auf. Da zunächst vermutet
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Seite 20Bebauungsplan
„Hinter den Gärten ll“
in Haigerloch-Hart
wurde, dass es sich hierbei um ausfließende Exkremente von Fledermäusen handeln könnte, wurde der
Baum eingehend auf eine weiter oben evtl. vorhandene Höhle untersucht. Da keinerlei Strukturen gefunden
wurden, kann eine Nutzung des Baumes durch Fledermäuse ausgeschlossen werden und die Flüssigkeit
deutet vmtl. auf einen Fäulnisprozess im Stamm hin. Weiterhin wurde in einem Apfelbaum eine potenziell als
Sommer- oder Wochenstubenquartier nutzbare Stammhöhle registriert. In einem weiteren, starkstämmigeren
Apfelbaum konnte ebenfalls eine Quartiernutzung zunächst nicht ausgeschlossen werden. Dieser Baum
weist am Stamm drei Höhlen an Astaustrittstellen auf, welche allesamt in größerer Höhe liegen (die unterste
etwa auf 2,5 m). Die unterste Höhle war gefüllt mit einer braunen zähen und unangenehm riechenden orga -
nischen Flüssigkeit (Abb. 15). Da zunächst nicht auszuschließen war, dass es sich hierbei um Exkremente
von Fledermäusen handelt, die von einer der oberen Höhlen im Stamminneren nach unten gesickert sind,
wurden diese Höhlen mithilfe einer Leiter und Endoskopkamera inspiziert. Dabei zeigte sich, dass keine der
beiden Höhlen einen Zugang ins Stamminnere bietet, sondern es sich lediglich um relativ flache Ausfaulun-
gen handelt (Abb. 15). Eine Eignung dieses Baumes als Sommerquartier oder Winterquartier für Fledermäu-
se ist somit nicht gegeben.
Abschließend erscheinen insgesamt 16 der gefundenen Strukturen po-
tenziell als Tageshangplätze für Fledermäuse geeignet, wobei es sich
um Spalten und kleine Höhlen im Stamm oder abstehende Rindenteile
handelte (Abb. 16). Eine weitere Höhle eignet sich vom Volumen her po-
tenziell als Sommerquartier (z. B. Wochenstubenquartier). Da aufgrund
der Höhe der Bäume im Gebiet die Kronenbereiche jedoch nicht voll-
ständig einsehbar sind, ist mit einem größeren Quartierpotenzial als an-
gegeben zu rechnen.
Die Scheune im Norden des Geltungsbereiches ist von außen für Fle-
dermäuse zugänglich (Abb. 17). Im Inneren konnten jedoch keine Spu-
Abb. 16: Potenzielles Tagesquartier in
ren einer aktuellen oder früheren Nutzung entdeckt werden (übertagen- einer Stammspalte
de Tiere, Kotansammlungen, Sekretverfärbungen an den Balken, Mumi-
en).
Baumfällungen und Gebäudeabrisse dürfen vorsorglich nur außerhalb der aktiven Phase der Fledermäuse
vorgenommen werden, also nicht in der Zeit vom 1. März bis 31. Oktober. Aufgrund der insgesamt 16 als Un-
terschlupf nutzbaren Spalten und Höhlen sind 32 Fledermauskästen (16 Tagesquartier-Flachkästen, 16 Fle-
dermaus-Höhlenkästen) sowie aufgrund von einem potenziellen Sommer-/Wochenstubenquartier 2 Sommer-
quartierkästen in der nahen Umgebung des Gebietes zu verhängen. Um als vorgezogene Ausgleichsmaß-
nahme wirksam zu werden, müssen die Kästen so bald wie möglich vor Beginn der Eingriffe verhängt wer-
den (CEF-Maßnahme). Die Kästen sind an geeigneter Stelle anzubringen. Dies bedeutet in mind. 3 m Höhe,
erschütterungsfrei und mit der Öffnung nach Süden, Südwesten oder Südosten orientiert. Zudem muss dar-
auf geachtet werden, die Kästen gleichmäßig in den umgebenden Streuobstbeständen zu verteilen.
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Seite 21Bebauungsplan
„Hinter den Gärten ll“
in Haigerloch-Hart
Abb. 17. Dachstuhl der Scheune ohne Hinweise auf eine
Nutzung durch Fledermäuse (links und rechts)
Detektorbegehungen: Für einen Nachweis, ob
Fledermäuse das Gelände als Jagdraum nut-
zen, wurden im Mai 2019 sowie im Juni, Juli und
September 2020 Transektbegehungen des Un-
tersuchungsgebietes mit einem Ultraschallde-
tektor (SSF BAT 3) durchgeführt. Ergänzend
wurde ein Batcorder (ecoObs GmbH: Batcorder
3.1) im Gebiet aufgestellt bzw. bei den o. g.
Transektbegehungen mitgeführt. Es konnten
insbesondere in den Abend- und frühen Nacht-
stunden sowohl akustisch, wie auch visuell,
starke Aktivitäten von Fledermäusen innerhalb
des Streuobstbestandes festgestellt werden. Die
Abb. 18: Erhaltungswürdige bzw. zu verpflanzende gehäuften Signale zur Ausflugszeit nach Son-
Habitatbäume (gelb umrandet)
nenuntergang stammen allesamt von der
Zwergfledermaus (Tab. 8, Nr. 1 und 2). Die Nutzung eines der Bäume als Quartier liegt daher nahe, konnte
aber im Laufe der Aus- und Einflugskontrollen nicht weiter konkretisiert werden. Da Fledermäuse ihre Quar-
tiere wechseln, um den Parasitendruck zu minimieren, verläuft ein Quartiernachweis nicht immer erfolgreich.
Weitere, mit dem Batcorder im Gebiet mit einer Sicherheit zwischen 60 – 99 % festgestellte Arten, sind die
Fransenfledermaus (2 Signale), der Große Abendsegler (1 Signal), die Rauhhautfledermaus (2 Signale) und
die Mopsfledermaus (1 Signal), siehe Tab. 9. Die Mopsfledermaus ist vom Aussterben bedroht (Rote Liste:
1). Inzwischen ergaben sich im Rahmen einer anderen gutachterlichen Untersuchung im Ortsinneren von
Hart Nachweise auf Quartiernutzungen durch die Mopsfledermaus; auch den Naturschutzverbänden vor Ort
liegen Informationen über ein Wochenstubenquartier in Hart vor. Die Mopsfledermaus nutzt bis zu 10 ver-
schiedene Teiljagdgebiete, die im Allgemeinen Flächengrößen zwischen 0,05–0,7 km² haben, welche sich
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Seite 22Bebauungsplan „Hinter den Gärten ll“ in Haigerloch-Hart meist in einem Umkreis von bis zu 5 km um das Quartier befinden (Berg & Wachlin 2004). Diesen Angaben folgend und aufgrund der Nähe des Streuobstbestandes zur Fortpflanzungsstätte und aufgrund des hohen Gefährdungszustandes der Art, ist davon auszugehen, dass es sich bei dem 0,88 ha großen Streuobstbe- stand im Plangebiet um ein essenzielles Teiljagdhabitat der Mopsfledermaus handelt. Da sich rund um Hart noch Streuobstbestände im Umfang von ca. 14 ha befinden, wird davon ausgegangen, dass der Verlust des Bestandes im Plangebiet vorübergehend von diesen aufgefangen werden kann, bis die Neupflanzungen ihre Funktion als Jagdhabitat erfüllen. Um ausschließen zu können, dass aufgrund des Verlustes dieses Nah- rungshabitates der Mopsfledermaus die erfolgreiche Reproduktion in der Fortpflanzungsstätte in Gefahr ist, wird angeraten, Erhaltungs- und Optimierungsmaßnahmen im Bereich der Fortpflanzungsstätte im Ort vorzu- nehmen, welche durch ein auf Fledermäuse spezialisiertes Fachbüro geplant und begleitet werden müssen. Um das mögliche Quartier der Zwergfledermaus zu berücksichtigen, ist vorgesehen, durch Großbaumver- pflanzung die struktur- und höhlenreichen Bäume zu sichern. Ergänzend sind 2 Sommerquartierkästen in der Umgebung zu verhängen. Es geht ein zusammenhängender und nicht unerheblicher Teil des östlich von Hart gelegenen Streuobstgür- tels verloren. Durch die Inanspruchnahme des Streuobstbestandes werden ein zusammenhängendes Jagd- habitat sowie Leitstrukturen zerschnitten bzw. entfernt, die Fledermäusen als Orientierung auf ihren Transfer- flügen dienen können. Im Rahmen des § 33a NatschG wird ein 1:1-Ausgleich der in Anspruch genommenen Streuobstfläche, also rund 8850 m², notwendig. Diese Neupflanzungen können zur langfristigen Minimierung des Eingriffes beitragen. Es wird im Osten und Südosten an das Plangebiet angrenzend ein Streuobstgürtel neu gepflanzt, weiterhin vorgesehen sind Neupflanzungen auf weiteren von der Stadt vorgeschlagenen Flur - stücken, sodass insgesamt ein Ausgleich von 1:2 erzielt werden kann. Zudem erfolgt die Erschließung in zwei Bauabschnitten. Dabei wird der Großteil des bestehenden Streuobstbestandes für die nächsten 5 Jahre erhalten bevor dann frühestens der 2. Bauabschnitt realisiert wird. So können die neu gepflanzten Bäume bereits eine gewisse Wertigkeit erreichen. Die wertvollsten Habitatbäume sollen durch eine Großbaumver- pflanzung in die östlich ans Gebiet angrenzende zukünftige Streuobstfläche hinein gesichert werden. Ist eine Verpflanzung des kompletten Baumes mit Krone nicht möglich, so sind zumindest die Stämme, ggf. auch mit Hauptästen aufzustellen. Durch die Großbaumverpflanzungen kann kurzfristig wieder eine Leitstruktur in Nord-Süd-Richtung geschaffen werden. In Abb. 18 sind die aus Sicht der Fledermaus- und Avifauna wert- vollsten Habitatbäume vermerkt. Bei Verpflanzung der in Abb. 18 dargestellten Bäume verringert sich die Anzahl notwendiger Kästen auf 2 Sommerquartierkästen, 7 Fledermaus-Flachkästen und 7 Fledermaus-Höhlenkästen. Das Grünland in den Ausgleichsflächen ist als artenreiche Mähwiese zu entwickeln. Dies bedeutet die Ver- wendung eines geeigneten Saatgutes (z. B. ‚Blumenwiese‘ der Fa. Rieger-Hofmann) sowie die angepasste Pflege (je nach Aufwuchsstärke ein- bis mehrmaliges Mähen mit Abräumen, erster Schnitt etwa zur Haupt - blütezeit der Gräser oder kurz danach). Eine zusätzliche Aufwertung erfolgt durch das jährliche Stehenlas- sen von Altgrasstreifen. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Seite 23
Sie können auch lesen