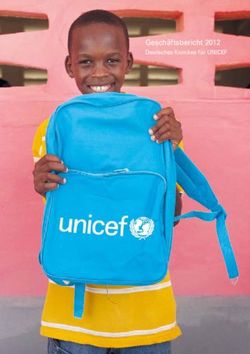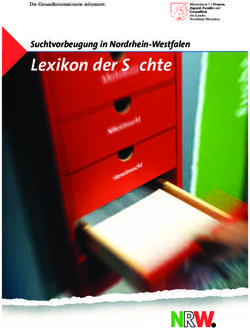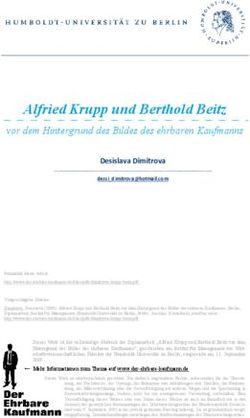Partizipative Methoden kirchlicher Arbeit - Impulse zur Gestaltung und Veränderung der Armutssituation benachteiligter Kinder und Jugendlicher in ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Partizipative Methoden kirchlicher Arbeit Impulse zur Gestaltung und Veränderung der Armutssituation benachteiligter Kinder und Jugendlicher in Burundi Masterthesis An der Hochschule RheinMain, Wiesbaden Fachbereich Sozialwesen Masterstudiengang: Sozialraumentwicklung und -organisation Verfasst von Stefan Hoffmann B.P. 6300 Bujumbura Burundi Matrikel Nummer: 655718 Vorgelegt am: 15. Juli 2010 Prüfer Erstprüfer: Prof. Dr. Michael May Zweitprüfer: Prof. Dr. Monika Alisch
Inhaltsverzeichnis 2
Verzeichnis der Tabellen und Abbildungen 5
Einleitung und Fragestellung 6
TEIL 1 GRUNDLAGEN
1. Armutsdefinitionen 8
1.1. Der Armutsbegriff im westlichen Kontext 8
1.2. Der Armutsbegriff im Kontext „Dritte Welt“ 9
1.2.1. Chambers 9
1.2.2. Friedmann 9
1.2.3. Jayakaran 12
2. Lösungen innerhalb der Kirche 13
2.1. Befreiungstheologie und Radikale Evangelikale 13
2.2. Freire als ein Vertreter der Befreiungstheologie 15
2.3. Afrikanische Theologie 16
2.4. Situationsbeschreibung zum Verhältnis Kirche und Armut in Deutschland 19
2.4.1. Grundlagen 19
2.4.2. Grundlegendes Problem 20
2.4.3. Gesellschaftsrelevanter Gemeindebau 21
3. Bewältigungsstrategien 22
3.1. Individuelle Bewältigungsstrategien 22
3.2. Gemeinschaftliche Bewältigungsstrategien 23
TEIL 2 ANWENDUNG
1. Das Projekt BAHO 28
1.1. Sozialpolitische Vorraussetzungen in Burundi 28
1.2. Das Projekt 29
2. Die Rolle der Kirche in Burundi 31
2.1. Die Stellung der Diözese Bujumbura 31
2.2. Die Rolle von Religion und Kirche in Burundi 31
23. Dokumentation des Forschungsprozesses 33
3.1. Hintergründe und empirische Basis 33
3.2. Datenerhebung 1: Die Methode der Zukunftswerkstatt 35
3.2.1. Zukunftswerkstatt: Übertragung in den burundischen Kontext 36
3.2.2. Ergebnisse der Zukunftswerkstatt 38
3.2.2.1. Inhaltsbereiche 39
3.2.2.2. Antwortverhalten und Antwortstile 40
3.3. Erster Anknüpfungspunkt für die künftige BAHO-Arbeit 43
3.4. Datenerhebung 2: Die Methode der Gruppendiskussion 43
3.4.1. Durchführung und Ergebnisse der Gruppendiskussion „Ehrenamtliche“ 44
3.4.2. Durchführung und Ergebnisse der Gruppendiskussion „BAHO-Kinder“ 46
4. Retrospektive Reflexionen zum Forschungsprozess 48
5. Diskussion der Ergebnisse: Konzeptionelle Ansätze der Veränderung und
Armutsbekämpfung in Bezug auf Gruppen 52
5.1. Aneignung 52
5.2. Aneignung Jugendlicher im Sozialraum 54
5.3. Aneignende Bildungsarbeit in Bezug auf BAHO 56
5.3.1. Situationsanalyse: Kirchliche Jugendarbeit in Burundi 56
5.3.2. Gemeinschaftliche Erziehungsarbeit – Spagat zwischen Individuum und
Gemeinwesen 57
5.4. Theoretischer Bezug: aneignungsorientierte Befreiungspädagogik 63
5.5. Praxis 68
5.5.1. BAHO-Clubs 68
5.5.2. Die Rolle des Lehrers 69
6. Zusammenfassung: Armutsbekämpfung durch BAHO-Clubs 71
6.1. Bewusstsein bringt soziale Macht 71
6.2. Die Rolle der Kirche 72
6.3. Die Rolle des Empowernden 73
7. Schlussbetrachtung und Ausblick 73
3Literaturverzeichnis 77
Anhang 82
Anhang 1: Beispiel einer Auswertungstabelle der Antworten der 26 Kinder in Musaga
bezogen auf den Lebensbereich Familie. 82
Anhang 2: Verdichtete Darstellung der Ergebnisse in Musaga, die Grundlage der
Diskussionsrunden mit den Betreuern und Kindern war. 84
Erklärung der eigenständigen Erarbeitung 85
4Verzeichnis der Tabellen und Abbildungen
Abbildung 1: Lebensraum eines Haushalts und die vier Bereiche sozialer Praxis 9
Tabelle 1: Aufschlüsselung der an der Zukunftswerkstatt beteiligten BAHO-Kinder nach
Alter, Herkunft und Geschlecht. 33
Tabelle 2: Verteilung der „erwachsenen“ Antwortstile während der Utopiephase in Bezug
auf den Lebensbereich Schule. 39
Tabelle 3: „Kirchlich-sozialisierte“ Antwortstile während der Utopiephase in Bezug auf
Gruppenpräsentationen in allen Lebensbereichen. 40
Tabelle 4: Teilnehmende BetreueInnen an der Gruppendiskussion aufgeschlüsselt nach
Herkunft und Geschlecht. 43
Abbildung 2: Reflexions-Zyklus Handlungsforschung 48
Abbildung 3: Verhältnis „Reflexion – Aktion – Wort“ 65
5Einleitung und Fragestellung
Ausgangslage für diese Masterarbeit war mein Arbeitsaufenthalt in Burundi. Ich arbeitete
seit 2008 im Auftrag der Liebenzeller Mission als Berater im BAHO-Projekt1, einem
Projekt für benachteiligte Kinder und Jugendliche der Anglikanischen Kirche in Burundi.
Durch Fragen der Entwicklungs- und Armenarbeit wurde ich in dieser Zeit immer wieder
herausgefordert, mein praktisches Handeln theoretisch zu unterfüttern. Daher war es der
ideale Zeitpunkt, um den Masterstudiengang Gemeinwesenarbeit zu belegen und sowohl
Fragen der Praxis an die Theorie nachzugehen, als auch umgekehrt.
Im Laufe meiner praktischen Arbeit konnte ich einerseits in zunehmendem Maße die
immensen Herausforderungen erkennen, vor die sich die Kirche in Burundi gestellt sieht:
Als größte flächendeckende soziale Organisation hat sie nicht nur den größten ethisch-
moralischen Einfluss auf die Bevölkerung des ostafrikanischen Landes, sondern im
Gegenzug auch eine hohe Verantwortung, ihren Gläubigen zu dienen und deren soziale
Macht zu entwickeln oder zu vertreten.
Auf der anderen Seite begegneten mir viele benachteiligte Kinder und Jugendliche in dem
Projekt, für das ich mitverantwortlich war, so dass ich immer wieder herausgefordert
wurde, mich zu fragen: „Wie kann ich helfen?“ „Wie kann ich Not lindern?“
Schnell wurde mir klar, dass ich kein „Entwicklungshilfe-Nikolaus“, also ein Helfer in der
Rolle des immer Verteilenden, sein wollte – schon allein aus Budgetgründen nicht,
geschweige denn aus Gründen der Nachhaltigkeit oder pädagogischer Verantwortung.
In meiner praktischen und theoretischen Arbeit befasste ich mich deshalb maßgeblich mit
zwei Fragen: „Welche Rolle spielt die Kirche?“ und „Wie kann armen Kindern und
Jugendlichen geholfen werden?“. Diese Fragen betrafen mich nicht nur als praktizierenden
Christen, sondern auch als Mitverantwortlichen des BAHO-Projekts. Zu ihrer
Beantwortung im Rahmen dieser Arbeit gliedert sie sich in einen Grundlagenteil und einen
Anwendungsteil. Im ersten Teil beleuchte ich Armutstheorien sowohl für den westlichen
als auch den Kontext „Dritte Welt“. Im Anschluss daran beschreibe ich Lösungen, wie sie
die Kirche in verschiedenen Kontexten in Auseinandersetzung mit der Frage der Armut in
dieser Welt gefunden hat. Abschließende Überlegungen in diesem Kapitel beziehen sich
auf Bewältigungsstrategien, also die Frage, wie Menschen mit Armut umgehen und welche
Lösungen diskutiert werden, um Armut zu bekämpfen.
Im zweiten Teil widme ich mich der Anwendung. Nach der Vorstellung des Projekts
BAHO, eingebettet in den sozialpolitischen Rahmen des Landes Burundi, beschreibe ich
1
Baho ist Kirundi und bedeutet: „Leben ermöglichen“. Die Projektleitung hat entschieden, das Wort in
Majuskeln zu schreiben.
6die von mir beobachtete Rolle der Anglikanischen Kirche in Burundi und allgemein die
Rolle von Religion und Kirche in diesem Land. Daran anschließend folgt die Beschreibung
des Forschungsdesigns und der einzelnen Forschungsschritte. Im darauf folgenden Kapitel
beschreibe ich die Lösung, wie sie sich mir darstellt – eine Lösung, die ein
aneignungsorientiertes Bildungskonzept vorsieht und die Implementierung eines BAHO-
Clubs beinhaltet. Im vorletzten Kapitel stelle ich den Beitrag dieser BAHO-Clubs in Bezug
auf die Armutsbekämpfung dar, bevor ich mit weiteren Ausblicken und
Entwicklungspotentialen schließe.
7TEIL 1 GRUNDLAGEN
1. Armutsdefinitionen
Da die Arbeit sich wesentlich mit der Bekämpfung von Armut befasst, möchte ich mich im
ersten Kapitel mit Armutstheorien auseinandersetzen.
1.1. Der Armutsbegriff im westlichen Kontext
Wie Diez nachweist, ist Armut nicht die Abwesenheit von Dingen wie Essen, Kleidung
oder Geld. Armut ist somit nicht nur materiell mess- und beseitigbar (Diez 1997: 83).
Im Folgenden beziehe mich auf die Definition von Alisch, die schreibt: „Nachdem durch
die ökonomische Entwicklung im westlich orientierten Europa und in Nordamerika das
Ziel als dauerhaft gesichert erschien, ein physisches Existenzminimum für alle
EinwohnerInnen zu gewährleisten, ging man in der Wissenschaft von einem absoluten zu
einem relativen Armutsbegriff über.“ (Alisch 2008: 86, Hervorhebung im Original).
Relative Ansätze ließen sich, so Alisch weiter, in Ressourcen- und Lebenslagenansätze
aufteilen. Im Mittelpunkt steht bei jenen die Differenz zwischen Ressourcen unterhalb des
Existenzminimums gemessen am sozial-kulturellen Standard einer konkreten Gesellschaft.
Der Ressourcenansatz habe Einkommensarmut als Gegenstand: „Zur Bestimmung des
Ausmaßes der Armutsbevölkerung wird ein nach der Haushaltsgröße und der
Zusammensetzung der Haushalte gewichtetes monatliches Haushalts-Netto-Einkommen -
Äquivalenzeinkommen - gebildet.“ (ebd., Hervorhebung im Original)
Demgegenüber sei der Lebenslagenansatz eher ein sozialwissenschaftlicher, da er auch
soziale Armut messen und darstellen wolle. Dieser Ansatz leite sich nicht nur aus einer
Hierarchie sozialer Ungleichheit ab, sondern umfasse auch Systeme multipler sozialer
Deprivation. „Neben den materiellen Dimensionen [Arbeit, Einkommen Vermögen, (Aus-)
Bildung, Wohnen, Konsumniveau] umfasst dieses Konzept auch die Lebensbereiche
Ernährung, Umwelt, Gesundheit und Erholung sowie immaterielle Aspekte wie soziale,
kulturelle und politische Partizipation, Rechtsgleichheit und Integration.“ (a.a.O.: 87)
Klocke deutet für den Lebenslagenansatz an, dass er die Begrenzung der Definition von
Armut auf Einkommensarmut überwinde. Kritisch bemerkt er: „Keineswegs geklärt ist
aber die Frage, welche Lebensbereiche in die Analyse einbezogen werden sollen und wie
die Schwellenwerte zu bestimmen sind.“ (Klocke 2000: 317) Trotz dieser Kritik am
Lebenslagenansatz würde, so wiederum Kronauer, durch diesen aber erst deutlich, „warum
Armut für die von ihr Betroffenen nicht nur Mangel bedeutet, sondern ein soziales
Ausgrenzungsverhältnis begründen kann.“ (Kronauer 2002: 176)
81.2. Der Armutsbegriff im Kontext „Dritte Welt“
Wie Myers beschreibt, wurde auch die Entwicklungshilfe zu Beginn vom Gedanken
beherrscht, dass Armut die bloße Abwesenheit von Essen, Kleidung oder Bildung sei (vgl.
Myers 2008: 65). Allerdings schreibt Myers weiter: „If poverty is the abscence of things,
then the solution is to provide them. This often leads to the outsider becoming the
development „Santa Claus”, bringing all the good things […].” (a.a.O.: 66) Myers weist
darauf hin, dass Arme dadurch aber zu bloßen Leistungsempfängern würden und erst durch
die Hilfe der Geber komplette Menschen werden könnten. (ebd.) Bald jedoch setzte ein
Wandel im Armutsbegriff der Entwicklungshilfe ein, den ich im Folgenden nachzeichnen
möchte:
1.2.1. Chambers
Ursprung des von mir verwendeten Armutsbegriffs in der Entwicklungshilfe ist die Idee
von Robert Chambers in den 1980er Jahren, der Armut auf einen Haushalt bezog und
diesen in einer Armutsfalle sah, die aus sechs Eckpunkten bestand:
• materielle Armut (wenig Tiere, kaum Land, kein Wasser etc.),
• Verletzlichkeit (kaum Wahlmöglichkeiten, kein Puffer bei Katastrophen etc.),
• Machtlosigkeit (Systeme, in denen die Mitglieder des Haushalts leben, können von
diesen nicht beeinflusst werden),
• spirituelle Armut (keine gesunden Beziehungen zu Gott, den Nachbarn oder dem
Sozialwesen, in dem die Haushaltsmitglieder leben),
• Isolierung (weit weg von Zentren, wenig Zugang zu Informationen etc.),
• physische Schwäche (Gesundheit, Ernährung etc.).
Myers deutet darauf hin, dass diese Eckpunkte miteinander verwoben seien und der
Mangel in einem Bereich einen anderen mit beträfe (vgl. a.a.O.: 66ff.). Besonders der
Eckpunkt „Machtlosigkeit“ sei bedeutsam, da er der Ausgangspunkt für Ausbeutung sei
(ebd.).
1.2.2. Friedmann
Dieses Modell von Chambers wurde von Friedmann weiterentwickelt. Auch er stellt den
Haushalt als die soziale Einheit der Armen und als elementare Einheit von
Zivilgesellschaft (Friedmann 1998: 32) in das Zentrum seines Interesses und setzt ihn dann
in Bezug zu vier sich überlappenden Bereichen. Friedmann beschreibt Armut als
9Machtlosigkeit und fehlenden Zugang zu sozialer Macht. Arme Haushalte sind
ausgeschlossen von Macht und bedürfen des Empowerment (vgl. Myers 2008: 69ff.).
Laut Friedmann ist ein Haushalt von vier sozialen Praxen umgeben, die jeweils ihre eigene
Macht haben und verleihen und die einen zentralen Punkt haben, den ich in Klammern
angebe (ebd.):
• Soziale Macht (Zivilgesellschaft)
• Ökonomische Macht (Genossenschaften, Zusammenschlüsse)
• Politische Macht (politische Organisationen)
• Staatliche Macht (Exekutive und Judikative)
Lebensraum
Staat
Exekutive/Judikative
Kirchen,
Legislative,
Freiwilligen -
regulierende
Organisationen
Behörden
Politik Zivilge-
politische sellschaft
Organisationen Haushalt,
Gemein-
wesen
Protestbewe-
gungen, Parteien informeller
Sektor
Ökonomie
Finanzielle Institutionen,
Kooperationen
Abbildung 1: Lebensraum eines Haushalts und die vier Bereiche sozialer Praxis, nach Myers
2008: 70
Das wirtschaftliche Handeln eines Haushalts setzt Friedmann (Friedmann 1998: 66f.) in
das Zentrum eines Feldes sozialer Macht, das dieser Haushalt besitzt.
Die (Zustands-)Beschreibung dieses Feldes führt zu Indikatoren sowohl hinsichtlich der
Haushaltsökonomie als auch im Blick auf Zugänge zu sozialer Macht, weshalb sich in
Konsequenz zugleich Entwicklungspotentiale aufzeigen lassen (a.a.O.: 70). Soziale Macht
10hat ihren Anknüpfungspunkt in der Zivilgesellschaft und wird von den anderen Mächten
(staatlich, politisch und ökonomisch) begrenzt bzw. ergänzt.
Friedmann beschreibt weiterhin acht sich gegenseitig beeinflussende Basispunkte, die
zugleich die Grenzen eines armen Haushalts darstellen. Um soziale Macht zu gewinnen,
müsse mit den Haushalten gearbeitet werden. Ziel sei dabei, den Raum und Einfluss in den
folgenden Punkten zu vergrößern, denn wenn in all diesen Bereichen die Werte, um selbst
aus der Armut zu kommen, zu gering seien, dann herrsche absolute Armut (a.a.O.: 67f.):
• Soziale Netzwerke (horizontale und vertikale Netzwerke können dem Haushalt
helfen, sich zu verbessern oder Abhängigkeiten zu schaffen [vgl. Kapitel 3.2.
„Soziales Kapital“])
• Informationen zur Entwicklung (jegliches Wissen, das dazu dient, sein Leben zu
verbessern: Hygieneschulungen, Kindererziehung, öffentliche Angebote etc.)
• Übrige Zeit (jegliche Zeit, die nicht in die Sicherung des unmittelbaren Überlebens
investiert wird)
• Arbeitsinstrumente (alles, was der Produktivität des Haushalts dient: Wasser,
Geräte, körperliche Gesundheit)
• Soziale Organisationen (formelle und informelle Organisationen wie Kirchen,
Clubs, Sportvereine etc. – sie helfen, relevante Informationen zu erhalten,
gemeinschaftliche Aktionen zu organisieren und sich gegenseitig zu unterstützen)
• Wissen und Fertigkeiten (Ausbildungen und Gaben, die einem Haushalt zur
Verfügung stehen, um sich ökonomisch zu entwickeln)
• Verteidigbarer Lebensraum (unmittelbarer Raum, in dem sich das Leben abspielt –
eigenes Heim und Nachbarschaft)
• Finanzielle Ressourcen (Geldverleiher, Einkommen etc.)
Prinzipiell gilt laut Friedmann, dass soziale Netzwerke und soziale Organisationen der
Ausgangspunkt zur Bekämpfung von Armut sind. Wenn jene sich entwickelten und
gleichzeitig die Armen empowern, fände Entwicklung statt. Zu sozialen Organisationen
zählt Friedmann Vereinigungen wie Kirchen, lokale Organisationen oder
Nachbarschaftsinitiativen; oft sei zur Initiierung dieser Prozesse aber ein „Agent“, der von
außen kommt, nötig (vgl. a.a.O.: 71). Sie sind es, die soziale Macht mit den Armen
zusammen schaffen können, und in zweiter Linie kann sich dann politische Macht2
2
Politische Macht bei Friedmann heißt nicht nur das Recht zu wählen, sondern seine Stimme zu erheben und
kollektive Aktionen zu initiieren. Das Stimme-Erheben wird laut Friedmann verstärkt, je mehr es an
politische und soziale Organisationen angeknüpft ist (vgl. Friedmann 1998: 33f.).
11entwickeln. Weiterhin ist für Friedmann Empowerment der Schlüssel zur Änderung
bestehender Verhältnisse. Er versteht unter Empowerment, dass die Armen lokale
Entscheidungsgewalt suchen und erhalten und dass partizipatorische Demokratie durch-
und umgesetzt wird; des Weiteren ist soziales Lernen ein Teil dieses
Empowermentprozesses (Myers 2008: 99f.). Wie oben schon erwähnt, ist Ziel dieses
Prozesses, die Grenzen eines Haushalts zu erweitern und somit Armut zu bekämpfen.
Als Hintergrund seiner Theorie sieht Friedmann eine weltweite Veränderung der
Gesellschaft. Er stellt fest, dass die staatliche Macht insgesamt zurückgehe zu Gunsten
einer sich ausweitenden ökonomischen Macht, die in globale Wirtschaftsprozesse
eingebettet sei (a.a.O.: 100f). Im Zuge dieser Veränderung würden politische und soziale
Macht im Leben eines jeden zurückgedrängt. Friedmann sieht hier den Ansatz der
„alternativen Entwicklung“. Zivilgesellschaft und politische Gesellschaft müssten im
Leben der Armen entwickelt und gestärkt werden, um ihnen mehr Lebensraum zu schaffen
(a.a.O.: 101).
Um diese zivilgesellschaftliche Teilhabe in Bezug auf staatliche Macht zu entwickeln, sei
„expanding household participation in democratic processes“ nötig (ebd.), wohingegen es
bei zivilgesellschaftlicher Teilhabe in Bezug auf die Wirtschaft darum gehe, durch
„increasing household participation as productive citiziens with a stake in society“ (ebd.)
die Haushalte zu entwickeln.
Insgesamt glaubt Friedmann an ein bottom-up-System. Die Armen müssten ihre eigenen
Bedürfnisse erkennen und politisch durchsetzen. Dazu sei es aber nötig, nicht nur auf
lokaler Ebene zu handeln, sondern auch auf der Makroebene einer Gesellschaft zu
intervenieren, indem kleine Projekte verlinkt und große Projekte mit verschiedenen
Institutionen zusammen angegangen würden. Dies sei ein weiterer Weg, wie Arme soziale
und politische Macht zurückgewinnen könnten (a.a.O.: 99ff.).
1.2.3. Jayakaran
Dieses Konzept Friedmanns möchte ich um eines ergänzen, das von dem Inder Ravi
Jayakaran Mitte der 1990er Jahre eingebracht wurde. Er beschreibt Armut als die
Abwesenheit der Freiheit zu Wachstum, die sich im Leben der Armen in den folgenden
vier Wachstumsbereichen auswirke:
• physisch
• mental
• sozial
• spirituell
12Jayakaran sieht hinter diesen Wachstumsbegrenzungen das Anliegen von Menschen, die
von ihnen profitierten und somit ein Interesse daran hätten, dass Wachstum nicht stattfinde.
Auf lokaler Ebene würden die Armen begrenzt durch Menschen wie:
• Geldleiher
• Polizei
• Behörden
• Priester, Schamanen
Auf der Makroebene seien die Menschen, die dieses Interesse des Aufrechterhaltens der
Begrenzungen haben, schwerer zu identifizieren, aber oft kontrollierten sie die lokale
Ebene und profitierten dadurch ihrerseits. Die Vorzüge dieses Konzepts sind, dass
Jayakaran Armut in Menschen verortet. Das heißt, Menschen machen andere Menschen
arm oder halten sie arm, weil sie ein Interesse daran haben. Weiterhin macht er deutlich,
dass die, die lokale Entwicklung verhindern, oft selbst in einem System stecken, das sie
bindet und in ihre Rollen zwängt. Somit ist die Beteiligung an diesem System der
Unterdrückung bis in nationale und globale Ebenen hinein zu verfolgen. Gleichzeitig wird
deutlich, dass für ein Aufbrechen dieser Situation eine Veränderung der Armen und der
Nicht-Armen nötig ist, anstatt sich auf die Beeinflussung von Systemen, Märkten oder
Korruption, die nicht direkt verändert werden können, zu konzentrieren (vgl. dazu a.a.O.:
80ff.).
2. Lösungen innerhalb der Kirche
Nach diesen Einblicken in Konzepte aus der Entwicklungshilfepraxis sollen nachfolgend
und unter unter besonderer Berücksichtigung kirchlicher Strukturen Lösungsvorschläge
und Hintergründe dargestellt werden, wie sie auf Seiten der Kirchen zu finden sind.
2.1. Befreiungstheologie und radikale Evangelikale
Eine kirchlich orientierte Antwort auf Fragen der Armut im Kontext „Dritte Welt“ lieferte
die Befreiungstheologie. Hervorgehend aus den sozialen Fragen in Lateinamerika und den
für die befreiungstheologischen Vertreter wenig befriedigenden Antworten seitens der
Kirche bezüglich ihrer sozialen Verantwortung, erarbeiteten sie eine „Volkstheologie“
(Beyerhaus 1986: 17), die die aktuellen Lebensbezüge der Armen berücksichtigt und
zugleich „unerbittlich nach der sozial-ethischen Relevanz des christlichen Glaubens und
damit auch der christlichen Theologie“ fragt (a.a.O.: 44).
13Dass diese Bewegung nicht einheitlich ist, stellt Helfenstein deutlich heraus (vgl.
Helfenstein 1991: 23), in dem er in Anlehnung an Frieling drei befreiungstheologische
Typen aufzählt:
• der sozial-populistische
• der marxistische
• der evangelisatorische.
Helfenstein, der das Thema theologisch diskutiert, stellt diesen drei Typen die Bewegung
der „Fraternidad Teologica Lationamerica (FTL)“ gegenüber. Diese kirchliche Bewegung
ist abhängig von der Befreiungstheologie, „will aber als befreiende Theologie bewusst
evangelikal3 bleiben“ (ebd.).
Diese theologische Unterscheidung verschiedener Strömungen innerhalb der
Befreiungsbewegung zu erwähnen ist an dieser Stelle wichtig, da eine Quelle der so
genannten radikalen Evangelikalen die Befreiungstheologie ist (vgl. Hardmeier 2006: 9).
Das Wesen der radikalen Evangelikalen ist es, nicht nur kontextuelle Theologie, also eine
an den lokalen Lebensumständen orientierte Theologie zu betreiben, sondern auch eine
transformatorische Theologie zu leben und zu fordern, die neben der persönlichen
Transformation der Gläubigen eine Veränderung der Gesellschaft im Blick hat (a.a.O.:
118). Allerdings sehen die radikalen Evangelikalen an den verschiedenen
Befreiungstheologien kritisch, dass sie dem Marxismus einen besonderen Platz eingeräumt
hätten, den sie der Bibel verweigerten (Costas in Hardmeier: 48). Ein weiterer Kritikpunkt
an der Befreiungstheologie ist, dass der biblische Text nur noch eine vergleichende bzw.
beschreibende Funktion habe, und somit verliere er sein normatives Element (ebd.). Wie
ich später darstelle (vgl. Kapitel 3.2.2.), akzeptieren viele der von uns betreuten Kinder und
Jugendliche in der Anglikanischen Kirche in Burundi diese biblische Autorität und
reflektieren ihre soziale Realität aber weitgehend unkritisch, daher dieser kleine Exkurs in
die Theologie.
3
Das Wort evangelikal wird von Hardmeier wie folgt beschrieben: „Der Begriff „evangelical“ taucht
erstmals in England als Bezeichnung der Anhänger der Reformation sowohl lutherischer als auch
calvinistischer Prägung auf. In den folgenden zweihundert Jahren wurde er vom Ausdruck „protestant“
zurückgedrängt. Im 18. Jahrhundert trat der Begriff „evangelical“ in Zusammenhang mit der englischen
Erweckungsbewegung wieder in Erscheinung. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurde mit dem Begriff
„evangelical“ die Christen bezeichnet, die innerhalb der Kirche Englands die Erweckungsbewegung
vertraten. Trotz denominationeller Zersplitterung nahmen die Evangelicals eine Verbundenheit unter sich
wahr, die sich vor allem im Bibelbekenntnis ausdrückte. […] Die evangelikale Bewegung ist ein
vielschichtiges Phänomen und entsprechend gibt es keine einheitliche Definition der heutigen evangelikalen
Typen.“ (Hardmeier 2006: 2). Es werde zwischen reformierter, pfingstlicher und radikaler Frömmigkeit
unterschieden, wobei letztere auf die angewandt würde, die sich sozial-politisch einsetzen (vgl. ebd.).
142.2. Freire als ein Vertreter der Befreiungstheologie
Da ich später (v.a. Kapitel 5.4.) auf die Ideen Freires zurückkomme, möchte ich hier einige
Grundlinien seines Arbeitens und Denkens skizzieren. Paolo Freire (1921 bis 1997) wurde
in Brasilien geboren und verbrachte dort einen großen Teil seiner Kindheit. Frühe
Hungererfahrungen brachten den Elfjährigen dazu, sich dem Kampf gegen Hunger zu
verschreiben (vgl. Lange in Freire 1973: 10). Für Freire war Bildung der Schlüssel zu
Entwicklung. Somit wandte er ab 1947 ein Alphabetisierungsverfahren an, wurde aber
nach einem Staatsstreich in Brasilien 1964 des Landes verwiesen und arbeitete fortan als
Professor und Sonderbeauftragter des Ökumenischen Kirchenrates in verschiedenen
Ländern. Das Werk Freires zusammenzufassen fällt schwer, weshalb ich mich im
Folgenden auf die für den Diskussionskontext vorliegender Arbeit relevanten Punkte und
Rahmenbedingungen konzentriere.
Für Freire war es zeitlebens eine Frage, wie den Unterdrückten geholfen werden könnte.
Freire geht davon aus, dass die Unterdrückten sich in einem Netz von Lügen befinden
(Freire nennt in diesem Zusammenhang den Begriff „Mythos“), das zu ihrer Nichtigkeit
und ihrem geringen Selbstwertgefühl beiträgt und das von den Herrschenden dazu benutzt
wird, aktuelle Machtverhältnisse zu stabilisieren, indem die Herrschenden behaupten, dass
die Armen aufgrund ihrer Nichtigkeit von jenen geführt oder entwickelt werden müssen
(a.a.O.: 10). Er sieht somit strukturelle Gründe für Armut, sie ist für ihn „als Folge
jahrhundertelanger und gegenwärtiger sozio-ökonomischer Unterdrückung bzw.
politischer, ökonomischer, kommunikativer und kultureller Abhängigkeit“
(www.freire.de/theologie) zu sehen.
Freire fand heraus, dass die Armen in Reaktion auf diese Strukturen eine Kultur des
Schweigens entwickeln, wobei die sie umgebenden Organisationen, wie zum Beispiel die
Kirchen, über diesen Zustand des Hungers und des Elends ebenso in ein Schweigen
verfallen (vgl. Ndabiseruyie 2009: 255). „Die Armen können sich nicht wehren, weil ihnen
die „Sprache: die Waffe der Freiheit“ geraubt wird.“ (a.a.O.: 255) Für Freire ist daher
Bildung einerseits der Weg zur Befreiung aus dieser Situation und andererseits kann sie –
sofern sie nicht fruchtbar genutzt wird und zu einem eigenständigen und kritischen Denken
befähigt – dazu dienen, bestehende Macht- und Unterdrückungsverhältnisse zu stützen.
Freire führt hier den Begriff der Bankiersbildung ein (vgl. Freire 1973: 57ff.), in dem er
deutlich macht, dass Wissen Macht ist. „Die Möglichkeit der Bankiers-Erziehung, die
kreative Kraft der Schüler zu minimalisieren oder zu vernichten und ihre Leichtgläubigkeit
zu stimulieren, dient den Interessen der Unterdrücker, denen es darum geht, daß die Welt
weder erkannt noch verändert wird“ (a.a.O.: 59). Dieses Verhindern von Erkennen und
15Verändern geschieht dadurch, dass der Lehrer seinen Schüler als Container ansieht, in den
er Wissen zu packen hat. Lernen wird als Stapeln dieses Wissens im Container gesehen.
Die Rollen sind dabei klar verteilt: der Lehrende weiß, der Lernende hat zu reproduzieren
(vgl. a.a.O.: 57ff.). Ergebnis eines solchen Lernprozesses ist laut Freire: „der angepaßte
Mensch, denn er paßt besser in die Welt“ (a.a.O.: 61) und sorgt dadurch für weniger
Unruhe, was im Interesse des Unterdrückers liegt. Freire warnt aber davor, dass die die
Freiheit zu ihrer Sache machen, in genau dieselbe Richtung gehen, indem sie dieses
„Deposit“ (a.a.O.: 64) in die zu Befreienden einlagern: „Befreiung ist ein Vorgang der
Praxis: die Aktion und Reflexion von Menschen auf ihre Welt, um sie zu verwandeln“
(ebd.).
Freire sieht einen bewusstseinsbildenden Befreiungsprozess als Mittel an, diese Zustände
zu ändern. Dem Lehrer kommt hierbei eine tragende Rolle zu. Denn dieser muss nicht nur
anerkennen, dass Lehren ideologisch ist, sondern er muss sich gleichzeitig mit den
Lernenden zusammen auf einen Lernprozess einlassen, bei dem beide Seiten lernen (vgl.
dazu Freire 2008: 23ff bzw. 85ff). Neben dieser veränderten Lehrerhaltung ist für Freire
entscheidend, dass es einen Dialog gibt, der die Unterdrückten einschließt. Durch das
Bankiers-Konzept und die Kultur des Schweigens werden der Dialog unterdrückt und die
Passivität der Unterdrückten gefördert (vgl. Freire 1973: 78ff). Doch für Freire bedeutet
menschlich existieren: „[…] die Welt benennen, sie verändern. […]. Menschen wachsen
nicht im Schweigen, sondern im Wort, in der Arbeit, in der Aktion-Reflexion“ (a.a.O.: 71).
Dieses Benennen-Können ist Grundlage für Dialog und somit für Befreiung. Für Freire ist
Bildung, also Alphabetisierung und In-Dialog-treten-können, eine „Praxis der Freiheit“,
die im Gegensatz zur „Bankiers-Erziehung“ oder einer „Praxis der Herrschaft“ steht.
Allerdings ist abschließend anzumerken, dass dieses Bildungs- und Befreiungskonzept als
Erwachsenenbildungskonzept entstanden ist. Es schließt jedoch nicht aus, dass diese
Denklinien auf Jugendarbeit übertragen werden können (vgl. dazu Kapitel 5.4.).
2.3. Afrikanische Theologie
Nachdem ich jetzt einiges über prinzipielle Entwicklungen in der Theologie in Bezug auf
Armut und den Umgang mit ihr geschrieben und mit dem Beispiel Fall Freires vertieft
habe, möchte ich auf den theologischen Kontext zu sprechen kommen, in dem diese Arbeit
verankert ist – dem afrikanischen. Welche Ansätze in der afrikanischen Theologie gibt es,
und wie verhält sie sich gegenüber Armut?
Einleitend sei geschrieben, dass der afrikanische Kontinent nicht ohne Religion zu denken
ist. Egal ob es animistische Religionen sind, die das Denken und Handeln der Menschen
16bestimmen, der Islam oder das durch Missionare importierte Christentum. Religion ist aus
Afrika nicht weg zu denken.4 Übrigens muss an dieser Stelle deutlich gesagt werden, dass
es DAS Afrika5 nicht gibt und somit schon der Versuch, EINE afrikanische Theologie zu
benennen, schwer fällt. Daher beziehen sich alle weiteren Aussagen, die die afrikanische
Theologie betreffen, erst einmal auf das zentralafrikanische Umfeld, in dem Burundi liegt.
Bezüglich christlich-afrikanische Theologie wird im Buch des kongolesischen Bischofs
Bimwenyi-Kweshi deutlich, wie schwierig es für afrikanische Theologen war, eine
eigenständige Theologie zu finden, die sich von kolonialistischen Zügen befreit und zu
einer genuin afrikanischen Anwendung gelangen kann (vgl. Bimwenyi- Kweshi 1982). Es
fiel dieser Theologie schwer, wie Bimweny-Kweshi es schreibt, von diesen „kulturellen“
Fragen des Ablösens wegzukommen und sich auf aktuelle sozio-ökonomische Fragen zu
konzentrieren (a.a.O.:71).
Der burundische Theologe Ndabiseruye macht dagegen deutlich, dass es schon in den
1970er Jahren eine von der lateinamerikanischen Befreiungstheologie inspirierte Theologie
in Afrika gab, die forderte, sich weniger an einer, wie der Kameruner Metogo es nannte,
„statischen Sicht von Kultur und Geschichte“ zu orientieren (Ndabiseruye 2009: 200).
Ndabiseruye erklärt, dass es im Suchen nach einer eigenständigen Theologie anfänglich
eine Art „black is beautiful“ Bewegung gab, die dann in den 1950er Jahren versuchte, eine
in den afrikanischen Traditionen verwurzelte, also indigene, Theologie zu entwerfen
(a.a.O.: 195ff.). Nach einer Findungsphase in den 1960er Jahren entstanden in den 1970er
Jahren Arbeiten, die versuchten, „die christliche Botschaft im Hinblick auf die afrikanische
Tradition und mit Hilfe von Humanwissenschaften fachgemäß und systematisch neu zu
durchdenken“ (a.a.O.: 200). Daraus resultierend gab es dann erste Äußerungen, die
vorsahen, dass Unterdrückung nicht nur im Kulturbereich stattfand, sondern es eine
Ausbeutung des Volkes auf verschiedenen Ebenen durch Medien oder multinationale
Gesellschaften gab (a.a.O.: 201). Der Kameruner Soziologie- und Theologieprofessor
Jean-Marc Ela setzt in diesem Zusammenhang auf einen umfassend befreienden Gott,
macht aber gleichzeitig deutlich, dass es wichtig sei, „christliche Botschaft von ihrem
4
Wie Ellis/Ter Haar schreiben, durchzieht Religion viele afrikanische Gesellschaften und oft ist
demokratische und politische Macht nicht von Religion zu trennen. Sie beschreiben, wie politische Macht
sich immer wieder charismatischer religiöser Führer bedient, um von deren Glanz zu profitieren (Ellis/Ter
Haar 2004: 99ff.). Im Umkehrschluss kann man sagen, dass Religion somit zum Erhalt des Status quo
beiträgt, wenn sie sich in dieser Weise instrumentalisieren lässt und somit, wie Freire sagen würde, zur
Unterdrückung beiträgt.
5 „Il n‘y a pas une Afrique, mais bien des Afriques.“ (adpf: 35) Daraus kann man folgern, dass es auch nicht
DIE afrikanische Gesellschaft gibt, oder DIE afrikanische Theologie, denn es ist notwendig „de reconnaître l‘
enorme diversité de l‘ Afrique […] qui représente une extraordinaire varieté de peuples, de cultures,
d‘économies, d’histoires et de géographies.“ (a.a.O.: 34f.)
17Eurozentrismus zu lösen, damit sie im afrikanischen Kontext wirksam wird“ (a.a.O.: 202).
Für Ela ist klar, dass die christliche Botschaft auf die Strasse muss und sich an den
Lebensumständen der Gläubigen reiben muss.6 Allerdings bleibt es für die afrikanische
Theologie eine Spannung, wie Kultur, Mission und Befreiung miteinander vereinbar sind
(a.a.O.: 203ff.). Deutlich wird, dass in der afrikanischen Theologie der Befreiung keine
marxistischen Bezüge und Grundlagen vorhanden sind, wie sie in der lateinamerikanischen
Ausprägung zu finden sind – und oft als Kritikpunkt verstanden wurden (vgl. Punkt 2 a).
Ela macht in diesem Zusammenhang sehr deutlich: „How could one make the blanket
assertion, with the nineteenth century in full swing, that religion is the opium of the people,
when in Africa, in the age of empires, the religious element was the locus of the combat for
the liberation of the oppressed?” (Ela 1986: 46) Nachdem er die Wichtigkeit der
„religiösen Bewegungen“ im kulturellen, politischen und sozialen Zusammenhang deutlich
gemacht hat, resümiert Ela: „When all is said and done, it is the sphere of the religious in
the history of modern Africa that appears as the locus par excellence of the cultural
confrontation and political combat.“ (a.a.O.: 47) Im afrikanischen Kontext geht es also
vielmehr um eine „Befreiung von einer Armut, die radikaler und schlimmer ist als die
materielle Armut, nämlich der kulturellen und anthropologischen Armut.“ (Ndabiseruye
2009: 206) Diese Armut ist die Folge der Kolonialisierung, die Identität und kulturelle
Verwurzelung geraubt hat (vgl. ebd.). Ndabiseruye schreibt weiter: „Darin liegt der
Unterschied zur lateinamerikanischen Befreiungstheologie, die den Akzent v.a. auf die
sozialökonomische Armut setzt.“ (ebd.) Dennoch möchte diese Theologie dafür kämpfen,
„dass Männer und Frauen unserer Zeit zu den Architekten ihrer eigenen Zukunft werden“
(a.a.O.: 207), indem sie „das Volk auf der Suche nach Würde, Lebenssinn und erfülltem
Menschsein“ (ebd.) begleiten.7
An dieser Stelle sei noch ein Wort zu den anderen „Schwarzen Theologien“ erlaubt. In
Nordamerika und Südafrika hatte sich vor allem als Reaktion auf die Unterdrückung der
6
„One thing is clear: We can no longer understand and live our faith apart from a context of liberation of the
oppressed. It is here, that we must reinterpret the whole of the revealed message, here that we must rethink
the church and its mission, here that we must redefine the lifestyle of our evangelical communities in
society.” (Ela 1986: 94)
7
Eine in den Jahren 2009 und 2010 vom Autor mündlich durchgeführte Befragung von rund 30 ehren- und
hauptamtlichen Mitarbeitern verschiedener Kirchen Burundis zeigt allerdings, dass diese Armut vollkommen
anders sehen. Auf die Fragen „Was ist Armut?“ und „Warum existiert sie?“ antwortete kein einziger in eine
Richtung, die auf solch eine strukturalistische Antwort wie den durch die Kolonialisierung herbeigeführten
Identitätsverlust hindeutet. Alle Befragten verorteten das Wesen von Armut im sozio-ökonomischen Bereich.
Die Frage nach der Herkunft wurde verschieden gesehen – neben Armut als Folge von Krieg werden
Klimaänderung und auch individuell-strukturelle Gründe wie zu niedrige Bildung und Mangel an modernen
Arbeitstechniken genannt. Nichtsdestotrotz macht diese Aussage Ndabiseruyes deutlich, auf welcher Ebene
afrikanische Theologen Befreiung konzeptionell denken und sehen.
18schwarzen Hautfarbe eine „Black Theology“ herausgebildet. Diese „Schwarzen
Theologien“ sind somit auch kontextuelle Theologien, jedoch vor allem gegen
Rassendiskriminierung ausgerichtet (Ndabiseruye 2009: 201).
In Südafrika fand die gegen die Apartheid gerichtete Theologie 1985 ihren Höhepunkt in
der Erstellung des „Kairos-Dokuments“, das in den Schwarzen Townships Südafrikas mit
Freuden aufgenommen wurde: „They [ordinary Christians in the Black Townships of
South Africa, d.Verf.] are saying that the Kairos document gives articulate expression to
what they believe as Christians about the present struggle for liberation in South Africa.“
(Kairos 1986: o. Seitenangabe). 152 Theologen aus verschiedensten Kirchen hatten dieses
Dokument erarbeitet, um sich gegen eine Kirche zu stellen, die Unterdrückung stützt und
somit Machtverhältnisse stabilisiert.
2.4. Situationsbeschreibung zum Verhältnis Kirche und Armut in Deutschland8
„Johannes Warmbrunn, Sprecher des Diözesanrats, warnte vor einer Armutsspirale, die
junge Menschen in einen „verhängnisvollen Sog ins soziale Abseits“ ziehe. Zur
Gegenwehr brauche es bürgerschaftliches Engagement und neue Formen der
Solidarökonomie, beispielsweise in Genossenschaften, Tauschringen und
Bürgerstiftungen.“ (epd 2009: 1308) Warmbrunn nannte diese Interventionsmöglichkeiten
bei der Vorstellung einer sozialwissenschaftlichen Studie über arme Kinder und ihre
Familien in Baden-Württemberg. Kirche, in diesem Fall die katholische Kirche, sieht also
nicht nur die Notwendigkeit von Interventionen bezüglich Armut, sondern nennt auch neue
Organisationsformen. Auch die evangelische Kirche in Württemberg beschäftigt sich mit
diesem Thema und stellt dabei nicht nur fest, dass oft eigene Mitglieder von Armut
betroffen seien, sondern dass Initiativen wie die Tafeln nötig seien: „Keiner kann sie
wollen und doch sind sie nötig“, so Landesbischof July (epd 2009: 1339).
Welche Grundlagen und Probleme kann es in dieser kirchlichen Arbeit gegen Armut
geben?
2.4.1. Grundlagen
„Da die verschiedenen Gruppen der Armenbevölkerung auch in Zukunft nicht in der Lage
sein werden, eine wirksame Lobby zu entwickeln, brauchen sie Bündnispartner, die sie in
diesem Prozess aktiv unterstützen. Neben Selbsthilfeinitiativen der Betroffenen im engeren
Sinne sind daher nicht zuletzt die Verbände und Träger ebenso wie die Fachkräfte der
8
Diese Situationsbeschreibungen stammt auszugsweise aus einer Modulabschlussarbeit des Autors „Kirche
und gemeinschaftliche Bewältigungsstrategien zur Bekämpfung von Armut“, Juli 2009.
19sozialen Arbeit gefordert, als Partner und als Stimme der Armen sich öffentlich zu Wort zu
melden und sich für eine solidarische Bewältigung der aktuellen Strukturprobleme und für
die Überwindung von Armut einzusetzen.“ (Hanesch 2001: 39). Die Notwendigkeit zu
kirchlichem Engagement in Bezug auf Gemeinwesen und Arme wird aber nicht nur
sozialwissenschaftlich angemahnt, sondern ist auch theologisch gegeben. Die EKD
argumentiert dazu negativ, in dem sie beschreibt: „Eine Kirche, die auf das Einfordern von
Gerechtigkeit verzichtet, deren Mitglieder keine Barmherzigkeit üben und die sich nicht
mehr den Armen öffnet oder ihnen gar Teilhabemöglichkeiten verwehrt, ist […] nicht die
Kirche Jesu Christi.“ (EKD 2006: 15) Eine tiefere biblisch-theologische Reflexion passt
nicht in das Konzept dieser Arbeit, gleichwohl sei dem/der interessierten Leser/in die eben
zitierte Denkschrift empfohlen, hier vor allem ab Seite 46. Die Argumentation der EKD
mündet in die Feststellung: „Die enge Verbindung von sozialer Frage und Gottesfrage hat
in der Kirche durch die Jahrhunderte hindurch bis heute immer zu einem besonderen
Eintreten für die Armen geführt.“ (a.a.O.: 46) Der Auftrag zur Hilfe scheint klar und von
den Kirchen auch anerkannt zu sein, aber welches Problem gibt es bei der Umsetzung
dieses Auftrages?
2.4.2. Grundlegendes Problem
Das wohl wichtigste und von vielen Seiten genannte Problem ist, dass Kirche keinen
Zugang zu Armen hat. Schulz, die an der Erstellung der Studie, die die Grundlage für die
Gedenkschrift der EKD bildet, beteiligt war, schreibt dazu: „Jenseits des klassischen
Bildes einer helfenden Kirche mit Gratis-Mahlzeiten für Obdachlose und Almosen zeigt
die Studie, dass die klassische Kirchengemeinde in vielerlei Hinsicht nicht auf von Armut
betroffene Menschen eingerichtet ist: In Gottesdienst und Bibelkreis bleibe die
„bildungsbürgerliche Kerngemeinde“ unter sich – wie in der Gesellschaft, so auch in der
Kirchengemeinde blieben Arme unsichtbar.“ (Schulz 2007, Hervorhebung im Original)
Die EKD nimmt dies auf und schreibt „Ärmere Menschen sind in vielen christlichen
Gemeinden in Deutschland wenig oder gar nicht sichtbar“ (EKD 2006: 75).
Das Diakonische Werk beschreibt es so: „Oft haben sie [die Kirchengemeinden, d. Verf.]
längst ein Selbstverständnis der „Kirche für andere“ (Proexistenz) entwickelt und sind mit
diakonischen Angeboten präsent (Hausaufgabenhilfe, Sprachkurse, Tafeln,
Kleiderkammern etc.). Gemeinwesendiakonie9 entwickelt dieses Verständnis weiter zu
9
Gemeinwesendiakonie bedeutet, dass lokale Kirchengemeinde und lokale diakonische Einrichtung sich in
ihrem Engagement gegenseitig unterstützen, in dem „gemeinsames Handeln von diakonischer Gemeinde und
gemeinwesenorientierter Diakonie vor Ort sichtbar wird.“ (vgl. Diakonisches Werk 2007: 6)
20einer „Kirche mit anderen“ (Konvivenz), in der die Zielgruppen zur Hilfe zum eigenen
Handeln ermutigt und bei der Organisation von Selbsthilfe unterstützt werden.“
(Diakonisches Werk 2007: 26f.) Als Kritikpunkt wird deutlich: Kirche hat einen
Schwerpunkt auf das Kümmern um die Armen gelegt, aber diese weniger motiviert (oder:
empowert), sich selbst zu organisieren und mit ihnen gemeinsam Kirche zu bauen.
2.4.3. Gesellschaftsrelevanter Gemeindebau
An dieser Stelle möchte ich auf die Haltung der radikalen Evangelikalen zurückkommen.
Ich beziehe mich dabei auf Johannes Reimer, der für die westliche Welt eine Theologie des
gesellschaftsrelevanten Gemeindebaus entwickelt hat. Reimer hat, neben diesen
Erfahrungen in der westlichen Welt, Erfahrungen im gesellschaftsrelevanten Gemeindebau
in den Slums Amerikas und Afrikas sammeln können (vgl. Reimer 2009: 7f.). Für ihn ist es
wichtig, dass Gemeinden, da sie lokal verortet sind10, sich um Menschen ihres Umfelds
kümmern, sich für sie einsetzen und gemeinsam Glauben leben. Um herauszufinden,
welche Fragen diese Menschen beschäftigt, sieht er unter anderem sozialwissenschaftliche
Analysen als eine Möglichkeit, kontextuelle Theologie auf lokaler Ebene zu betreiben
(a.a.O.: 244f). Für ihn ist es wichtig, dass Gemeinde eine Vision entwickelt, die sich am
Konzept der integralen oder holistischen Mission11 einer Gemeinde oder Kirche orientiert
(vgl. a.a.O.: 235f.). Reimer baut sein Konzept weniger auf eine Befreiung der Armen oder
Unterdrückten auf, macht aber deutlich, dass je nach Kontext, in der sich die Gemeinde
befindet, dies ein Auftrag für eine lokale Gemeinde sei. Für den westlichen Kontext kann
dies bedeuten, Sprachkurse für Migranten anzubieten (ebd.), Häuser ärmerer Menschen zu
renovieren (a.a.O.: 262) oder Kontaktbüros aufzubauen (a.a.O.: 264). Ausgangspunkt all
dieser Initiativen ist, dass Gemeinde sich den Bedürfnissen der Menschen an dem Ort, an
dem sie sich befindet, stellt (a.a.O.: 235). Somit wird eine Kirche, die in ihrem sozialen
Umfeld viele Arme hat, sich diesen auch widmen und mit ihnen gemeinsam nach
Lösungen suchen. Dieses Konzept kann theologisch und praktisch auch in Burundi
angewandt werden, doch dazu später mehr (vgl. Kapitel 5.3.).
10
Der lateinische Begriff Kirche ist „ecclesia“ und bedeutet im wörtlichen Sinn „Versammlung“. Da
Versammlungen von Menschen einen Ort brauchen, hat Kirche im Sinne Reimers immer und zuerst einen
lokalen Aspekt (vgl. Reimer 2009: 36ff.).
11
Holistische oder ganzheitliche oder integrale Mission bedeutet, dass Gemeinde oder Kirche ihren
diakonischen Auftrag mit ihrem wortverkündenden Auftrag verknüpft. Beide Aufträge müssen Hand in Hand
in ein Konzept einfließen, damit Gesellschaft verändert wird (vgl. Myers 2008: 134ff. oder Reimer 2009:
171ff.).
213. Bewältigungsstrategien
3.1. Individuelle Bewältigungsstrategien
Genauso unterschiedlich wie die Gründe für Armut sind die individuellen
Bewältigungsstrategien, die Menschen finden und anwenden, um mit ihrer Lebenslage
zurechtzukommen. Hanesch nennt für den westlichen Kontext hierzu nicht nur fünf
zeitliche Typen, in die kategorisiert werden kann, sondern er nennt auch Kategorien, die
das individuelle Verhalten und Erleben widerspiegeln. (vgl. Hanesch 2001: 31). Hierzu
führt er verschiedene individuelle Bewältigungsstrategien an: „Sie reichen vom Typus des
„ewigen Verlierers“ (passives Erleiden) über den „notgedrungenen Verwalter“ (mit
neutraler Überbrückerhaltung), den „pragmatischen Gestalter“ (der aus der Misere das
Beste zu machen versucht), den „strategischen Nutzer“ (mit übergreifender subjektiver
Perspektive) bis zum „aktiven Gestalter der aktuellen Lebenssituation“.“ (ebd.) Hanesch
unterstreicht weiter, dass die Kenntnis dieser Bewältigungsstrategien wichtig sei, denn sie
relativiere „das gängige Bild einer quasi-automatisch verfestigten Armutskarriere mit
begleitenden psycho-sozialen Deformationen“ (ebd.). Auch dürfe nicht gefolgert werden,
dass Zufriedenheit mit Sozialhilfebezug eine Lösung des Armutsproblems sei (ebd.).
Die Untersuchungen von Meier et al., die allerdings eine andere Typologisierung zugrunde
legen12, zeigen unter anderem, wie kreativ Lösungen sein können und wie sich die
Menschen keineswegs mit ihrer Lage und den von den Ämtern vorgegebenen Lösungen
abgeben, sondern mit starkem Willen und Kreativität ihr Leben selbst in die Hand nehmen
und somit ihre Lage ändern können (vgl. dazu vor allem den Typ des vernetzten Aktiven in
Meier et al. 2003: 296ff.).
Leibfried und Leisering, die wiederum eine eigene Typologie entwickeln,13 kommen zum
Schluss, dass Sozialhilfe (oder eine Lebenssituation in Armut) von den Beziehern
unterschiedlich genutzt würde und die Bezieher unterschiedlich handelten. „„Handeln“
oder „Gestalten“ heißt nicht, daß sich die Betroffenen über einengende äußere
Bedingungen oder über Grenzen ihrer Handlungsfähigkeit schlicht hinwegsetzen könnten.
Es bedeutet aber, daß Personen unter vergleichbaren Bedingungen ganz unterschiedliche
Wege einschlagen können.“ (Leibfried/Leisering 1995: 185f., Hervorhebung im Original)
Für den afrikanischen Kontext sind diese Aussagen sicher nicht in gänzlicher Analogie
übertragbar. Dennoch wird deutlich, dass es auch in diesem Umfeld ein unterschiedliches
Erleben von und einen unterschiedlichen Umgang mit Armut gibt. Dieses Phänomen wäre
12
Typ 1: Die verwalteten Armen, Typ 2: Die erschöpften EinzelkämpferInnen, Typ 3: Die ambivalenten
JongleurInnen, Typ 4: Die vernetzten Aktiven (vgl. Meier et al. 2003: 296).
13
Sie unterscheiden: „Opfer“, „Problemverwalter“, „pragmatische Gestalter“ und „aktive Gestalter“ sowie
„strategische Nutzer“. (Leibfried/Leisering 1995: 178).
22sicher eine eingehendere Untersuchung wert, helfen solche Typologisierungen doch nicht
nur Außenstehenden und Helfern, differenziert zu sehen, sondern auch den Betroffenen
selbst, zu erkennen, dass es unterschiedliche Qualitäten und Umgangsweisen mit einer
solchen Lebenssituation gibt. Kann diese Einsicht doch bewirken, dass das Netz der
Lügen, das die Armen umgibt und durch das ihre Nichtigkeit und Abhängigkeit
unterstrichen wird (vgl. dazu Freire 1973: 59ff.), durch praktische Beispiele aus dem
eigenen Lebensumfeld zerrissen wird.14
Cremer-Schäfer macht deutlich, dass hierzu Ressourcen nötig sind, wenn sie unter Bezug
auf den Wohlfahrtsstaat schreibt: „„Wohlfahrt“ heißt danach auf der gesellschaftlichen
Ebene einfach das Bereitstellen von Ressourcen, mit denen soziale Akteure schwierige
Situationen bewerkstelligen können.“ (Cremer-Schäfer 2005: 20f.) Da diese staatliche
Intervention in Burundi nicht existiert, bleibt die Frage: Wer ist derjenige (in Friedmanns
Terminologie: wo sind die sozialen Organisationen), der diese Ressourcen bereitstellt? In
unserem Fall wird aus dem bisher Dargestellten deutlich, dass die Kirche eine solche
Institution sein kann und muss.
3.2. Gemeinschaftliche Bewältigungsstrategien
Neben den individuellen Bewältigungsstrategien gibt es im westlichen Kontext auch
gemeinschaftliche Bewältigungsstrategien. Ich möchte betonen, dass die Lösung
individueller Armut – neben dem Angehen und Anmahnen der strukturellen Ursachen
durch sozialpolitische Maßnahmen – auch durch sozialpädagogische Intervention im
individuellen Bereich liegen müssen. Diese individuellen Lösungen und Bewältigungen zu
bündeln und in eine gemeinschaftliche Bewältigungsstrategie zu führen, kann eine weitere
Aufgabe Sozialer Arbeit sein. Ich teile die Auffassung Kunstreichs, dass
Gemeinwesenarbeit bei der Mobilisierung und Begleitung der Betroffenen eine wichtige
Rolle spielt, indem Gemeinwesenarbeit definiert wird „als Arbeitsprinzip, das Partizipation
der Akteure an ihren eigenen Angelegenheiten unterstützt und so zur Praxis der Aneignung
des Sozialen wird“ (Kunstreich 2005: 106). Kunstreich fordert dann „die Vermittlung von
analytischer Perspektive mit der des kooperativen Handelns“ (ebd.) und benennt als
mögliche kooperative Maßnahme zur Bekämpfung von Armut Sozialgenossenschaften.
Weitere gemeinschaftliche Maßnahmen, die gegenwärtig in der westlichen Welt diskutiert
14
Ein aktuelles Armutskonzept baut auf diesem Gedanken des Lügennetzes auf. Der Inder Jayakumar
Chritsian schrieb in den 90er Jahren, dass eine Vorraussetzung für Empowerment sei, dass dieses Lügennetz
durchrissen würde (vgl. dazu Myers 2008: 76f.f).
23und praktiziert werden, sind unter anderem das System der Tauschringe15 und der Tafeln.
Letzteres ist meines Erachtens für die Betroffenen selbst allerdings nur selten ein
partizipatives System, sondern eher eine gesellschaftlich-kooperativ organisierte
„Zusatzversorgung“ Armer, da in dieser achtenswerten Initiative gerade das Moment der
Selbstorganisation der Betroffenen oft fehlt. Die Zugangsvoraussetzung zu einer Tafel ist
in der Regel eine Hartz IV-Bescheinigung, also ein Element aus dem Ressourcen-Ansatz
der Armutstheorien. Ziel gemeinschaftlicher Maßnahmen ist es hingegen, den Betroffenen
zu helfen, sich zusammenzuschließen und mit ihren Kräften und Gaben eine Lösung ihrer
aktuellen Lage zu suchen – sei es entweder auf ökonomischer oder auf sozialer Ebene.
Wichtig ist, dass in diesen gemeinschaftlichen Bewältigungsstrategien deutlich wird, „dass
es immer der aktuelle Zusammenhang von Not und Selbstorganisation ist, der Inhalt und
Ausprägung solidarischer Aktionen erklärt, dass es jeweils die aktuellen sozialen Konflikte
sind, die Selbstorganisationen der Machtunterworfenen oder Ohnmächtigen hervorbringen
– wenn sie Hoffnung auf Veränderung haben. Hunger allein führt zum Verhungern, nicht
zur Selbstorganisation. Es sind vielmehr existenziell wichtige, bewegende Fragen, die
Menschen dann dazu bringen sich zusammenzuschließen, wenn sie eine gemeinsame
Option haben.“ (a.a.O.: 108)
Für den Dritte-Welt-Kontext nennt Myers einige Methoden, die dazu dienen, community
zu entwickeln (vgl. Myers 2008: 168-182).16 Für Myers ist klar: Da der Bezugspunkt der
Armutstheorie ein Haushalt ist, müssen Bewältigungsstrategien auch auf dieser Ebene
ansetzen (a.a.O.: 58f.). Der Einzelne ist bei existentieller Armut zu schwach, sie zu
bekämpfen, vor allem, wenn sie eben in Bezug zur Deprivation von Rechten gesetzt wird.
Auch Anthropologisch scheint es einfacher zu sein, für gemeinschaftliche
Bewältigungsstrategien zu plädieren, da der Begriff des Gemeinwesens und der erweiterten
15
Zur Vertiefung der Maßnahmen vgl. Kunstreich zu Sozialgenossenschaften, Hinz/Wagner zu Tauschringen
und www.tafel.de zu den Tafeln. Interessant ist, dass 2009 rund 25% aller Tafeln sich in kirchlicher
Trägerschaft befanden auch unter Namen wie Vesperkirche bekannt.
16
Für eine detaillierte Darstellung der entsprechenden Techniken sei auf das genannte Kapitel in Myers Buch
verwiesen.
24sozialen Umgangsform in den Kulturen17 der Dritten Welt ganz anders verankert ist, als in
unserem individualisierten westlichen Kontext.18
Ein weiteres, sowohl für den westlichen als auch für den Kontext der Dritten Welt
fruchtbar gemachtes System, ist die Theorie des sozialen Kapitals. Vereinfacht gesagt, ist
soziales Kapital das Netzwerk, das jeder Mensch hat. Ein Netzwerk, das ihm dann hilft,
wenn es Schwierigkeiten und Situationen gibt, mit denen der Einzelne nicht zurechtkommt
und alleine nicht fertig wird (vgl. Koob 2007: 15). Kapital ist unter dieser Prämisse in
erster Linie nicht monetär zu sehen (wie es zum Beispiel in gemeinsamen Kapitalformen
wie Genossenschaften gemacht wird), sondern es äußert sich in den Erscheinungsformen
Vertrauen, Normen, Beziehungen und Nimmkraft nieder (vgl. dazu Früchtel et al. 2007:
88f.). Dass es bei der Bewältigung von persönlichen ökonomischen Krisen sich aber auch
finanziell bemerkbar machen kann, ist hier unbelassen. Ein weiterer Effekt sozialen
Kapitals zeigt sich dort, wo es dazu beiträgt, kollektive Probleme zu lösen oder
Zusammenhang und Integration zu schaffen (ebd.).
Ein Phänomen, das in diesem Zusammenhang zu nennen ist, ist die Beziehungsqualität, die
ein Individuum hat. Es werden zwei Typen unterschieden: starke Beziehungen (bonding =
tragende Beziehungen) und schwache Beziehungen (bridging = Brücken bauende). Starke
Beziehungen entstehen in der Regel im engsten sozialen Umfeld mit Menschen, die einen
ähnlichen sozialen Status haben oder zur Verwandtschaft gehören. Schwache Beziehungen
sind die, die man über andere Bekannte hat oder die in einer Gruppe oder Gemeinschaft
entstehen und deshalb Brücken in andere soziale Schichten bauen (vgl. Vervisch 2008:
45f.). Kirchen können unter anderem auch ein Ort sein, an dem sich ein solches Brücken
bauendes soziales Kapital bilden kann, da sich in ihr normalerweise Menschen mit
unterschiedlichem sozialem Status und mit einer gemeinsamen Basis (Glauben zu leben)
versammeln.
Hinsichtlich des Zwecks von sozialem Kapital gibt es in der Soziologie unterschiedliche
Auffassungen. Während James Coleman soziales Kapital eher als ausgleichendes
Instrument für Fehler des Markts (kapitalistischen Systems) und als Erklärung für
17
Wenn ich in dieser Arbeit den Begriff Kultur verwende, dann gehe ich vom Kulturbegriff Käsers aus:
„Kulturen sind Strategien des Menschen, sein Dasein zu gestalten und zu bewältigen.“ (vgl. Käser 2005: 9)
Ohne in eine Diskussion des Begriffs einzusteigen, möchte ich diese Wahl begründen: Diese Definition
erlaubt dem Menschen eine je nach geographischer, geschichtlicher und individueller Situation eigene
Lösung zu finden, die nicht statisch ist.
18
Der Ethnologe Käser argumentiert, dass Gruppen das Überleben des Einzelnen sichern und ihnen daher
eine besondere Rolle zukommt (vgl. Käser 2007: 87f.); der Anthropologe Hiebert beschreibt, wie der
westliche Individualismus im Kontrast zu vielen gemeinschaftlichen Lebensentwürfen steht und welche
Auswirkungen das etwa auf Eigentum oder Selbst-Wahrnehmung hat (Hiebert 2005: 124-127).
25Sie können auch lesen