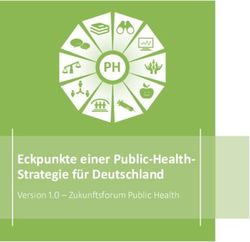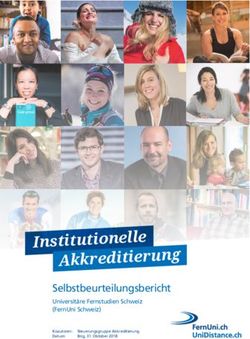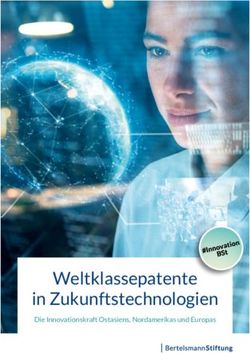Synthesebericht - Fastenopfer Strategie 2017 - 2022 Mid Term Review - August 2019 - Eigene Website selber ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Fastenopfer Strategie 2017 - 2022
Mid Term Review
Synthesebericht
August 2019
Martin Sommer (Leitung)
Monika Egger Kissling2
Für die Einschätzungen und Aussagen im vorliegenden Bericht ist ausschliesslich das
Reviewteam verantwortlich.
Kontakte des Reviewteams:
Martin Sommer Monika Egger Kissling
Geschäftsleiter devolutions gmbh ECES GmbH
Archivstrasse 8 Martin-Disteli-Strasse 55
CH – 3005 Bern
CH – 4600 Olten
Tel : +41 31 8492632
Mobile : +41 79 5005761 Tel. +41 62 296 44 78
devolutions@bluewin.ch Mobile: +41 76 436 21 38
www.devolutions.ch egger.consulting@bluewin.ch
Synthesebericht MTR der Fastenopfer Strategie 17-22 21.08.19Zusammenfassung Die Mid-Term-Review bestätigt die Ausrichtung der Strategie 2017-2022 von Fastenopfer auf Trans- formationsfragen, die Bündelung der Ressourcen auf ein klares Themenprofil, die Durchgängigkeit von Instrumenten und Ansätzen sowie eine schlanke, lösungsorientierte Struktur. Der grosse Kompass stimmt, auch wenn die Rahmenbedingungen für die Entwicklungszusammenarbeit inzwischen noch anspruchsvoller geworden sind. Fastenopfer setzt seine Strategie aktuell mit unterschiedlicher Dynamik um. Die Landesprogramme haben die strategischen Impulse in kontextspezifische Länderstrategien aufgenommen, bleiben thematisch aber breit und sehr differenziert. Sie dokumentieren mit Unterstützung der Abteilung Programmentwicklung die vielfältigen Resultate aus den Ländern, die Zielerreichung wird als hoch ausgewiesen. Es entsteht das Bild einer zwar heterogenen, aber insgesamt ergebnisorientierten Umsetzung der Strategie. Die Internationalen Programme haben viel Energie in den konzeptionellen Aufbau investiert, mit wenigen und oft punktuellen Resultaten. Die breiten Erwartungen an das neue Instrument haben dazu geführt, dass meist ohne strategische Allianzpartner unrealistisch hohe, nur ungenügend auf die IP-spezifischen Beiträge ausgerichtete Zielsetzungen formuliert wurden. Eine fruchtbare Zusammen- arbeit mit ausgewählten Partnerorganisationen in den Ländern ist nur teilweise gelungen, obwohl nachweislich eine Nachfrage besteht für die Verknüpfung lokaler Veränderungsprozesse mit dem internationalen entwicklungspolitischen Diskurs. Die Review zeigt auch, dass sich eine mittelgrosse Organisation wie Fastenopfer mit dem gleichzeitigen Aufbau von drei (anfänglich gar vier) inter- national ausgerichteten Programmen überfordert. Die Ressourcenausstattung für IP ist unter- kritisch. Zudem können sich nicht alle IP-Themenschwerpunkte auf eine kritische Masse an Programmerfahrung in den Ländern abstützen, es fehlt einzelnen IP damit an Bodenhaftung. 3 Die institutionelle Dynamik von Fastenopfer war geprägt von Umbruch und anhaltender Unruhe. Auf einen Direktionswechsel zu Beginn der Strategieperiode folgten strukturelle Reorganisationen in mehreren Schritten, insbesondere im Bereich Kommunikation. Das Zwischenergebnis zur Halbzeit der Strategie sind zwar formell schlankere Strukturen. Noch kaum erkennbar jedoch sind die funktionale Durchgängigkeit, das integrierte Zusammenwirken zwischen der IZA-Arbeit und der Kommunikation, dem Campaigning und Fundraising. Die Review ortet Handlungsbedarf in der Förderung einer übergreifend kooperativen Betriebskultur, um eine konstruktive Dynamik in den neu geschaffenen Arbeitsgruppen als Bindeglieder zwischen Organisationseinheiten zu erzeugen. Die Nichterreichung der Finanzplanungsziele der Strategie ist von grundlegender Bedeutung für die gesamte Organisation und hat bereits zu einschneidenden Sparmassnahmen geführt. Für die künftige Finanzplanung sind Szenarien unumgänglich, besonders vor dem Hintergrund der neu gegründeten Allianzpartnerschaft mit 5 Schweizer NGOs. Fastenopfer sollte zudem das institutionelle Fundraising näher an der Geschäftsleitung ansiedeln als Teil der politischen Beziehungspflege. Die Herausstellungsmerkmale sind für die Marke Fastenopfer besonders wichtig. Als zukunfts- orientiertes Mitglied der katholischen Kirche kann sich Fastenopfer noch differenzierter abheben als modernisierende Kraft mit aufgeschlossenen Werten. Fastenopfer sollte sein inhaltliches wie regionales Profil konsequent schärfen, um als Organisation prägnanter erkennbar zu sein. Um zu den grossen Entwicklungsherausforderungen unserer Zeit einen effektiven Beitrag leisten zu können, ist Fastenopfer zudem als Allianzpartner gefordert, sich schrittweise zu spezialisieren, Opportunitäts- gewinne zu nutzen und seine Problemlösungskompetenz in der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zu erweitern. Kurz: Der strategische Kompass stimmt, die Magnetfelder lassen sich präzisieren und steuern. Synthesebericht MTR der Fastenopfer Strategie 17-22 21.08.19
Executive Summary
The Midterm Review confirms the overall orientation of the Fastenopfer Strategy 2017-2022 towards
transformational change, the pooling of resources for a crisp thematic profile, the comprehensive-
ness of instruments and approaches as well as a lean and effective organisational structure. The
overall direction of the compass is appropriate, though the context for international cooperation
has meanwhile turned even more exigent.
The strategy implementation by Fastenopfer follows diverse strokes. The country programmes have
incorporated the strategic guidance in their context-specific country strategies. Their thematic focus
however remains scattered and highly differentiated. The multifaceted results are systematically
documented with support by the programme development division, target achievement is reported
to be high. The image emerges of a heterogeneous but overall results oriented implementation of
the strategy.
The International Programmes have invested much energy in conceptual design, with few and often
punctual results. The broad corporate expectations towards this new instrument have resulted in the
formulation of unrealistic goals, detached from IP-specific contributions and often elaborated devoid
from potential alliance partners. A fruitful collaboration with selected national partner organisations
has emerged in some cases, though there is evident demand for a better linkage between local
change processes and the international development discourse. The review further concludes that
the concurrent setup of three (initially even four) international programmes goes beyond the
capacity of a mid-size organisation like Fastenopfer. The resource endowment for IPs is subcritical. In
addition, not all IP thematic core areas can build on a critical mass of programme experience in the
countries, some IPs lack adhesion.
4
The institutional dynamics in Fastenopfer were accompanied by radical change and sustained
disquiet. The change of leadership at the beginning of the strategy period was followed by structural
reorganisations in several steps, particularly in the Communication Department. The midterm result
at halftime of the strategy are formally leaner structures. But the functional comprehensiveness, an
integrated cooperation between Communications and other Departments are yet to materialise. The
review locates a need for action in the promotion of an overarching corporate culture of
cooperation. This in order to enable a constructive dynamic in the working groups established for
better linkage between organisational units. The non-achievement of strategic goals in fund raising is
of fundamental importance for the entire organisation. It has already led to drastic savings measures.
Future financial planning must be based on scenarios, more so in view of the new partnership
alliance with 5 Swiss NGOs. In addition, Fastenopfer should transfer the function of institutional
fundraising closer to management as part of external relations and corporate networking.
Fastenopfers’ unique selling propositions are of importance for the review of its brand name. As a
future oriented member of the Catholic Church, there is scope for Fastenopfer to further emancipate
as a modernising force with progressive values. Fastenopfer should consequently focus its thematic
and regional profile in order to feature prominently among organisations. Effective contributions
towards the main global development issues require that Fastenopfer engages in multi-partner
alliances, strives towards stepwise professionalization and learns how to benefit from opportunities
and growing problem solving competencies in institutional partnerships.
In short: The strategic compass fits, but instruments for implementation may be further specified and
better navigated.
Synthesebericht MTR der Fastenopfer Strategie 17-22 21.08.19INHALTSVERZEICHNIS
Zusammenfassung 3
Executive Summary 4
1. Woher wir kommen 6
1.1 Hintergrund der Strategie 2017-2022 6
1.2 Kontextveränderungen seit Beginn der Strategieperiode 6
1.3 Mandat und Fokus der MTR 7
1.4 Methodischer Ansatz 8
2. Benchmark: Strategieziele 2017-2022 8
3. Resultate, Folgerungen und Lehren zur Halbzeit 9
3.1 Organisationsdynamik als institutionelle Herausforderung 9
und Herausstellungsmerkmale
3.2 MTR der Landesprogramme 12
3.3 MTR der Internationalen Programme 15
3.4 MTR Programmentwicklung 19
3.5 MTR Kommunikation 20
3.6 MTR Finanzziele 27
4. Handlungsoptionen und Empfehlungen 29
5
Anhänge
1. Terms of Reference MTR 34
2. Dokumentation 54
3. Liste Interviewpartner 56
4. Balanced Scorecard Monitoring 2018 58
5. Präsentation Retraite GL Flüeli Ranft zur Führungskultur (3.7.2019) 63
6. Präsentationen GL zu den Ergebnissen der MTR, Luzern 66
(1.5.2019 und 11.7.2019)
7. Prozessdarstellung MTR 70
Synthesebericht MTR der Fastenopfer Strategie 17-22 21.08.191. Woher wir kommen
1.1. Hintergrund der Strategie 2017 - 2022
Der entwicklungspolitische Kompass für die „Strategie Fastenopfer 2017-2022: Wandel wagen -
globale Gerechtigkeit fördern“ steht auf dem Pfeiler der katholischen Kirche und ist auf die Ziele der
Agenda 2030 und dem Klimaabkommen ausgerichtet:
1. Die Kirche und das christliche Engagement von FO zur Überwindung von Armut, für soziale
Gerechtigkeit und die Verwirklichung der Menschenrechte, verankert in der katholischen
Soziallehre und umgesetzt in ökumenischer Offenheit und humanistischer Tradition.
2. Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, mit global geteilter Verantwortung für die
Transformation von Systemen hin zur Verringerung von Armut und Ungleichheiten,
verantwortungsvoller Nutzung der Lebensgrundlagen und Bewältigung globaler Risiken.
3. Das Klimaabkommen 2015 von Paris als völkerrechtliche Verpflichtung zum Klimaschutz und
der Anpassung von Wirtschaft und Ressourcenverbrauch an die Belastungsgrenzen der Erde.
FO versteht sich als Akteur, der sich im Rahmen dieser übergreifenden Agenda mit seinen Mitteln
und Möglichkeiten engagiert. Dabei legt FO besonderen Wert auf die Transformation in seinen
Programmen, aber ebenso als Prozess des eigenen Umdenkens in der Organisation und bei den
Mitarbeitenden. Während der Strategieformulierung hat sich bei FO eine hohe Identifikation heraus-
gebildet zwischen den Postulaten von Papst Franziskus (Laudato Si, 2015) und den Transformations-
zielen der UN-Agenda 2030.
6
1
Die externe Evaluation der Vorgängerstrategie 2011 – 2016 hatte empfohlen, dass FO (i) seine
Identität, Leitbild und Marke erneuert; (ii) eine straffe, formal und inhaltlich kohärente Zielhierarchie
aufbaut; (iii) auf zwei Kernthemen setzt, gestaltet aus der religiös-kulturellen Grundhaltung; (iv) ein
neues Geschäftsfeld für Transformationsprogramme (IP) einführt; (v) eine gesamtinstitutionelle und
akteurzentrierte Wirkungskette (Theory of Change) schafft; (vi) das Themenmanagement dialogisch
gestaltet; (vii) die Themenkonzepte einstellt und die Aufgaben von EPG entflechtet und integriert;
(viii) den Bildungsbereich auflöst, und (ix) den längst beschlossenen Schritt von Projekten zu
Programmen endlich wirksam vollzieht. Die meisten der Evaluationsempfehlungen wurden in der
neuen Strategie 2017-2022 aufgenommen und mit strategischen Zielsetzungen in einer Balanced
Score Card als übergreifendem Kompass für das strategische Monitoring verankert (vgl. Kap. 2:
Benchmark).
Der Erarbeitungsprozess der Strategie 2017-2022 wurde von einer institutionellen Führungskrise
begleitet, welche einen Direktionswechsel und die Neugestaltung des Führungsmodells nach sich
zog2. Dadurch mussten grundsätzliche strategische Richtungsentscheide teils neu gefasst werden und
der Abschluss der Strategieformulierung verzögerte sich. Die Erarbeitung der Länderstrategien wurde
dadurch nicht ausgebremst. Bei den frühen Konzeptarbeiten der IP ist jedoch eine zeitweilige
Kontinuitätslücke mit Orientierungsvakuum entstanden.
1.2. Kontextveränderungen seit Beginn der Strategieperiode
Das Umfeld für die internationale Zusammenarbeit und die Rahmenbedingungen für Schweizer NGOs
waren in den letzten Jahren einem raschen Wandel unterworfen. Die politische wie gesellschaftliche
1
Wenger B. (2015): Synthesebericht Evaluation der Fastenopferstrategie 2011-2016
2
Fastenopfer Operativer Jahresbericht 2016 (S. 44 ff)
Synthesebericht MTR der Fastenopfer Strategie 17-22 21.08.19Unterstützung für die humanitäre Hilfe der Schweiz bleibt hoch, sie schwindet aber für die inter- nationale Zusammenarbeit. Vermehrt wird gefordert, Entwicklungsgelder präventiv zur Migrations- eindämmung in Herkunftsländern einzusetzen. Solidarität wird mit Eigeninteressen der Schweiz verknüpft, geschürt durch Ängste vor wirtschaftlich begründeter Zuwanderung. Der Führungswechsel an der Spitze des EDA im 2018, anhaltend grundlegende Zweifel an der Wirksamkeit der bisherigen EZA, aber auch die Einsicht, dass die grossen globalen Herausforderungen nur mit Unterstützung des Privatsektors bewältigt werden könnten, haben zu einer Neuausrichtung der Schweizer EZA- Botschaft für die Jahre 2021-2024 geführt, welche zur Zeit in öffentlicher Vernehmlassung ist. Die schweizerische Entwicklungspolitik läuft dabei Gefahr, durch die Verknüpfung von Schweizer Wirtschaftsinteressen und der Migrationsagenda mit der EZA-Botschaft ihre Verpflichtungen aus der Agenda 2030 und dem Pariser Klimaabkommen zu unterlaufen und Entwicklungsgelder zweck- entfremdet einzusetzen. Diesen innenpolitischen Richtungskonflikt bekommen auch die NGOs zu spüren, sind sie doch Beitragsreduktionen und dem Druck zur Bildung von Allianzen ausgesetzt. Zudem schlägt der eher negativ konnotierte Diskurs in der Öffentlichkeit auch auf die Spendeneinnahmen durch. Die externe Evaluation der DEZA-NGO-Beziehungen hat allerdings auch bestätigt, dass die zivilgesellschaftlichen Organisationen eine wesentliche Rolle spielen in der Umsetzung der Schweizer Entwicklungsagenda und hat ihren Stellenwert damit gestärkt. Die Kontextveränderungen haben dazu geführt, dass FO mit einer Reihe von potentiellen Allianz- partnern die Möglichkeiten und Modalitäten für eine engere Kooperation thematisiert hat. Eine naheliegende strategische Partnerschaft mit Brot für alle im Rahmen der internationalen Programme hat sich nach aufwendigen Bemühungen im August 2018 zerschlagen. Weitere Allianzgespräche mit kirchlichen Organisationen blieben ebenfalls ohne Ergebnis. Im Juli 2019 wurde mit Swissaid und 4 7 weiteren Organisationen das MoU für eine Allianz für „Sustainable Food Systems and Empowered Communities“ vereinbart, das den Weg ebnen soll für eine DEZA-Programmunterstützung für die Jahre 2021-2024. Diese angestrebte Zusammenarbeit stellt zwar nicht die FO-Strategie als primäres Leitdokument in Frage. Sie wird aber ein hohes Mass an Flexibilität und Kompromissfähigkeit erfordern in der künftigen Umsetzung der Programme, da diese neu auch auf die Ziele und Leitplanken der Allianz ausgerichtet sein müssen. 1.3. Mandat und Fokus der MTR Die MTR soll aufzeigen, wo FO in der Umsetzung der Strategie steht, welche Resultate und Wirkungen bisher erzielt wurden und wo es Kurskorrekturen braucht. Der Fokus liegt dabei auf strategischem Lernen, der Ermittlung von Bereichen mit Handlungsbedarf und den Steuerungs- möglichkeiten, die sich zur Halbzeit der Strategie ergeben. Organisationale Fragen stehen nicht im Zentrum der MTR, da verschiedene Reformschritte, u.a. die Verschlankung der GL, die Reduktion von Abteilungen, der Ausbau von Arbeitsgruppen zur Förderung der Zusammenarbeit sowie der budgetbedingte Ausstieg aus 2 LPs und die Reduktion von 4 auf 3 IPs bereits vollzogen wurden. Eine Mitarbeitenden-Umfrage (2018) ergab, dass diese Reo-Schritte das Strategieziel der Vereinfachung von Strukturen bisher verfehlt hätten, da diese nach wie vor schwer- fällig, kompliziert, ineffizient und wenig kohärent seien. Die FO-Geschäftsleitung hat inzwischen darauf reagiert und die Funktion der Stv. Bereichsleitungen abgeschafft, die Anzahl Abteilungen im Bereich KOM reduziert und neue Arbeitsgruppen geschaffen. Synthesebericht MTR der Fastenopfer Strategie 17-22 21.08.19
Auch die MTR wurde im Verlauf der Datenerhebung immer wieder auf organisationale Probleme
aufmerksam gemacht. Obwohl im MTR-Auftrag nicht so vorgesehen, werden die wichtigsten
Erkenntnisse und Lehren zu Strukturfragen deshalb einleitend im Kap. 3 (Resultate, Folgerungen und
Lehren) thematisiert und der Zusammenhang mit den Herausforderungen in den Programmen, der
Kommunikation und dem Fundraising herausgearbeitet. Die TOR für das Mandat (FO übergreifend;
Teilbereiche LP, IP, Programmentwicklung und Kommunikation finden sich im Anhang 1.
1.4. Methodischer Ansatz
Die Informationsbasis für die MTR bilden die in den TOR aufgeführten Grundlagendokumente,
ergänzt durch zahlreiche Berichte und Quellenmaterialien (vgl. Dokumentenverzeichnis im Anhang
2). Eine zentrale Referenzgrösse ist dabei die BSC mit ihren strategischen Zielsetzungen und
Messgrössen sowie die interne Review der Zielerreichung der BSC.
Gearbeitet hat das MTR-Team mit einem Methodenmix aus Dokumentenanalyse, strukturierten und
dezentral durchgeführten Selbstevaluationen in den Ländern, teilstrukturierten Einzel- und Gruppen-
befragungen bei FO-internen Verantwortlichen, KoordinatorInnen und externen Partnern, einer
teaminternen Selbstevaluation von PRE mit standardisierter Umfrage bei Kooperationspartnern,
Gesprächen mit FO-Stakeholdern der Kirche und mit anderen Hilfswerken. Eine Übersicht der
Interviewpartner findet sich im Anhang 3.
Die MTR hatte nicht zum Ziel, eine umfassende externe Bilanz von Resultaten und Wirkungen in den
Programmen mit signifikanten Aussagen zur Zielerreichung oder dem Kosten-Wirkungsverhältnis
vorzulegen. Sie richtete jedoch den Blick auf auffällige Muster in der Gestaltung und Umsetzung von
Programmen sowie auf erkennbare Erfolgsfaktoren und Schwierigkeiten. Damit werden Tendenzen
sichtbar gemacht, welche für die zweite Hälfte der Strategieperiode von FO verstärkt oder aber 8
gezielt mit Massnahmen gesteuert werden können.
2. Benchmark: Die Strategieziele 2017-2022
Der Referenzrahmen für diese MTR sind die Strategieziele 2017-2022sowie die dazu gehörige
Balanced Score Card (BSC) mit den ausdifferenzierten Zielen und Messgrössen.
In der Strategie 2017-2022 verfolgt Fastenopfer eine anspruchsvolle Ausrichtung mit der Absicht
die Tätigkeit kohärent auf Transformation auszurichten,
die Themen zu konzentrieren und die Geschäftsfelder zu schärfen,
das fachliche Profil zu stärken,
die Durchgängigkeit der inhaltlichen Arbeit zu verbessern und einen Campaigning-Ansatz in die
Planung zu integrieren,
die finanzielle Basis durch neue Zielgruppen im Fundraising und durch Kooperationen zu stärken,
neue Multiplikator/innen-Netze aufzubauen, um den Verlust in den Kirchenstrukturen
auszugleichen,
die Strategie weniger komplex zu formulieren und sie auf Ziele auszurichten, die in sechs Jahren
erreichbar sind;
die Strukturen zu vereinfachen und eine stärker lösungsorientierte Organisationskultur zu
fördern.
Synthesebericht MTR der Fastenopfer Strategie 17-22 21.08.19Die BSC dient FO als Kompass für das strategische Monitoring. Darin sind insgesamt 24 Strategieziele
konkretisiert mit Messwerten (Ist- und Zielgrössen) und zugeordneter Verantwortung aufgelistet. Die
24 Ziele teilen sich auf in die Kategorien Zielgruppen (Ziele 1-4), Partner (Ziele 5-9), Prozesse (Ziele
10-16), Finanzen (Ziele 17-20) und Potentiale (Ziele 21-24). Die Bereiche und Abteilungen nehmen
jährlich in der BSC eine Einschätzung vor, wie sie punkto Zielerreichung unterwegs sind (s. Anhang 4).
In den Jahresberichten wird systematisch über die Strategieumsetzung und die erreichten Resultate
informiert und steuerungsrelevante Erkenntnisse für die weitere Planung werden festgehalten.
Der Übergang von der früheren zur aktuellen Strategie 2017-2022 war von einer institutionellen
Dynamik mit dem Wechsel der Direktion und einer Reorganisation mit Verschlankung der Strukturen
begleitet. FO fokussiert seither die Programme auf zwei thematische Schwerpunkte „Recht auf
Nahrung“ und „Nachhaltiges Wirtschaften“ sowie auf das Transversalthema „Gender“ und setzt
damit eine Empfehlung aus der Evaluation der vorherigen Strategie 2011-2016 für mehr thematische
Konzentration um. Auch die Empfehlung, die Organisationsstruktur der neuen Strategie anzupassen
wurde umgesetzt mit der Reduktion von fünf auf drei Bereiche und der Neuzuordnung von Aufgaben
in den neuen Strukturen. Auf diesem Hintergrund stellt der vorliegende MTR-Synthesebericht auf
rund zwei Jahre der effektiven Strategieumsetzung ab.
3. Resultate, Folgerungen und Lehren zur Halbzeit
9
3.1 Institutionelle Herausforderungen, Organisationsdynamik und Herausstellungsmerkmale
Organisationsdynamik als institutionelle Herausforderung
Struktur- und Führungsfragen waren nicht Teil des Auftrages dieser MTR. Bei der Datenerhebung
wurde von Interviewpartnern jedoch regelmässig auch auf institutionelle Herausforderungen
hingewiesen. Diese wirken sich nach Einschätzung der MTR auf die Umsetzung der Strategie aus, so
dass hier kurz darauf eingegangen wird, ohne dass die MTR jedoch Empfehlungen zu Struktur oder
Führung3 formuliert.
Die Strategie 2017-2022 wurde unter dem vorherigen Geschäftsleiter erarbeitet, der FO Ende Juli
2016 verliess. Die Fertigstellung der Strategie erfolgte unter der ad-interim Geschäftsleitung des
Bereichsleiters Kommunikation, bis am 19. April 2017 der neue Geschäftsleiter übernahm. Gleich-
zeitig mit der Einführung der Strategie leitete FO im Oktober 2016 eine Reorganisation ein und stellte
in Aussicht, die neue Struktur nach zwei Jahren auszuwerten und wo nötig Anpassungen
vorzunehmen. 2018 erfolgte eine umfassende Mitarbeitendenbefragung mit relativ kritischen
Rückmeldungen zur Führungskultur. Für die Auswertung der Reo wurde im September 2018 wie
geplant die Arbeitsgruppe Wandel4 geschaffen. Sie hat in einer internen Evaluation die Erkenntnisse
aus der Reo Oktober 2016 und der MA-Befragung 2018 ausgewertet und Massnahmen für die
Verschlankung der GL und die Verbesserung der internen Zusammenarbeit und der Führungskultur in
die Wege geleitet. So wurde die Geschäftsleitung per 1.3.2019 um zwei Personen verkleinert und
besteht neu aus vier Personen: Geschäftsleiter; Bereichsleiter Internationale Zusammenarbeit und
3
Das MTR-Team wurde eingeladen, an der Retraite der erweiterten Geschäftsleitung von Fastenopfer in Flüeli-
Ranft am 3. Juli 2019 ihre Eindrücke zur Führungskultur zu präsentieren (Präsentation im Anhang 5)
4
Der AG Wandel gehören fünf Personen an: der Direktor, der Leiter IP (damals auch Co-Leiter IZA), die Leiterin
TBP (nach deren Weggang ersetzt durch die Leiterin Service, Information und Publikation), die Bereichsleiterin
Finanzen und Personal und die Leiterin PRE. Die Gruppe begleitet auch die MTR.
Synthesebericht MTR der Fastenopfer Strategie 17-22 21.08.19stellvertretender Geschäftsleiter; Bereichsleiter Kommunikation und Bereichsleiterin Dienste. Aus
der Geschäftsleitung ausgeschieden ist
die Co-Bereichsleiterin Kommunikation,
die FO verlassen hat und der Co-
Bereichsleiter Internationale
Zusammenarbeit, der Abteilungsleiter
Internationale Programme beim FO
bleibt. Per 1.4. 2019 erfolgte eine „Reo
der Reo 2016“ im Bereich KOM mit der
Verkleinerung von fünf auf drei
Abteilungen (vgl. Organigramm
1.6.2019). Zudem wurden neue
Arbeitsgruppen geschaffen, um die
bereichs- und abteilungsübergreifende
Zusammenarbeit zu stärken. Weitere
Abgänge standen in direktem oder
indirektem Zusammenhang mit den
Reorganisationen. Aktuell ist die Stelle der Leitung Fundraising neu zu besetzen.
Folgerung Institutionelle Herausforderungen: Die MTR hält fest, dass organisatorische und
personelle Wechsel bei Fastenopfer in dieser hohen Kadenz mit Unruhe und Verunsicherung
einhergehen und es für die zweite Hälfte der Strategieumsetzung wichtig ist, dass Ruhe und Konstanz
einkehren.
(keine Empfehlung)
10
Herausstellungsmerkmale
Die Evaluation der Vorgängerstrategie hat empfohlen, als Teil der Umsetzung der Strategie 2017-
2022 auch das veraltete Leitbild sowie die Marke Fastenopfer zu überdenken. Deshalb hat die MTR in
ihrer Erhebung darauf geachtet, nebst der Zielerreichung auch die wesentlichen Herausstellungs-
merkmale zu erfassen. Diese bilden einen wichtigen Grundstock für das Profil von Fastenopfer und
für Allianzen und Partnerschaften. Sie bedingen jedoch auch eine reflektierte und (selbst)-kritische
Auseinandersetzung sowie Anpassung an das sich veränderte Umfeld. Der laufende Prozess der
Neudefinition der „Marke Fastenopfer“ ist eine Chance, die Alleinstellungsmerkmale noch besser in
Wert zu setzen.
Katholisches Familienmitglied
Die Zugehörigkeit zur katholischen Kirche ermöglicht das Teilen der Werte und Grundsätze der
katholischen Soziallehre und die Einbindung in weitreichende Netzwerke (CIDSE). Als katholisches
Hilfswerk hat FO direkten Zugang zu den kirchlichen Strukturen und versteht die in den Pfarreien
wirkenden engagierten Personen (Priester, Katechetinnen) als ihre „Multiplikatoren“. Die MTR
erhielt den Eindruck aus den Gesprächen mit PfarreivertreterInnen, dass FO vor allem während der
Ökumenischen Kampagne präsent sei und übers Jahr kaum wahrgenommen wird. Auf nationaler
Ebene hat FO Kontaktpotential über seine Vertreter der Schweizerischen Bischofskonferenz (SBK) im
Stiftungsrat, namentlich über den SR-Präsidenten, der die SBK präsidiert. Auch im Stiftungsforum
sind Personen vertreten, welche nationale und internationale Kontakte in Politik und Gesellschaft
haben. Gleichzeitig muss sich FO mit einer mächtigen, aber konservativ-veränderungsresistenten
Institution Kirche und der Krise als Folge von Skandalen sexueller Ausbeutung auseinandersetzen. Die
Rolle der Frauen in der Kirche stellt ebenfalls eine Herausforderung dar für FO. Selbst die ehemalige
Synthesebericht MTR der Fastenopfer Strategie 17-22 21.08.19Direktorin Anne-Marie Holenstein ist 2018 zusammen mit weiteren engagierten Frauen unter Protest gegen die Gleichsetzung von Abtreibung mit Auftragsmord durch den Papst aus der katholischen Kirche ausgetreten. Folgerung Herausstellungsmerkmal Kirche: Die katholische Zugehörigkeit hat den Vorteil großer Reichweite in die Basis und in nationale kirchliche Strukturen. Die MTR sieht Handlungsbedarf, dass FO sich als fortschrittliche Kraft innerhalb der katholischen Kirche aktiv und positiv positioniert. Stiftungsrat und Stiftungsforum stellen ein Potential für Netzwerkpflege dar, welches noch besser genutzt werden könnte. Das Verständnis von MultiplikatorInnen an der Basis bedarf der Klärung. Thematisch profiliert Ein thematisch geschärftes Profil zeichnet sich dadurch aus, dass das Kerngeschäft klar erkennbar und breit bekannt ist, die Kompetenzen anerkannt werden, die Rolle als Impulsgeber und Innovator in der Branche geschätzt und gesucht wird, das Portfolio strategisch ausgerichtet ist und dem Kern- geschäft entspricht. Ein prägnantes thematisches Profil fördert die Nachfrage als Allianzpartner oder die Chancen als Anbieter in Ausschreibungen. Der strategische Anspruch von FO, sich auf zwei Themen zu fokussieren, hatte die klare Absicht, das Profil zu stärken. Die MTR erkennt, dass FO den Fokus auf das Thema „Recht auf Nahrung“ legt, stellt aber auch fest, dass darunter viele unter- schiedliche „Subthemen“ wie Hunger und Ernährungssicherung, nachhaltige Ressourcennutzung, Biodiversität, Klima und Armut sowie Ausgrenzung subsumiert werden. Das noch im Aufbau befindliche „IP Agribusiness and Secured Livelihood“ leistet relevante Beiträge zum operationellen Schwerpunkt von Recht auf Nahrung. Der Schwerpunkt „Nachhaltiges Wirtschaften“ bleibt hingegen zu abstrakt im ganzen Spannungsbogen zwischen globalisierter Wirtschaft, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Folgerung Herausstellungsmerkmal Themenprofil: Für die MTR ist die strategisch geforderte 11 thematische Fokussierung noch zu wenig klar erkennbar und die Vielfalt im Portfolio von FO noch zu breit. Der Anspruch nach klarer thematischer Schärfung auf zwei Themen ist aufgrund der Analyse der MTR nicht eingelöst. Mit seiner thematischen Breite sticht FO im Markt der Schweizer NGOs nicht klar heraus. Die MTR erachtet es als wichtig, dass FO sein thematisches Profil schärft und den angestrebten Fokus künftig konsequenter umsetzt. Weltweit präsent FO ist mit 12, bis vor kurzem noch 14 LP und den IP in Asien, Afrika und Lateinamerika breit engagiert. Ein klares geografisches Profil ist dabei nur ansatzweise erkennbar. Einsatzgebiete sollten sich an den Werten und komparativen Stärken von FO ausrichten, die Wahl der Partnerländer und der Partner muss auf Kriterien gestützt und nachvollziehbar begründet sein. Grundsätzlich ist die Zusammenarbeit mit einem Land strategisch, d.h. auf definierte Bedarfe und entsprechende Ergebnisse in einem definierten Zeitraum auszurichten. Wenn diese erreicht sind, wäre ein Programm auch abzuschließen. FO arbeitet langjährig mit seinen Partnerländern zusammen, basierend auf Landesstrategien und Theories of Change sowie Resultatrastern. Die Portfoliostruktur entspricht nur teilweise den strategischen Anforderungen und anspruchsvollen Zielsetzungen der Länderstrategien. Ob und weshalb Länderprogramme fortgeführt werden und der Entscheid, Südafrika und Brasilien als LP zu schließen, aber im Rahmen der IP weiterzuführen ist bei Interview- partnern zwar als Sparmaßnahme auf Verständnis, aus strategischen Gründen aber auf Kritik gestoßen. Folgerung Herausstellungsmerkmal Länderfokus: Die MTR stellt in Frage, ob das aktuell breite geografische Engagement angesichts der Größe und rückläufiger Ressourcen von FO zukunftsfähig ist. Für klare regionale Erkennbarkeit in drei Weltregionen hat FO nicht die notwendige Größe. Die Synthesebericht MTR der Fastenopfer Strategie 17-22 21.08.19
MTR sieht Potential für einen „Opportunitätsgewinn“ durch ein prägnantes Profil in weniger
Regionen, mit entsprechend mehr Tiefgang in Kompetenzaufbau und Wissensmanagement.
Gefragter Allianzpartner
Die Strategie 2017-22 will die Existenzgrundlage und organisationale Autonomie von FO nachhaltig
sicherstellen. Internationale Analysen wie auch solche von Alliance Sud kommen zum Schluss, dass
die klassische bilaterale EZA mit Partnerländern über ein Portfolio von langfristig angelegten, meist
extern bestimmten und von Einzelorganisationen durchgeführten Hilfsprojekten künftig weniger
Bedeutung haben wird. Die Ansprüche an selbstbestimmte Entwicklung, in ihrer Verantwortung
gestärkte lokale Akteure, Resultatorientierung und Entwicklungskooperationen in Allianz mit
wissenschaftlichen oder privatwirtschaftlichen Akteuren nehmen stetig zu.
Die MTR Erhebung ergibt das Bild, dass sich FO bis anhin – mit Ausnahme der Partnerschaft mit Bfa –
eher in der Abgrenzung profiliert hat als in der Allianzsuche. Dies mag sich aus der langen Geschichte
von FO erklären und dem Selbstverständnis, das Hilfswerk der katholischen Kirche der Schweiz zu
sein, sich also vorwiegend der katholischen Familie zugehörig zu fühlen. Aktuell ist die IZA-Landschaft
in Umbruch und viele Hilfswerke müssen sich unter dem finanziellen und politischen Druck neu
aufstellen, respektive mit anderen Hilfswerken Allianzen bilden, um sich für die Zukunft fit zu
machen. Auch FO bewegt sich unter diesem Druck in Richtung Allianzbildung mit mehreren anderen
Hilfswerken. Eine Herausforderung wird dabei sein, dass FO spezifische Leistungen und Beiträge so in
Entwicklungsallianzen einbringt, dass sie damit gleichzeitig ihr Profil schärft und die Ergebnisse und
Wirkungen in den Ländern und im Bereich Transformation komplementär zu jenen der Partner
wirken. Dadurch entsteht eine gemeinsame Wertschöpfung mit dem Potential, dass alle davon
profitieren. 12
Folgerung Herausstellungsmerkmal Allianzpartner: Aktuell sucht FO sich vorab in der Abgrenzung zu
anderen Organisationen zu profilieren. Die MTR sieht Entwicklungsallianzen als Chance für FO, sich
als Teil der Allianz zu spezialisieren und unentbehrlich zu machen. Kooperationspartnerschaften
können „Opportunitätsgewinne“ bedeuten durch geteilte Analysen, Pooling von Wissen und Teilen
von Erfahrungen bis hin zu Ressourcen und Instrumenten sowie durch gemeinsames Risiko-
management. Insgesamt entwickeln Allianzen höhere kollektive Problemlösungskompetenz.
Diese vier Bausteine sind nicht abschliessend, können aber einen Beitrag leisten zur Neuorientierung
des FO-Selbstverständnisses im Rahmen der Markendiskussion und für ein künftiges Leitbild.
3.2 MTR der Landesprogramme (LP)
Die spezifischen TOR für die MTR der LP fokussieren auf drei Aspekte: (i) Relevanz und Validierung
der Länderstrategieziele; (ii) Umsetzung der Programme und Effektivität der Ergebnisse und (iii)
Handlungsbedarf auf Stufe der Wirkungsmodelle und der Programme. Die folgende Einschätzung
stützt sich auf die Analyse aktueller Berichte aus den Programmen, auf die Auswertungen der LP-
internen MTR-Workshops durch PRE5, die Selbsteinschätzung der BSC-Fortschritte sowie eigene
Erhebungen durch Interviews mit Programmverantwortlichen und Koordinatoren. Sie ist also eine
Mischung aus Selbst- und Fremdbetrachtung.
Relevanz
Fast alle LP haben aufgrund der Kontextanalyse umfassende Präzisierungen und relevante An-
passungen an den Theories of Change (ToC) vorgenommen, jedoch die Programmziele unverändert
5
Synthesebericht zur MTR 2019 der Landesprogramme 2017-2022 (Final Draft, Abt. PRE, 28.7.2019)
Synthesebericht MTR der Fastenopfer Strategie 17-22 21.08.19belassen. Dies deutet darauf hin, dass die Instrumente der ToC und der Programmziele noch nicht
systematisch verknüpft und die strategischen Auswirkungen veränderter Rahmenbedingungen auf
die Programme oft nicht zu Ende gedacht wurden. Hier besteht Handlungsbedarf in der
Sensibilisierung und Begleitung der PV und KoordinatorInnen.
Folgerung Relevanz: Die strategische Steuerung der LP auf dem Hintergrund sich verändernder
Rahmenbedingungen kann verbessert werden, wenn die Umfeldanalysen zusammen mit den
Programmzielen durchdacht werden und stets der Bezug zum Verantwortungsbereich von FO
hergestellt wird.
Effektivität und gute Praxis
Die LP von FO erzeugen wenig Aufmerksamkeit, sie arbeiten sich von Jahr zu Jahr vorwärts. Gemäss
FO-eigenen Angaben geschieht dies zumeist erfolgreich, in zunehmend schwieriger werdendem
Umfeld. Einzelne LP haben sogar ihre Zielwerte für 2022 nach oben korrigiert. Auch das „gute
Praxis“-Potential wird als reichhaltig dargestellt, mit zahlreichen Ansätzen für Übertragbarkeit
zwischen den Programmen, sofern die relevante Erfahrung entsprechend aufgearbeitet wird. Die
knapper werdenden Ressourcen stehen aber einer Verstärkung erfolgreicher Programmaktivitäten
entgegen. Es stellt sich die Frage, welche Massnahmen dazu beitragen können, um das positive
Momentum in den LP zu stärken. Das Landnutzungsprojekt in Burkina Faso hat es geschafft, lokale
Drittmittel für die weitere Finanzierung notwendiger Folgeinvestitionen zu mobilisieren. Andere,
weniger erfolgreiche Programme müssen allenfalls eine LP-interne Umlagerung von Ressourcen
erwägen.
Die Resultatberichte im Anhang der FO-Jahresberichte bestehen zumeist aus qualitativen Trend-
angaben, da und dort unterlegt mit Zahlenmaterial. Auch wenn die BSC bzw. das Core Contribution 13
Activity Reporting CCAR an die DEZA bemerkenswerte Zielerreichungen und Reichweiten berechnen,
ergibt sich aus den einzelnen Länderberichten nur ein fragmentiertes Bild über Programmfortschritte
und Wirkungen, da oft keine Baselines angegeben oder Bezüge zu Zielen bzw. den Ergebnissen aus
den Vorjahren hergestellt werden.
Folgerung Effektivität: Ein Resultat-Reporting bezogen auf mittelfristige Programmziele und die
daten-gestützte Darstellung der Ergebnisse auf einer Zeitachse würde die Erfassung der
Resultaterreichung erleichtern.
Der Blick auf die Resultate und Wirkungen, zusammengefasst im Anhang 9.2. des Jahresberichts
20186, auf die Selbstevaluation der BSC (Anhang 9.1 desselben Jahresberichts) sowie die Projektlisten
von 2015 und 2017 auf der FO-Webseite weist noch auf weitere Herausforderungen hin, welche hier
nicht im Detail besprochen werden, die aber ebenfalls Einfluss haben auf die sogenannte „gute
Praxis“.
Politisches Umfeld
Der „shrinking space“ ist ein zunehmendes Problem für die Tätigkeit von FO in Südafrika, Brasilien,
Indien, Laos und neuerdings Nepal. Zudem wurde eine Verschärfung der Sicherheitssituation in
mehreren Ländern festgestellt (Haiti, Philippinen, Guatemala, Brasilien). Daher wurden die
systematischen Risikoanalysen in mehreren Ländern ausgebaut und ein proaktives Risiko-
management eingeführt (Brasilien; Kolumbien; Philippinen, DRC). Da die Mehrzahl aller FO-
Partnerländer von solchen erschwerten Bedingungen betroffen ist, stellt sich die Frage, ob die
Grundvoraussetzungen für ein verstärktes Advocacy-Engagement von FO über internationale
Programme - so wie von der Strategie vorgesehen - noch gegeben sind.
6
Jahresbericht Fastenopfer 2018
Synthesebericht MTR der Fastenopfer Strategie 17-22 21.08.19Folgerung Kontext: Die Steuerung von Risiken im Zusammenhang mit staatlicher Repression, religiöser Intoleranz oder zerfallender Rechtsstaatlichkeit stellt für alle internationalen NGOs eine Herausforderung dar. Es ist wichtig, die bisherigen Anstrengungen für ein bewusstes Risiko- management durch die KoordinatorInnen weiter zu stärken. Gleichzeitig gilt es, beim Monitoring und der Beurteilung von Risikofaktoren mit weiteren Entwicklungsakteuren eng zusammen zu arbeiten für ein differenziertes und stets aktuelles Risikobild. Thematischer Fokus Nach der Strategie 2017-2022 sollen Landesprogramme auf zwei Schwerpunktthemen und ein Transversalthema fokussieren. Obwohl insbesondere etwa die Hälfte aller Projekte dem Oberthema „Recht auf Nahrung“ und ein weiteres Drittel dem Thema „Nachhaltiges Wirtschaften“ im weitesten Sinne zugeordnet werden können, finden sich innerhalb dieser breit abgesteckten Bereiche zahlreiche Unterthemen7. Alle Programme bearbeiten zusätzlich transversal die Genderthematik. Eine klare Themenfokussierung ist übergreifend nicht ersichtlich. Dies erschwert die Erkennbarkeit des FO-Profils, den Aufbau von klaren Kompetenzen und ein effizientes Lernen zwischen Ländern und in der Organisation. Bei aller Anerkennung der regionalen Kontextunterschiede verdienen die Themenschwerpunkte von FO ein inhaltlich prägnantes Gesicht mit einer handlungsleitenden Akzentsetzung. Die LP sollten ihr Portfolio von Projekten zu mindestens 75% auf den strategisch vorgegebenen Fokus von zwei Themen und Gender ausrichten. Ergänzende Massnahmen ausserhalb des Fokus bleiben möglich, bilden aber nicht den Kern der Portfolios. Die Akzentsetzung verbessert das Potential für horizontales 14 Lernen sowohl innerhalb sowie zwischen LP und verbessert somit mittelfristig die gesamt- institutionelle Professionalisierung. Folgerung Themenfokus: Das Anliegen der Strategie 2017-2022 für thematische Fokussierung war berechtigt, wird aber bis anhin zu breit ausgelegt und wurde entsprechend in den Ländern bisher nicht nachweislich umgesetzt. Eine enger gefasste Themenausrichtung würde ermöglichen, dass sich die Programme in den folgenden 3 Jahren kohärenter ausrichten und zu einem inhaltlich gebündelten Profil finden. Portfolio-Aufbau Die LP bestehen aus einem Portfolio von etwa 15 (Laos) bis knapp 30 Einzelprojekten (Philippinen). Die Titel der Aktivitäten auf Projektlisten sind wenig aussagekräftig. Ziele, Stellenwert (Flagship- Projekte; Pilot- oder Innovationsprojekte; Forschungspartnerschaften; Policy Advocacy Massnahmen; Kapazitätsentwicklung Partner; Einzelaktionen etc.) und allfällige Zusammenhänge zwischen einzelnen Aktionen sind kaum ersichtlich. Im 2017 war der dominante Ausgabeposten der Themenbereich Recht auf Nahrung/nachhaltige Landwirtschaft, gefolgt von Organisationsentwicklung der Partner und an dritter Stelle standen die Kosten für die Koordination. Diese sind teils ausgewiesen, teils nicht oder nur indirekt. Es bestehen sehr grosse Unterschiede bei den auf der Webseite publizierten Projektlisten ausgewiesenen Koordinationskosten (im 2017: DRC 225‘000 des Gesamtbudgets von 830‘000 (27%); 0 bei Indien und 7 Die FO-„Schwerpunkte“ in den LP reichen von der Agrarökologie, Subsistenzlandwirtschaft, Wasser, Saatgut, Land-, Weide- und Wohnrechte, Zugang zu Land, landwirtschaftliche Produktionstechniken, landwirtschaftliche Forschung, nachhaltige Ressourcennutzung, biologische Landwirtschaft, ökonomische Gerechtigkeit, Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige Nutzung des Waldes, schonende Nutzung von Küsten und Meeresgebieten, Spar- und Kreditgruppen bis hin zu Rohstoffen (Gold, Kohle) und Rechten von Minen- anwohnerInnen. Synthesebericht MTR der Fastenopfer Strategie 17-22 21.08.19
Nepal). Dies erschwert ein klares Bild des Portfolioaufbaus und ist in dieser Unklarheit auf der FO- Webplattform nicht vertrauensbildend. Der Anteil von kleinen Aktionen unter 50‘000 CHF beträgt geschätzte 75% vom gesamten Projekt- portfolio. Dies entspricht einer sehr hohen Fragmentierung mit hohem administrativem Aufwand. Auffallend ist auch ein erheblicher Anteil von unspezifischen Unterstützungen an christliche Gemeinden und Organisationen (insbes. DRC, Kenia, auch Brasilien, Haiti). Folgerung Portfolio: Insgesamt ist es schwierig einzuschätzen, ob die Portfolios der LP einer langfristigen strategischen Ausrichtung entsprechen oder über die Jahre eher organisch und nach Gelegenheiten gewachsen sind. Auch der Aufbau der Portfolios, also der Stellenwert einzelner Projekte im Gesamtzusammenhang ist nicht erkennbar. Dies macht es für externe Betrachter schwierig zu beurteilen, ob Programme zielorientiert und damit strategisch umgesetzt werden. Koordination und Partnerschaften Die Strategie 2017-2022 strebt an, dass sich die Länderprogramme auf maximal 10 Partner- organisationen begrenzen. Die Auswertungen zeigen, dass die meisten Programme teils wesentlich mehr Partnerschaften unterhalten (Brasilien 14; Philippinen 11; Senegal 12; DRC 17; Kenia und Burkina Faso je 14). Diese hohe Zahl an lokalen Partnern führt zur Stückelung der begrenzten Budgets, hohen Opportunitätskosten mit erheblichem Begleitaufwand, hohen Reisekosten, der Berücksichtigung zahlreicher Partnerformate und damit zu hohen Kosten für die Koordination. Nicht überraschend berichten auch einzelne Länder, an die Kapazitätsgrenze für die Betreuung der Partnerorganisationen zu stossen und deshalb das Personal in der Koordination auszubauen. Dieser Trend läuft den Absichten der Strategie 2017-2022 entgegen. Die Koordinationskosten werden im PRE-Synthesebericht unter dem Aspekt sinkender Budgets und 15 (noch) zu hoher Anzahl von Partnerorganisationen, aber auch zusätzlicher Kompetenzerwartungen behandelt. Der Koordinationsaufwand wird im Mittel 2014-2018 auf passabler Höhe von 11-13% ausgewiesen. Die eigene Auswertung der Projektliste 2017 (neuste publizierte Liste auf FO-Webseite) zeigt ein etwas anderes Bild. Rechnet man zu den reinen Koordinationskosten auch Evaluationen, Finanzkontrolle, Partnertreffen, Policy Advocacy und gewisse Risikomanagement-Aufgaben hinzu, dann ergeben sich teils deutlich höhere Gesamtkosten für die Programmbegleitung. Diesem strategisch und auch kommunikativ wichtigen Kostenfaktor muss Beachtung geschenkt werden. Es ist wichtig, dabei ein eindeutiges und marktübliches Verständnis für „Begleitstrukturen-Aufwand“ festzulegen. Folgerung Koordination: Für die vergleichsweise kleinen Programmbegleitungs-Strukturen von FO vor Ort ist eine nahe, ergebnis- und lernorientierte Begleitung nur mit einer begrenzten Anzahl von PO möglich. 3.3 MTR der Internationalen Programme (IP) Internationale Programme sind die eigentliche Neuerung der Strategie 2017-2022. Mit dem Anspruch, die Tätigkeit der gesamten Organisation kohärent auf Transformation auszurichten, wurde das Instrument der IP geschaffen. Diese sind zum Hoffnungsträger geworden für ein in der Organisation gefordertes grundlegendes Umdenken, das auf der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen wie auch persönlichen Ebene ansetzen solle. Synthesebericht MTR der Fastenopfer Strategie 17-22 21.08.19
Stellenwert und Anspruch Die IP werden als Plattformen zur entwicklungspolitischen Bearbeitung der FO-Programme auf dem Hintergrund globaler Herausforderungen und deren Bezug zur Schweiz intern wie extern breit unter- stützt. Die in der MTR oft gehörte Kritik betrifft weniger das Instrument der IP an sich als Zweifel daran, ob die Strategie 2017-2022 nicht zu hohe Ansprüche stelle8 und wie die IP konzeptionell gefasst, ausgerichtet und praktisch umgesetzt würden. Der entsprechend hohe Druck hat dazu beigetragen, dass bisher die IP-Verantwortlichen enorme Kräfte in die Perfektionierung von „Konzepten am Reissbrett“ investiert haben. Diese fehlten dann für einen pragmatischen, mit Partnern gemeinsam erarbeiteten und an konkrete, erreichbare Entwicklungsfragen gebundenen Aufbau der Programme. Folgerung Erwartungen: FO hat bereits in der Strategieformulierung überhöhte Ansprüche an die IP gestellt, die später durch den SR (Bewilligung von gleichzeitig 4 neuen Programmen) wie auch die GL bestärkt wurden. Der Bereich IZA wurde in seinem Optimismus dadurch beflügelt, aber gleichzeitig unter enormen Leistungsdruck gesetzt. Relevanz und strategischer Fokus Grundsätzlich bestätigt die MTR die Relevanz der inzwischen auf drei Themensetzungen reduzierten IP mit Konzentration auf die komparativen Stärken von FO in den Bereichen da nachhaltige Land- wirtschaft, welche das tragende Kerngeschäft von FO-Programmen ausmacht, in der Rohstoff- thematik, welche von hoher Relevanz ist in der Schweiz und auf die Klimaproblematik, auf welche für die kommenden Jahre politisch nicht verzichtet werden kann. Zweifel bestehen beim Thema Energie, das keiner komparativen Stärke von FO entspricht und PO zumeist als nachrangig zu 16 Die meisten IP-Themen sind also relevant und aktuell. Das Portfolio der Programmziele und Kern- aktivitäten ist jedoch inhaltlich so breit und anspruchsvoll aufgestellt, dass es von FO als Organisation mittlerer Grösse mit begrenzten Ressourcen kaum zielführend bearbeitet werden kann. Auch die LP kennen die Problematik ausufernder Themenbreite, wie in obigen Kapiteln dargelegt. Als Organisation mit einer unterkritischen Grösse für die gleichzeitige seriöse Bearbeitung mehrerer entwicklungspolitischer Themen drängt sich somit eine konsequente Fokussierung auf. Folgerung Relevanz: Trotz unzweifelhafter Themenrelevanz überfordert sich FO mit der breiten thematischen Ausrichtung bei der Anzahl wie auch zumeist in der thematischen Ausgestaltung innerhalb der IP. Es gilt, sich auf die komparativen Stärken von FO zu beschränken und darin klare und schlanke Handlungsstränge zu bestimmen, über welche eine Einflussnahme angestrebt wird, so wie dies beim Fokus auf Gold und Frauen in der Rohstoffthematik gelungen ist. Ziele Die MTR stellt fest, dass alle IP gute, wenn auch teils etwas ideologisierte Kontextanalysen zu den gewählten Themenbereichen erarbeitet haben. Die darauf gestützten Visionen und Transformations- ziele sind jedoch weit ausgreifend, abstrakt und stellenweise allzu vollmundig. Sie geben den Eindruck konzeptioneller Fleißarbeit im Alleingang, kaum reflektiert mit möglichen Allianzpartnern. Entsprechend gelingt es nur ungenügend, die an sich plausiblen IP-Wirkungshypothesen in konkrete, erreichbare, beurteilbare und auf FO bezogene Zielsetzungen zu übersetzen. Wenn die Zielstrukturen der IP aber aus Fremdzielen bestehen, losgelöst von spezifischen FO-Leistungen, wenn sie nach den Sternen greifen oder so formuliert werden, dass sie nicht beurteilbar sind, dann dienen sie weder zur 8 FO-Ansprüche an IP: (i) zur Transformation (Systemwandel) beitragen; (ii) die entwicklungspolitische Stimme der katholischen Kirche sein; (iii) Politiken in der Schweiz beeinflussen; (iv) Teil einschlägiger internationaler Austauschplattformen werden; (v) Partnerorganisationen unterstützen; (vi) Campaigning-Inhalte liefern; (vii) das Fundraising stärken; (viii) interne Fachkompetenzen und Know how aufbauen; (ix) Schnittstellen partizipativ bewirtschaften. Synthesebericht MTR der Fastenopfer Strategie 17-22 21.08.19
Orientierung der IP-Teams noch als Grundlage für die Zusammenarbeit mit Ländern, PO oder externen Policy-Partnern oder für die Kommunikation. Folgerung Ziele: Die IP-Konzepte müssen gemeinsam mit wichtigen Partnern im Dialog weiter- entwickelt werden, um konkrete, „smarte“ und damit belastbare Zielstrukturen zu entwickeln. Dabei ist unerlässlich, im Themenfeld tätige Schlüsselakteure (NGOs, Bundesstellen, Forschungsinstitute usw.) zu konsultieren, um den Mehrwert von FO genauer zu fassen und im IP-Konzept spezifisch abzubilden. Zusammenarbeit IP sind Laboratorien für Beiträge an einen angestrebten Systemwandel. So „fördert FO Massnahmen zur besseren Durchsetzung von Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit“ (Strategie 2017-2022, S. 4). Dass dafür Anstrengungen nötig sind, die über die Möglichkeiten von FO allein hinausgehen, wird für die IP vorausgesetzt. Dabei soll „die Themensetzung und längerfristige Planung von Aktivitäten (der IP) partizipativ erfolgen. Die Campaigning-Themen werden von Beginn weg mit den Campaigning- Verantwortlichen von FO und Bfa geplant“ (Strategie 2017-2022, S. 7). Der von der Strategie gesetzte Arbeitsansatz für IP fordert also einen kooperativen Modus, sowohl was die FO-interne Mitwirkung zwischen verschiedenen Organisationseinheiten wie auch jene mit externen Allianzpartnern betrifft. Einzelnen IP ist dies leichter gefallen, da etablierte Kooperations- strukturen bereits vorhanden waren (z.B. IP RMR mit KOVI). Das IP AGR konnte jedoch trotz grosser Bemühungen keinen institutionell tragfähiger Kooperationsrahmen mit Bfa finden. Zur Zusammen- arbeit mit FO-Partnerländern ist in der MTR ein heterogenes Bild entstanden. Einzelnen positiv hervorgehobenen Beispielen (WoMin, IYM oder Menschenrechte Philippinen) stehen Rück- meldungen von LP-Verantwortlichen entgegen, die von Alleingängen und mangelnden Absprachen, unkooperativer Haltung, schlecht funktionierenden Arbeitsgruppen bis hin zu Konkurrenzverhalten 17 im Umgang mit PO und Parallelstrukturen in der Finanzierung sprechen. Die IP-Schnittstellen mit anderen Bereichen und Abteilungen sind kürzlich mit dem formellen Aufbau mehrerer gemischter Arbeitsgruppen neu strukturiert worden. Sind deren Ziele, Zusammensetzung, Rollen, Aufgaben und angestrebten Produkte einmal klar geregelt (in Selbstorganisation oder als Linienvorgabe), dann bestehen die strukturellen Voraussetzungen dafür, dass die Zusammenarbeit gestärkt und Probleme zeitnah und stufengerecht gelöst werden können. Dazu ist jedoch auch ein Kulturwandel erforderlich. Das Engagement in Arbeitsgruppen als Kooperationsplattformen kann nur produktiv funktionieren, wenn die Verantwortlichen führen und gestalten wollen, wenn die Mitglieder vernetzen wollen, wenn die einsitzenden GL-Mitglieder bereit sind zu delegieren, Mitarbeitende in ihren AG-Aufgaben zu stärken und Entscheide am Ende in der GL mitzutragen. Gut funktionierende AG zeichnen sich dadurch aus, dass sie auf konkrete Ergebnisse und Produkte hinarbeiten, diese jeweils in ihre Linienfunktion zurücktragen und dort aktiv vertreten. Eine solche „feinstoffliche“ Betriebskultur des Wandels kann dazu beitragen, Kräfte freizusetzen für mehr Motivation, neue Ideen und innovative Ansätze. Folgerung Zusammenarbeit: IP sind besonders gefordert, ihre Ziele mit internen wie externen Allianzpartnern gemeinsam anzugehen und dafür eine Kultur des „Miteinanders“ aufzubauen. Als eigentliche Motoren für Transformationsimpulse ist die Latte hoch gesetzt, dass sie zusätzlich zur inhaltlichen Herausforderung auch ihre Arbeitsweise partnerschaftlich gestalten. Dies setzt voraus, dass in der Linienverantwortung bei IZA eine ebensolche Arbeitskultur entsteht, mit einer kohärenten Mischung aus strategischem Orientieren, Fördern, Coachen und Fordern in der den IP- Teams jeweils angemessenen Dosierung. Synthesebericht MTR der Fastenopfer Strategie 17-22 21.08.19
Ergebnisse Gestützt auf das Annual Monitoring and Reporting 2018 – Planning 2019 und die Interviews weisen die IP zwar konkrete Ergebnisse aus (z.B. Studien; Dokumentationen; Konferenz-Workshops; Teilnahme an internationalen Symposien und Austauschforen). Diese haben jedoch oft punktuellen Charakter. Strategische Bezüge lassen sich bei den Aktivitäten von RMR (LP Kolumbien – Goldstudie – KOVI) sowie der neu angestrebten Partnerschaft mit SEARICE Philippinen im Saatgutbereich erkennen. Die insgesamt etwas fragmentierte Resultatbilanz hat damit zu tun, dass die Programme sich am wenig zusammenhängenden Bedarf einzelner Kooperationspartner ausgerichtet haben. Hinzu kommt, dass alle drei IP Mühe bekundet haben mit der Formulierung kohärenter Wirkungs- zusammenhänge, weshalb nicht ersichtlich wird, wie lokal erzielte Ergebnisse, das Engagement in internationalen Policy- und Lernplattformen und die Advocacyarbeit in der Schweiz aufeinander wirken. Der hohe Konzeptaufwand in der Anfangsphase der Programme hat Kräfte und Ressourcen absorbiert und erklärt zusätzlich, weshalb die IP-Ergebnisse insgesamt unter den Erwartungen geblieben sind. Folgerung Ergebnisse: Die Überarbeitung des strategischen Fokus und der entsprechenden IP- Programmziele sind eine notwendige Voraussetzung dafür, dass die Programme nachweisbare Resultate und Wirkung hervorbringen und damit die Sichtbarkeit erhöhen können. Spannungsfeld Anspruch – Ressourcen Bereits eingangs dieses Kapitels wurde festgestellt, dass die vielschichtigen Erwartungen an die IP hoch sind und damit einen latenten Stressfaktor darstellen. Ob IP zwingend einen Schweizbezug aufweisen müssen ist bei FO umstritten. Es wäre auch denkbar, dass sich die regionale Dynamik zu einem Thema (z.B. Saatgut Lateinamerika; Landfragen SADEC) für ein entwicklungspolitisch länder- 18 übergreifendes Engagement von FO eignen würde, welches ergänzend zu den Landesprogrammen steht. Ebenso gibt es unterschiedliche Ansichten darüber, wie hoch der Anspruch an FO-interne Fachkompetenz zu stellen sei. Die Organisation ist für den Aufbau einer hausinternen Kompetenz zu mehreren IP-Themen zu klein. Sie muss sich aus MTR-Sicht vermehrt auf externes Fachwissen abstützen, dafür ihre eigenen Netzwerk- und Fazilitator-Qualitäten stärken und die Profile der Fachverantwortlichen entsprechend neu ausrichten. Dass der SR vier unterschiedliche IP gleichzeitig verabschiedet hat, dafür jedoch insgesamt nur 290% Vollzeitstellen und eine Teilzeitleitung eingesetzt wurden, hat die Startbedingungen zusätzlich erschwert. Kommt hinzu, dass das eingesetzte Personal das nötige Fachwissen und die Branchen- netzwerke zuerst aufbauen musste und FO als Organisation nicht über einen privilegierten Zugang zu Polit-Lobbyisten oder diplomatischen Türöffnern verfügt, wie dies bei anderen Hilfswerken teilweise der Fall ist. Dieses deutliche Ungleichgewicht zwischen Anspruch an die IP einerseits und Möglichkeiten sowie Grenzen anderseits ist für die MTR das Kernproblem, welches sich auf alle oben erwähnten Schwierigkeiten beim strategischen Fokus, den Zielen oder der Zusammenarbeit massgeblich ausgewirkt hat. Folgerung Anspruch-Ressourcen: Der Spannungsbogen zwischen den IP-Ambitionen einerseits und den realen Stärken und Möglichkeiten von FO anderseits für die verbleibende Strategieperiode muss auf eine realistische, den Ressourcen und Kooperationsmöglichkeiten angemessene Ebene gebracht werden. Dies betrifft die Anzahl Programme, die an IP gestellten Ansprüche sowie die personellen und finanziellen Ressourcen. Synthesebericht MTR der Fastenopfer Strategie 17-22 21.08.19
Sie können auch lesen