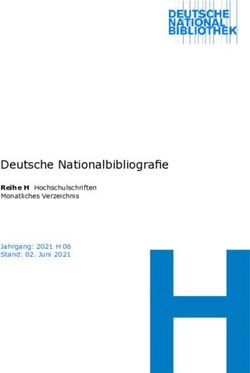Analyse der ausgewählten Merkmale der Jugendsprache anhand von Online-Zeitschriften
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Masaryk-Universität
Philosophische Fakultät
Institut für Germanistik, Nordistik und Nederlandistik
Diplomarbeit
Analyse der ausgewählten Merkmale
der Jugendsprache anhand von Online-Zeitschriften
Bravo und Xpress
Betreuer: Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D.
Ausgearbeitet von: Bc. Dana Schmidtová
Brno 2014Ich erkläre hiermit, dass ich die Diplomarbeit selbstständig ausgearbeitet habe, wobei ich
ausschließlich die Materialien und Literatur benutzt habe, die im Literaturverzeichnis
angeführt sind.
.............................................................An dieser Stelle möchte ich mich bei Herrn Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D., für seine Hilfe und Unterstützung bedanken.
Inhaltsverzeichnis Einleitung ............................................................................................................................................... 7 Theoretischer Teil .................................................................................................................................... 9 1. Soziolinguistik ...................................................................................................................................... 9 1.1. Soziolinguistische Forschung .......................................................................................................... 10 1.2. Die Varietätenlinguistik .................................................................................................................. 11 1.3. Varietäten ....................................................................................................................................... 13 1.3.1. Regional bestimmte Varietäten .................................................................................................. 13 1.3.2. Situativ bestimmte Varietäten .................................................................................................... 13 1.3.3. Sozial bestimmte Varietäten ....................................................................................................... 13 1.4. Soziolekt ......................................................................................................................................... 15 2. Deutsche Gegenwartssprache ........................................................................................................... 17 2.1. Wortschatz in der Gegenwartssprache .......................................................................................... 18 2.2. Anglizismen in der deutschen Gegenwartssprache ....................................................................... 20 2.3. Umgangssprache ............................................................................................................................ 22 2.3.1. Anglizismen in der Umgangssprache .......................................................................................... 23 2.3.2. Sog. Denglizismen in der Umgangssprache ................................................................................. 23 3. Jugendsprache ................................................................................................................................... 25 3.1. Was ist Jugendsprache ................................................................................................................... 26 3.2. Geschichte der Jugendsprache ....................................................................................................... 28 3.3. Jugendsprachenforschung.............................................................................................................. 29 3.4. Funktionen der Jugendsprache ...................................................................................................... 31 3.5. Jugendsprache in Deutschland ....................................................................................................... 31 3.6. Jugendsprache in Österreich .......................................................................................................... 33 4. Massenmedien .................................................................................................................................. 36 4.2. Medien und Massenmedien........................................................................................................... 36 4.3. Funktionen der Massenmedien ..................................................................................................... 37 4.3.1. Informationsfunktion ................................................................................................................. 37 4.3.2. Kritik- und Kontrollfunktion......................................................................................................... 38 4.3.3. Meinungsbildungsfunktion ......................................................................................................... 38 4.4.Einteilung der Massenmedien ......................................................................................................... 39 4.4.1. Printmedien ................................................................................................................................. 39 4.4.2. Elektronische Medien .................................................................................................................. 39 4.4.3. Internet ........................................................................................................................................ 40
5. Onlinemedien .................................................................................................................................... 41 5.1. Geschichte der Onlinemedien ........................................................................................................ 41 5.2. Kritik der Onlinemedien ................................................................................................................. 42 5.3. Elektronische Zeitschriften ............................................................................................................. 42 5.3.1 Online-Magazine für Jugendliche ................................................................................................. 43 6. Textsorten ......................................................................................................................................... 45 6.1. Textsorten und Massenmedien ...................................................................................................... 46 6.2. Informationsbetonte Texte ............................................................................................................ 47 6.2.1.Das Interview................................................................................................................................ 47 6.2.2. Die Nachricht ............................................................................................................................... 47 6.2.3. Die Meldung ................................................................................................................................ 48 6.2.4. Reportage .................................................................................................................................... 48 6.3. Instruierend-anweisende Texte ..................................................................................................... 48 6.3.1. Die Anleitungen ........................................................................................................................... 49 6.3.2. Die Ratgebungen ......................................................................................................................... 49 6.4. Meinungsbetonte Texte ................................................................................................................. 49 6.4.1. Der Kommentar ........................................................................................................................... 49 6.4.2. Die Kritik ...................................................................................................................................... 50 Praktischer Teil ...................................................................................................................................... 51 1.1. Jugendmagazin Bravo ..................................................................................................................... 52 1.2 Geschichte von Bravo ...................................................................................................................... 52 1.3. Gegenwart von Bravo ..................................................................................................................... 53 1.4. Aufbau ............................................................................................................................................ 54 1.5. Klassische Rubriken und Textsorten in Bravo ................................................................................ 55 1.6. Sprache ........................................................................................................................................... 55 1.6.1. Wortarten .................................................................................................................................... 56 1.6.1.1.Substantive ................................................................................................................................ 56 1.6.1.2. Verben ...................................................................................................................................... 57 1.6.1.3. Adjektive ................................................................................................................................... 59 1.6.1.4. Interjektionen ........................................................................................................................... 60 1.6.2. Phraseologismen ......................................................................................................................... 61 1.6.3. Anglizismen ................................................................................................................................. 62 1.6.4. Jugendsprache ............................................................................................................................. 63 1.6.5. Derbe und vulgäre Ausdrücke ..................................................................................................... 65
2. Jugendmagazin Xpress ...................................................................................................................... 67 2.1. Geschichte von Xpress .................................................................................................................... 67 2.2. Gegenwart von Xpress.................................................................................................................... 68 2.3. Aufbau von Xpress .......................................................................................................................... 68 2.4. Klassische Rubriken und Textsorten in Xpress ............................................................................... 69 2.5.Sprache ............................................................................................................................................ 69 2.6.1. Wortarten .................................................................................................................................... 70 2.6.1.1. Substantive ............................................................................................................................... 70 2.6.1.2. Verben ...................................................................................................................................... 71 2.6.1.3. Adjektive ................................................................................................................................... 72 2.6.1.4.Interjektionen ............................................................................................................................ 73 2.6.2. Phraseologismen ......................................................................................................................... 74 2.6.3. Anglizismen ................................................................................................................................. 76 2.6.4. Jugendsprache ............................................................................................................................. 78 2.6.5. Derbe und vulgäre Ausdrücke ..................................................................................................... 79 Auswertung ........................................................................................................................................... 81 Zusammenfassung ................................................................................................................................. 82 Primärquellen ........................................................................................................................................ 84 Sekundärquellen.................................................................................................................................... 92 Sekundäre Quellen online ..................................................................................................................... 94
Einleitung
„Jeder Mensch hat seine eigene Sprache.
Sprache ist Ausdruck des Geistes.“1
Novalis
In meiner Diplomarbeit werde ich mich dem Thema Jugendsprache widmen. Dieses
Thema ist in der letzen Zeit von vielen Sprachwissenschaftlern analysiert und beschrieben
worden. Es entstehen sogar verschiedene Wörterbücher zu diesem Thema, weil viele einfach
das Problem haben, diese Sprache zu verstehen. Weil die Jugendsprache von so vielen
Menschen gesprochen wird, ist es selbstverständlich, dass manche Ausdrücke nur in manchen
Gruppen benutzt werden und dass die Jugendsprache in manchen Fällen auch regional
differenziert ist.
Ich werde in meiner Diplomarbeit die Sprache anhand von zwei Online-Magazinen
analysieren. Dank dieser Analyse will ich feststellen, ob man die Sprache, die in diesen
Online-Magazinen benutzt wird, als Jugendsprache klassifizieren kann. Weiter möchte ich
feststellen, wie oft in den Texten Ausdrücke vorkommen, die nur die Jugendlichen verwenden
und zu welchen Wortarten sie gehören. Anhand meiner Analyse möchte ich feststellen, ob
sich die Sprache in den deutschen und den österreichischen Magazinen unterscheidet, ob in
diesen Magazinen Ausdrücke vorkommen, die Jugendlichen nur in Deutschland, oder nur in
Österreich verwenden.
Meine Diplomarbeit besteht aus zwei Teilen: aus dem theoretischen Teil und aus dem
praktischen Teil. In dem theoretischen Teil widme ich mich den Begriffen, die für meine
Diplomarbeit wichtig sind. Am Anfang beschreibe ich Soziolinguistik, soziologische
Forschung und Varietätslinguistik als wichtige Teildisziplinen der Soziolinguistik. Im
weiteren Kapitel widme ich mich der Gegenwartssprache, dem Wortschatz in der
Gegenwartssprache, den Anglizismen und natürlich auch der Umgangssprache, weil es ein
1
Aphorismen.de – Zitate zum Thema: Sprache.
http://www.aphorismen.de/suche?f_thema=Sprache&seite=2 16.7.2014
7untrennbarer Bestandteil der Gegenwartssprache ist. Im dritten Kapitel beschreibe ich die
Jugendsprache. Das vierte Kapitel ist den Massenmedien allgemein gewidmet und das fünfte
Kapitel dann nur den Onlinemedien. In dem letzen Kapitel beschäftige ich mich mit den
Textsorten, die in Online-Magazinen vorkommen. Im praktischen Teil werde ich dann die
Sprache anhand von den zwei Magazinen analysieren und anschließend die Ergebnisse
zusammenfassen.
8Theoretischer Teil
„Schnell fertig ist die Jugend mit dem
Wort, Das schwer sich handhabt, wie des
Messers Schneide; Aus ihrem heißen
Kopfe nimmt sie keck Der Dinge Maß,
die nur sich selber richten.“2
Friedrich von Schiller
1. Soziolinguistik
Weil sich meine Arbeit mit der Jugendsprache beschäftigt, halte ich für wichtig, eine
Einführung in die Problematik der zuständigen Wissenschaftlichen Disziplinen zu machen;
d.h. zunächst die Soziolinguistik mit ihren Arbeitsbereichen vorzustellen. Dabei wird
skizziert, was mit diesem Themenbereich zusammenhängt und für meine Arbeit wichtig ist.
Dazu gehören meiner Ansicht nach die Varietäten der Sprache und auch der Soziolekt.
Die Soziolinguistik ist eine Teildisziplin der Sprachwissenschaft, die sich relativ spät
etabliert hat. Die ersten Forschungen kommen aus den Arbeiten von Basil Bernstein, die er in
den 1960er Jahren geschrieben hat. Die Soziolinguistik widmet sich der sozialen Dimension
der Sprache.3
Das Metzler-Lexikon Sprache aus dem Jahr 2003 definiert die Soziolinguistik als:
„wiss. [enschaftliche] Disziplin, die sich mit den Beziehungen zwischen Spr. [ache] und
Gesellschaft befasst. Aufgrund der Komplexität dieser Beziehungen und der Schwierigkeit
der Abgrenzung von Aspekten der Spr. [ache], die nicht gesellschaftl. [icher] Natur sind oder
nicht mit gesellschaftl. [ichen] Sachverhalten zusammenhängen, umfasst S. [oziolingusitik]
2
gutzitiert.de – Friedrich von Schiller – Wallensteins Tod II, 2. (Wallenstein).
http://www. /zitat_autor_friedrich_von_schiller_thema_jugend_zitat_12006.html 4.8.2014
3
christianlehmann.eu – Soziolinguistik.
http://www.christianlehmann.eu/ling/elements/index.html?http://www.christianlehmann.eu/ling/elements/sozio.h
tml 26.6.2014
9eine große Zahl von Fragenstellungen, Theoriensätzen und Methoden. S. [Soziolinguistik]
wird hier, wie zumeist, als Oberbegriff von Sprachsoziologie verstanden. Sie ist
interdisziplinär und verbindet Ling. [Linguistik] und Soziologie.“4
1.1. Soziolinguistische Forschung
Es gibt mehrere Möglichkeiten, die soziolinguistische Forschung zu klassifizieren. Die
eine Möglichkeit ist die Klassifizierung im Hinblick auf die unmittelbare Arbeitsbereiche
bzw. Nachbardisziplinen der Soziolinguistik so können z.B. folgende Ausrichtungen
unterschieden werden:
Die interaktionistisch-kommunikationstheoretische Soziolinguistik
Die germanistische Soziolinguistik
Die philosophisch-anthropologische Soziolinguistik
Die psychologische Soziolinguistik
Die soziologisch-gesellschaftswissenschaftliche Soziolinguistik5
Eine weitere Möglichkeit der Klassifizierung, die für meine Arbeit wichtiger ist, als
die vorher beschriebene, ist die Gliederung auf :
Makrobereich, der unter anderem die Anthropo-, Ethno-, Gender-, und
Gerontolinguistik, mit Massenjargon und Fachsprachen umfasst.
Mesobereich beschäftigt sich mit: „Sprachverhalten in Institutionen und im Umgang
mit Institutionen, Codetheorie (sprachl. [iches] Defizit), Arbeitssprache,
Dirnensprache, Ideologische Sprache.“6
Mikrobereich, der für meine Arbeit die wichtigste Rolle spielt und der sich außer
anderem mit Jugend- und Schülersprache, Soldaten-, Studenten- und
Kleingruppensprache beschäftigt.7
4
Glück, Helmut (Hrsg.): Metzler-Lexikon Sprache. Digitale Bibliothek. Metzler Verlag. Stuttgart. Weimar,
2003, S.8876, (vgl. MLSpr. S. 645)
5
wikipedia.org – Soziolinguistik.
http://de.wikipedia.org/wiki/Soziolinguistik 26.5.2014
6
Veith, Werner H. Soziolinguistik. Ein Arbeitsbuch. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG,
2005, S.28
101.2. Die Varietätenlinguistik
Die Varietätenlinguistik (oder auch Variationslinguistik) ist eine wichtige Teildisziplin
der Soziolinguistik.
„Eine historisch gewachsene Sprache wird nicht mehr als monolithische Einheit,
sondern vielmehr als eine Menge unterschiedlicher Varietäten (d.h. verschiedener
Sprachgebrauchssysteme) aufgefasst, wobei sich jede Varietät nach spezifischen Kriterien
(wie Gruppe, Schicht, Geschlecht, Alter, etc. ) bestimmen und wissenschaftlich untersuchen
lässt. Der Untersuchungsgegenstand der Varietätslinguistik sind geographische Varietäten
(Dialekte und regionale Sonderformen der Nationalsprachen) sowie alle sozial und
situationell bedingte Sonderformen natürlicher Sprachen.“8
„Die Sprachen, die sich aus regional, situativ oder sozial verteilten Variantenmengen
konstituieren, unterscheiden sich kaum in jeder Hinsicht. Im Allgemeinen weisen sie eine
große Zahl von Übereinstimmungen auf, nicht nur in Einzelmerkmalen, sondern in weiten
Bereichen der einzelnen Sprachebenen. Es handelt sich hier im strengen Sinn also gar nicht
um eigentliche oder selbständige Sprachen, eher um bestimmte Ausprägungen einer
übergeordneten oder zugrundeliegenden Sprache, um Varianten oder Bestandteile einer
solchen Sprache, die durch einen Kern gemeinsamer Merkmale zusammengehalten werden.
Terminologisch spricht man über Subsprachen, Subsysteme, Varietäten Sprachformen oder
auch Existenzformen einer Sprache.“9
In dem Metzler-Lexikon wird die sprachliche Varietät beschrieben als „ein Teil einer
ganzen Sprache, die in aller Regel eine größere Zahl von Varietäten umfasst, z.B. Dialekte,
7
christianlehmann.eu – Soziolinguistik und Nachbardisziplinen.
http://www.christianlehmann.eu/ling/elements/index.html?http://www.christianlehmann.eu/ling/elements/sozioli
nguistik_u_andere_disziplinen.html 26.5.2014
8
Michel, Andreas. Einführung in die Italienische Sprachwissenschaft. Göttingen: Hubert de Gruyter GmbH &
Co. KG, 2011, S. 187
9
Hartung, Wolfgang /Schönfeld, Helmut. Kommunikation und Sprachvariation. Berlin: Akademie Verlag
Berlin, 1981, S. 75- 76
11eine Standardvarietät u.a. Die Gesamtheit aller Varietäten einer Sprache wird auch ihre
‚Architektur‘ genannt – man spricht in diesem Fall über Existenzformen der Sprache.“10
Varietäten lassen sich also in zwei Untergruppen gliedern: in die sogenannten
„standardisierten Varietäten“, unter die Standardsprache gehört, und in die sogenannten „nicht
standardisierenden Varietäten“, unter die Dialekte, Mundarten, Soziolekte und
Umgangssprachen gehören.
Damit man verschiedene Sprachverhalten bei Sprechern analysieren und beschreiben
könnte, hat man ein „soziolinguistisches Varietätenmodell“ entwickelt. Dieses Modell
untersucht das Sprachverhalten bestimmter Menschen unter bestimmten Bedingungen. In
diesem „soziolinguistischen Varietätenmodell“, kommen folgende Merkmale vor:
überregionale Merkmale
oberschichtliche Merkmale
invariante Merkmale
kodifizierte Merkmale11
Weiter werden Merkmale im Bezug auf Raum, soziale Situation, soziale Schicht, und
Zeit beschrieben. Diese Merkmale werden als „Hauptparameter der Varietätenlinguistik“
bezeichnet. Nach Eva Neuland werden durch diese Parameter vier Varietätenklassen gebildet:
1) die diachronischen Varietäten (auch als historische Varietäten bekannt) – beziehen
sich auf verschiedene Zeitabschnitte im Lauf der Sprachentwicklung,
2) diaphasische Varietäten (auch als situative Varietäten bekannt) die in den
unterschiedlichsten Situationen bzw. Tätigkeitsgebieten benutzt werden,
3) diastratische Varietäten (auch als soziolektale Varietäten bekannt), die sich auf
verschiedene soziale Gruppen beziehen und die von diesen Gruppen verwendet
werden,
4) diatopische Varietäten (auch als dialektale Varietäten bekannt) – für die die
geographische Verteilung wichtig ist.12
10
Glück, Helmut (Hrsg.): Metzler-Lexikon Sprache. Digitale Bibliothek. Metzler Verlag. Stuttgart. Weimar,
2003, S. 10442. (vgl. LSpr. S. 771)
11
Neuland, Eva. Jugendsprache – eine Einführung. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag GmbH& Co. KG,
2008, S. 67
12
ebd.
121.3. Varietäten
Die Varietäten lassen sich in drei Gruppen gliedern:
regional bestimmte Varietäten (Dialekte)
situativ bestimmte Varietäten (Funktionaldialekte)
sozial bestimmte Varietäten (soziale Dialekte, Soziolekte) 13
1.3.1. Regional bestimmte Varietäten
Wenn die Kommunikation in einer geographisch begrenzten Region eingeschränkt
wird, bilden sich diatopische (-regionale) Varietäten einer Sprache heraus. Diese Varietäten
werden auch als Dialekte benannt.
Deutsche Dialekte sind z. B. Bairisch, Fränkisch, Niedersächsisch oder
Nordniederdeutsch. Die österreichische Dialekte werden gegenwärtig auch nach Regionen
bezeichnet, z.B. Steirisch, Tirolerisch, oder Wienerisch. 14
1.3.2. Situativ bestimmte Varietäten
Die zweite Gruppe von Varietäten sind situative (diaphasische) Varietäten und sind
situationsbedingt. Man benutzt also in konkreten Situationen (Domänen) sprachliche Mittel,
die für diese Situation typisch sind. 15
1.3.3. Sozial bestimmte Varietäten
13
phil.uni-passau.de – Existenzformen und Varietäten slavischer Sprachen.
http://www.phil.uni-passau.de/fileadmin/group_upload/15/Heinz-PS-Foliensammlung-praesentation.ppt.
4.8.2014
14
aeiou.at – Dialekte.
http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.d/d404705.htm 4.8.2014
15
rostislavnemec.cz – Soziolinguistik.
http://www.rostislavnemec.cz/fotky9021/Soziolinguistik.doc 4.8.2014
13Die sozial bestimmten Varietäten sind von sozialen Gruppen konstituiert. In einer
sozialen Gruppe findet man oft nicht nur ähnliche, sondern auch identische sprachliche
Eigentümlichkeiten. Diese sprachlichen Eigentümlichkeiten sind aufeinander beziehbar,
heterogen und ziemlich groß.
W. Hartung weist auf nennenswerte Aspekte der sozial bestimmten Varietäten hin:
„Eine wichtige Rolle spielt zweifellos der jeweilige Erfahrungshorizont. Ein Teil der
charakteristischen sprachlichen Eigentümlichkeit etwa von Alters- und Berufsgruppen lässt
sich durch entsprechende Übereinstimmungen in den sozialen Erfahrungen solcher Gruppen
erklären. Das betrifft oft nur die Wortwahl oder ein besonderes Weltverständnis. Komplexere
Prägungen entstehen und verfestigen sich insbesondere dann, wenn der jeweilige
Erfahrungsraum eine Gruppe gleichzeitig besondere kommunikative Erfahrungen ermöglicht,
wenn der für eine Gruppe typische Kommunikationsbedarf und damit auch die
kommunikativen Anforderungen, denen jeder Angehörige der Gruppe gerecht werden muss,
weitgehend gleich oder ähnlich sind.“16
Die sozial bedingte sprachliche Eigentümlichkeit wird zu einem sprachlichen
Informationsträger einer sozialen Gruppe und dadurch übernimmt sie eine Funktion der
Selbst– und der Fremdidentifizierung von dieser Gruppe .
Die grundlegenden Parameter der sozialen Gruppierung für den Sprachgebrauch sind:
Alter: die jungen Menschen verstehen (und auch benutzen) als erste, was gerade
modern ist, die älteren, oder die ganz alten Menschen, die oft sprachlich konservativ
sind, benutzen diese modernen Ausdrücke nicht, oder erst nach einiger Zeit.
Geschlecht: es ist bewiesen, dass Frauen anders sprechen als Männer. Frauen benutzen
öfters z.B. Verkleinerungen. Wenn in manchen Fällen Männer so sprechen würden
wie die Frauen, dann würden sie als effeminiert eingesehen.
Berufsgruppe: In den meisten Berufen gibt es besondere Fachterminologie.17
16
Hartung, Wolfgang /Schönfeld, Helmut. Kommunikation und Sprachvariation. Berlin: Akademie Verlag
Berlin, 1981, S. 92
17
christianlehmann.eu – Varietäten einer Sprache.
http://www.christianlehmann.eu/ling/elements/index.html?http://www.christianlehmann.eu/ling/elements/varieta
eten.php 24.6.2014
141.4. Soziolekt
Der Soziolekt ist auch als Gruppensprache bekannt und bezeichnet die Sprache einer
bestimmten sozialen Gruppe (z.B. Freizeitsgruppe Jugendlicher).
Der Soziolekt ist also „eine der Varietäten, die typisch für eine bestimmte nach
sozioökonomischen und auch situativen und regionalen Merkmalen beschriebene
Sprechergruppierung einer Sprachgemeinschaft.“18
In Metzler-Lexikon Sprache wird der Begriff noch weiter definiert: „Damit nicht jede
Varietät oder Sprache als S. [Sprache] (nämlich der betreffenden Sprachgemeinschaft) gilt,
muss die Gruppe anders konstituiert sein als allein sprachlich, z.B. durch einen gemeinsamen
Hobby oder einen gemeinsamen Arbeitsplatz.“19
Soziolekte lassen sich in drei Gruppen gliedern:
transitorische Soziolekte, die zwischen Kinder-, Schüler-, Jugend- und
Erwachsenensprache unterscheiden. Diese Klassifizierung basiert auf der Tatsache,
dass es ein spezifisches Sprachverhalten in jedem Alter existiert. Am meisten wird die
Jugendsprache untersucht.
temporäres Soziolekt, was eine Sprache ist, die ausschließlich in einer bestimmen
Tages- oder Jahreszeit verwendet wird. Zu diesem Soziolekt gehört beispielsweise
das Jargon des Nachtlebens, aber auch die Gefängnissprache.
habituelle Soziolekte orientieren sich auf die Unterschiede zwischen der Sprache der
Frauen und Männer. Das Geschlecht wird als sozialer Parameter erforscht. Zur dieser
Gruppe gehören auch die Sprachen der Stadt- und Landbevölkerung. 20
18
Bausch, Karl-Heinz. Soziolekte. Lexikon der germanischen Linguistik. Herausgegeben von Hans P. Althaus,
Helmut Henne, Herbert E. Wiegend. Tübingen: 1973, S.254
19
Glück, Helmut (Hrsg.). Metzler-Lexikon Sprache. Digitale Bibliothek. Weimar, Stuttgart: Metzler Verlag.
2003, s. 8878. (vgl. MLSpr. S. 645)
20
Kováčová, Lucia. Der soziolinguistische Aspekt im Dialektgebrauch. Berliner Dialekt. Bachelorarbeit. Brno
http://is.muni.cz/th/341660/ff_b/bachelorarbeit.txt 25.6.2014
1516
2. Deutsche Gegenwartssprache
„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten
die Grenzen meiner Welt.“21
Ludwig Wittgenstein
Das vorliegende Kapitel beschäftigt sich mit der Problematik der deutschen
Gegenwartsprache, mit ihren Merkmalen, Kennzeichen, Spezifika, insbesondere mit dem
Wortschatz und auch der Syntax der Gegenwartsprache.
„Über die Sprache der Gegenwart spricht man nicht nur im Zusammenhang mit dem
aktuellen Zustand der Sprache, des Systems und des Gebrauchs unserer Sprache, weil die
Sprache kein autonomes Gebilde ist, sondern ein Vielzahl sozialer Faktoren entwickeltes
Sprachsystem.“22
Bevor ich mich mit der deutschen Gegenwartsprache beschäftige, halte ich für sinnvoll
den Begriff Sprache zu definieren:
„Die Sprache – ein mehrfunktioneller Spiegel menschlicher Verhaltensweisen – ist eines der
wichtigsten institutionalisierten Instrumente einer Gesellschaft. Sie ist nicht nur ein
Ausdrucks- und Kommunikationsmittel einer Gruppe, sondern auch selbst ein
gruppenbildender und gruppenkennzeichnender Faktor, was schon durch die Wortprägung
Sprachgemeinschaft signalisiert wird. Durch unsere Sprache wird sowohl unsere nationale
und regionale als auch die soziale Zugehörigkeit deutlich.“23
Die Sprache ist ein lebendiges und progressives Phänomen. Sie entwickelt sich,
formiert sich und verändert sich. Das gilt auch für die deutsche Sprache, die sich seit vielen
Jahrhunderten entwickelt. Vor der Gegenwartsprache wurde Althochdeutsch,
Mittelhochdeutsch, Frühneuhochdeutsch, und älteres Neuhochdeutsch im deutschsprachigen
Raum benutzt.
21
gutzitiert.de – Zitat zum Thema: Sprache.
http://www.gutzitiert.de/zitat_autor_ludwig_wittgenstein_thema_sprache_zitat_32746.html 10.7.2014
22
Glück, Helmut/ Sauer, Wolfgang Werner. Gegenwartsdeutsch. Stuttgart, Verlag J.B. Metzler. 1997. S.12
23
Hotz, Karl. Deutsche Sprache der Gegenwart. Entwicklung der Tendenzen. Stuttgart: Philipp Reclam Jun.
1977, S.85
17Jeder von diesen Sprachstufen hat eine besondere Aussprache, Intonation, Wortwahl,
Morphologie, Syntax usw.
Die Sprache, die man heutzutage üblicherweise benutzt, ist die Gegenwartsprache.
Dabei ist dieser Terminus ein bisschen verwirrend, weil jede Generation ihre Sprache als die
Gegenwartsprache bezeichnet, weil es in der Zeit Gegenwart war. Weil sich aber die Sprache
jeder Zeit verändert, hat jede Gegenwartsprache seine eigene Fachsprache, Dialekte,
Umgangssprache, Schriftsprache, verschiedene Sondersprachen usw.
Zur dieser Problematik äußert sich auch Herbert Berkley: „Unter Schriftsprache
verstehe ich dasselbe, was man auch Hochsprache, Standardsprache, im Osten sogar
Nationalsprache genannt hat. [...]Die Bezeichnung Nationalsprache könnte vielleicht
irreführend, denn mit ‚deutsch‘ meine ich natürlich den ganzen deutschsprachigen Raum.
Schriftsprache als die einheitliche Sprache der schriftlichen Kommunikation passt am besten,
weil wir hier keine räumliche Begrenzung anzugeben brauchen und wie hier das ebenfalls
sehr kontroverse Thema der gesprochenen Hochsprache über den landschaftlichen
Umgangssprachen und der Mundart nur kurz streifen können.“24
Die Gegenwartsprache, die in der heutigen Zeit benutzt wird, ist in Metzler-Lexikon
Sprache definiert als: „Wichtigstes und artspezif. [isches] Kommunikationsmittel der
Menschen, das dem Austausch von Informationen dient sowie epistem. [ische] (die
Organisation des Denkens betreffende) kognitive und affektive Funktionen erfüllt.“25
2.1. Wortschatz in der Gegenwartssprache
Jede Sprache in jeder ihrer Epoche ist in ihrem Wortschatz, ihrer Grammatik, usw.
spezifisch. Man sagt, dass die Sprache allgemein, und natürlich gilt es auch konkret für den
Wortschatz, die jeweilige Gesellschaft widerspiegelt.
In Metzler-Lexikon befindet sich die folgende Definition des Wortschatzes:
„Wortschatz (auch Lexik, Vokabular, Wortbestand, engl. Vocabulary, frz. Vocabulaire)
Gesamtheit der Lexeme einer Spr. [ache], bzw., einer Sprachgemeinschaft (zu einem
24
Schöne, Albrecht. Kontroversen, alte und neue. Sprachnormen: lösbare und unlösbare Probleme.
Herausgegeben von Peter von Polenz, Johannes Erben, Jan Goosens Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1986, S.
165, zitiert nach: http://is.muni.cz/th/215440/ff_m/Diplomova_prace_Teufertova.txt, 24.6.2014
25
Glück, Helmut (Hrsg.) Metzler Lexikon Sprache, Stuttgart/Weimar: Verlag J.B.Metzler, 2005, S.611
18bestimmten Zeitpunkt), wobei im einzelnen strittig ist, was jeweils als Lexem gezählt wird.
Das zeigen quantitative Angaben über den W. [ortschatz] der dt. Spr. [deutschen ache], die
zwischen 300.000 und 500.000 Lexemen schwanken.“26
„Der deutsche Wortschatz hat im Verlauf des 20. Jahrhunderts um etwa ein Drittel (...)
zugenommen. Dabei ist der Anstieg in der ersten Jahrhunderthälfte deutlicher als in der
zweiten. Der Zuwachs besteht nur zum geringen Teil aus eigenständigen neuen einfachen
Wörter wie rödeln oder mosern. Auch die Zahl der Fremdwörter wird überschätzt. Die
weitaus meisten neuen Wörter sind Ableitungen (wie Zocker von zocken) oder
Zusammensetzungen (wie Endlösung).“27
Viele neue Wörter sind Fachtermini (Fachwortschatz), oder Journalismen u.a.. Nur
eine geringere Zahl von neuen Wörtern kann man in der Belletristik finden.
„Das hat seinen Grund weniger darin, dass die Schriftsteller sprachlichen Neuerungen abhold
sind, sondern darin, dass in Zeitungen immer neue Themen auftauchen, und die erfordern
neue Wörter.“28
In der Wissenschaft entstehen auch nicht viele neue Wörter. Im allgemeinen kann man
sagen, dass es fast keine deutschsprachige Spitzenforschung mehr gibt. Dieses Phänomen, das
fast schon 30 Jahre existiert, ist nicht nur in der deutschen Sprache, sondern auch in der
französischen, oder italienischen Sprache zu sehen. Die Spitzenforschung beruht zunehmend
auf Arbeiten, die sich der englischen Sprache bedienen.
Weitere Wörter, die den Wortschatz in der deutschen Gegenwartssprache bilden,
gehören zum Slang, oder zu Anglizismen.
Laut der online Version von Duden wird „der aktive Wortschatz eines deutschen
Durchschnittssprechers heute auf 12 000 bis 16 000 Wörter (davon etwa 3 500 Fremdwörter)
geschätzt. Ohne Schwierigkeiten verstanden werden mindestens 50 000 Wörter.“29
26
Glück, Helmut (Hrsg.). Metzler-Lexikon Sprache. Digitale Bibliothek. Weimar, Stuttgart: Metzler
Verlag, 1993, S. 10 943 (vgl. MLSpr. S. 799)
27
www.welt.de – Die deutsche Sprache hat 5,3 Millionen.
Wörter.ttp://www.welt.de/kultur/article124064744/Die-deutsche-Sprache-hat-5-3-Millionen-Woerter.html
1.7.2014
28
ebd.
29
duden.de – Zum Umfang des deutschen Wortschatzes.
http://www.duden.de/sprachwissen/sprachratgeber/zum-umfang-des-deutschen-wortschatzes 1.7.2014
19Der Wortschatz von jedem Menschen gliedert sich in zwei Gruppen:
Rezeptiver Wortschatz (auch als passiver Wortschatz bezeichnet) – zur diesem
Wortschatz gehören alle Wörter, die ein Mensch (Sprecher) kennt, oder erkennt.
Dieser Wortschatz hilft dem Sprecher die gesprochene und geschriebene Sprache zu
verstehen.
Produktiver Wortschatz (auch als aktiver Wortschatz bezeichnet) – zu diesem
Wortschatz gehören alle Wörter, die ein Mensch (Sprecher) aktiv verwendet. Mit
diesem Wortschatz kann sich der Sprecher verständlich und klar auszudrücken. 30
2.2. Anglizismen in der deutschen Gegenwartssprache
Die englische Sprache verbreitet sich stark in den letzen Jahrzehnten. In der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde die deutsche Sprache durch Wortlehnung aus dem
Englischen geprägt, aber schon im 19. Jahrhundert wird die deutsche Sprache von der
englischen Sprache beeinflusst. Vor der englischen Sprache wurde das Deutsche noch von der
französischen Sprache und natürlich auch von der lateinischen Sprache stark beeinflusst.
In Metzler-Lexikon ist als Anglizismus jedes Wort bezeichnet, dass: „aus dem brit.
Englisch in eine andere Sprache übernommene bzw. entlehnte lexikal. [ische], idiomat,
[ische] oder syntakt. [ische] Einheit, z.B. Jogging/ joggen, Dampfmaschine < steam eingine,
Wolkenkratzer < skyscraper, Licht am Ende des Tunnels (sehen) < to see the light at the end
of the tunnel. Nachbildung einer im Eng. übl. [lischen ichen] im Dt. unübl. [Deutschen iche]
Konstruktion.“31
Mittlerweile gehört die englische Sprache zu Pflichtfächern in dem Schulsystem und
gehört auch zu den Grundvoraussetzungen bei vielen Jobs, weil diese Sprache die
Verhandlungssprache in vielen Unternehmen ist. Die junge und die mittlere Generation hat
mit der englischen Sprache keinerlei Problem. Wenn sie diese Sprache nicht perfekt
beherrschen, dann beherrschen sie sie zumindest passiv.
Manche Sprachwissenschaftler, unter die auch Karl Hotz gehört, meinen, dass die
große Zahl von fremden Ausdrücken keine erwünschte Bereicherung der deutschen Sprache
30
grammatiken.de – Wortschatz.
http://www.grammatiken.de/grammatik-glossar/wortschatz.html 4.8.2014
31
Glück, Helmut (Hrsg.). Metzler-Lexikon Sprache. Weimar, Stuttgart: Metzler Verlag. 1993, S. 41
20ist, sondern es geht hier um eine gezwungene und unnatürliche Veränderung des deutschen
Wortguts die ohne Grund stattfindet.32
Damit hängt auch die Übernahme von Anglizismen zusammen. Große Anzahl der
fremden Ausdrücke ist durch die Verbreitung von Films, Musik, durch Werbung, IT Bereich
usw. ins Deutsche gekommen. Es ist natürlich schwer alles so zu übersetzen und Ausdrücke
zu finden, dass alles passt und dass auch der Zweck gleich bleibt. Deshalb benutzt man viele
englische Ausdrücke, weil es einfach zu schwer, oder fast gar nicht möglich, z.B. die
verschiedensten Namen von Kosmetikprodukten zu übersetzen.
Der Sprachexperte Rudolf Hoberg sieht die Einflüsse der englischen Sprache dagegen
als Vorteil: „Diese sind nicht schlimm und haben der deutschen Sprache in der Vergangenheit
gut getan. Diese Entwicklung war auch immer eine Bereicherung für den Wortschatz. Er ist
so groß wie nie zuvor.[...] Schon um 1900 klagten die Deutschen über den Einfluss des
Englischen auf die deutsche Sprache. Genauso gab es einen Kampf gegen das
Französische.“33
Anglizismen sind so verbreitet, dass auch die Duden-Redaktion die Wörter, die von
den Menschen ausreichend oft benutzt sind, wie z.B. „Meeting“, oder „Stalkerin“ in das
Nachschlagwerk aufnimmt.
In dem deutschsprachigen Raum ist es auch üblich, nicht nur englische Ausdrücke zu
übernehmen und zu benutzen, sonder auch neue Wörter nach englischem Muster zu erfinden.
Diese Wörter sind als Pseudoanglizismen bekannt. Der wahrscheinlich bekannteste
Pseudoanglizismus ist das Wort „Handy“ als umgangssprachliche Bezeichnung des
Mobiltelefons. Das englische Wort „handy“ ist ein Adjektiv, nicht wie im Deutschen ein
Substantiv und bedeutet so viel wie „handlich, griffig“.
Die Verwendung von Anglizismen ist in Deutschland und Österreich sehr verbreitet.
Die Ausdrücke aus dem Englischen kann man in jedem Bereich finden: Fachsprache,
Journalistik, Jugendsprache, etc.. Es gibt mehrere Gründe, warum die Anglizismen in der
deutschen Sprache so verbreitet sind:
Sie sind Träger des Lokalkolorits,
Sprachökonomische Gründe
Verfremdungseffekt (Euphemismus)
32
sueddeutsche.de – Veränderung der deutschen Sprache.
http://www.sueddeutsche.de/kultur/veraenderung-der-deutschen-sprache-tradition-der-beschimpfung-1.1789617-
2 24.6.2014
33
radiobremen.de – "Denglisch" keine Bedrohung für die deutsche Sprache.
http://www.radiobremen.de/gesellschaft/themen/anglizismen100.html 25.6.2014
21 In und Out
Semantische Aufwertung
Die englischen Wörter treten ins Deutsche als Erscheinungsformen der lexikalischen
Übernahme und lassen sich in mehrere Gruppen gliedern:
Wortentlehnung – Übernahme der Lexeme aus einer anderen Sprache, wobei die
Lexeme auf die aufnehmende Sprache angepasst werden müssen.
Lehnübersetzung – Beispiel: Brainwashing – Gehirnwäsche „ist eine genaue Glied-
für-Glied Übersetzung eines fremdsprachlichen Ausdrucks in die eigene Sprache“34
Lehnübertragung Beispiel: Vaterland lateinisch patria – „freiere Übertragung eines
Wortes aus einer anderen Sprache“35
Lehnbedeutung – Beispiel: „realisieren in der aus dem Englischen [to realize]
entlehnter Bedeutung erkennen, sich klarmachen). Übernahme der Bedeutung eines
laut- od. bedeutungsähnlichen Wortes einer anderen Sprache.“36
Scheinanglizismen (oder auch Pseudoanglizismen) – diese Gruppe wurde bereits oben
behandelt.
2.3. Umgangssprache
Nach dem Metzler-Lexikon Sprache ist die Umgangssprache ein: „Bereich zwischen
Dialekten und Gemeinsprache bzw. Hochsprache, mittlerer Bereich dessen, was U. Ammon
die, dialektale Stufenleiter von der niedersten zur höchsten Sprachebene nennt; andererseits
als Stilschicht, z.B. umgangsprachl. [ich] neben familiär, salopp, derb, vulgär zur Markierung
stilist. [ischen] Werte in der Lexikographie. U. [mgangssprache] ist eine mündl[ich], nicht
schrift. [lich] fixierte Sprachform.“37
Die Umgangssprache steht in Opposition zur Standardsprache. Die Jugendsprache, die
für meine Arbeit maßgeblich ist, gehört zum Teilbereich der Umgangssprache. Die
Umgangssprache wird mehr verwendet als die Standardsprache, umgangssprachlich spricht
man i.d.R. in der Familie, mit Freunden und Bekannten, aber auch in der Schule, an den
34
Lewandowski, Theodor: Linguistisches Wörterbuch 2. Wiesbaden: Quelle & Meyer Verlag. 1990, S. 396
35
duden.de – Lehnübertragung.
http://www.duden.de/rechtschreibung/Lehnuebertragung 24.6.2014
36
universal_lexikon.deacademic.com – Definition des Wortes Lehnbedeutung.
http://universal_lexikon.deacademic.com/176127/Lehnbedeutung 25.6.2014
37
Glück, Helmut (Hrsg.): Metzler-Lexikon Sprache. Weimar, Stuttgart: Metzler Verlag. 1993, S. 662
22Ämtern usw. Die meisten Deutschen und Österreicher haben kein Problem, ihre
Standardsprache zu benutzen, die Umgangssprache ist aber jedoch beliebter. Dabei leben in
Deutschland und in Österreich auch Menschen, die die deutsche Standardsprache nicht
beherrschen, sondern nur eine Umgangssprache. Hier geht es meistens um Migranten aus
anderen Ländern, die keine, oder nur eine sehr geringe Gelegenheit hatten, die deutsche
Standardsprache zu lernen.
Genauso wie sich die Standardsprache entwickelt, entwickelt sich auch die
Umgangssprache ständig weiter. Zur der Entwicklung tragen viele Faktoren bei, z.B. ist es
der Internet, die Massenmedien und die Musik, aber auch die Kultur allgemein. Die
Umgangssprache wird auch von vielen Gruppensprachen beeinflusst, z.B. von der
Gefängnissprache, Soldatensprache, Sportlersprache usw.
2.3.1. Anglizismen in der Umgangssprache
Der Einfluss der englischen Sprache ist auch in der Umgangssprache sehr stark.
Anglizismen werden nicht nur von jungen Menschen in der Umgangssprache benutzt, sondern
auch von den älteren.
Die Anglizismen beeinflussen jeden Bereich der Sprache, am stärksten wird der
Wortschatz, dann die Syntax beeinflusst.
Insgesamt gelten auch hier die charakteristischen Merkmale, die im Zusammenhang
mit den Anglizismen in der deutschen Gegenwartssprache ausgeführt wurden.
2.3.2. Sog. Denglizismen in der Umgangssprache
Als Denglisch wird gelegentlich eine Mischsprache, die aus der deutschen und
englischen Sprache bezeichnet. Dabei werden nicht nur die einzelnen englischen Wörtern
und Wendungen ins deutsche übernommen, sonder auch die grammatische Struktur.
Es gibt mehrere meist informelle Bezeichnungen dieses Phänomens, z.B. Denglisch,
Denglish, aber auch Germish, oder Engleutsch. Alle diese Bezeichnungen sind Neologismen.
23Denglizismen werden nicht nur von Jugendlichen benutzt. Sehr beliebt sind sie auch
bei den Managern, in der Werbebranche, oder bei den Informatikern, also in den Bereichen,
wo man nur sehr schwer, oder fast gar nicht ohne englische Sprache funktionieren kann. Hier
spricht man aber nicht mehr über Umgangssprache, sondern über Slang, oder Jargon.
Man kann allgemein sagen, dass bei manchen Gruppen und Branchen die Gleichung
funktioniert – je mehr Denglisch man benutzt desto mehr „hip“ man ist.
Der Hauptunterschied zwischen Anglizismen und Denglizismen liegt nicht nur in den
fremden Wörtern allein, sondern auch, welche Stellung die Wörter in dem Satz haben.
243. Jugendsprache
„Wer auf andere Leute wirken will, der musst erst
einmal in ihrer Sprache mit ihnen reden. “38
(Kurt Tucholsky)
Meine Diplomarbeit habe ich der Jugendsprache gewidmet, weil es meiner Ansicht ein
sehr interessantes und breites Thema ist, das sich ständig entwickelt. Früher habe ich sehr oft
nachgedacht, woher die Wörter kommen und wer und wo man sie benutzt. Sehr oft ist mir
passiert, dass ein Jugendlicher etwas in Deutschland oder in Österreich einen Ausdruck oder
eine Wendung benutzt hat, die ich gar nicht verstanden habe. Weitere Überlegungen betrafen
die etwaigen regionalen Unterschiede. Es liegt nahe, dass die Jugendsprache in Deutschland
und in Österreich sehr ähnlich ist, aber Interessant ist es, dass es Wörter in dem
Jugendsprachewortschatz gibt, die nur in manchen Gebieten von Deutschland und Österreich
verwendet werden.
Eine der Fragen, mit der ich mich in meiner Diplomarbeit befassen werde ist, ob diese
Wörter auch in den Online-Jugendmagazinen vorkommen oder nicht.
Bevor ich mich der Jugendsprache und auch der Analyse von der Jugendsprache
widme, muss man erstmal einige weitere Begriffe, mit denen in dieser Arbeit gearbeitet wird,
erläutern. Die erste Frage, über die man nachdenken muss ist: Wer sind im Grunde
genommen die Jugendlichen?
Unter dem Wort „Jugend“ versteht man in unserer (westeuropäischen) Kultur einen
Lebensabschnitt eines jungen Menschen, zwischen Kindheit und Erwachsensein, dass heißt
ungefähr zwischen dem 13. und 21. Lebensjahr.
In Duden-Wörterbuch dagegen steht, ein Jugendlicher sei eine „..Person zwischen dem
14. und dem 18. Lebensjahr..“39 Die Bezeichnungen Teenie, oder Teenager (aus dem
Englischen) sind damit im Grunde genommen, inhaltlich vergleichbar, aber als Begriff sind
sie genauer, weil „teen“ ein Element der englischen Zahlwörter darstellt, (also von thirteen bis
nineteen– dreizehn bis neunzehn). Obwohl man es nicht eindeutig festlegen kann, mit
38
gutzitiert.de – Zitat zum Thema Jugendsprache.
http://www.gutzitiert.de/zitat_autor_kurt_tucholsky_thema_wirkung_zitat_3400.html 8.7.2014
39
duden.de – Definition des Wortes Jugendlicher.
http://www.duden.de/rechtschreibung/Jugendlicher 1.6.2014
25welchem Alter man eigentlich Jugendlicher ist, ist es für diese Arbeit nicht so wichtig.
Wichtiger wird eine weitere Frage sein: Wer liest die Jugendzeitschriften im Internet (welche
Altersgruppe von Menschen)? Beim online Jugendmagazin Bravo steht unter
Nutzungsbedingungen, dass man sich erst ab dem 12.Lebensjahr anmelden kann (damit man
per E-Mails Neuigkeiten gesendet bekommen kann). Weil es aber im Internet online steht, der
im gegebenen Raum heutzutage fast überall verbreitet ist, muss man damit rechnen, dass es
auch die Kinder unter 12 Jahren lesen. Allgemein kann man aber sagen, dass das
Durchschnittsalter von den Lesern irgendwo zwischen 12 und 15 Jahren ist, ältere
Jugendliche haben eher ein geringes Interesse für Jugendzeitschriften allgemein, dass heißt
dann auch für Online-Jugendzeitschriften.
3.1. Was ist Jugendsprache
Weil die Jugendsprache ein sehr breites Thema ist, gibt es sehr viele Studien,
Analysen, Thesen und natürlich auch eine große Zahl von Autoren die sich mit diesen Thema
beschäftigen. Zu den bedeutendsten Autoren gehören unter anderen auch H. Ehmann, R.
Sedlaczek – die auch mehrere Wörterbücher zur Jugendsprache verfasst haben, E. Neuland,
oder P. Schlobinski, der in seinem Buch schrieb: „Es gibt nicht die (eine) Jugendsprache“40.
Die Jugendsprache ist kurz und einfach gesagt eine Sprache (Umgangs- und
Alltagssprache), die in einer bestimmten Gruppe von Jugendlichen benutzt wird. Schlobinski
ist aber einer anderen Meinung: „Es gibt nicht die Jugendsprache, (im Gegensatz zu
Erwachsenensprache)...Es gibt nicht die Jugendsprache, sondern das Sprechen von
Jugendlichen.“41
Diese Thesen, die Schlobinski in seinem Werk veröffentlicht hat, sind natürlich
beachtenswert, zum Beispiel auch deshalb, wie Schlobinski weiter feststellt, dass es im
anglofonem Kontext keinen Terminus wie „language of youth“ oder „speech of adolescents“
gibt, statt dessen wird von „slang“ gesprochen wird42.
40
Schlobinski, Peter/ Kohl, Gaby/ Ludewigt, Irmgard. Jugendsprache: Fiktion und Wirklichkeit, Opladen:
Westdeutscher Verlag, 1993.S. 37
41
ebd.
42
Schlobinski, Peter/ Kohl, Gaby/ Ludewigt, Irmgard. Jugendsprache: Fiktion und Wirklichkeit, Opladen:
Westdeutscher Verlag, 1993.S. 37
26In Metzler-Lexikon Sprache finden wir eine fachliche Definition der Jugendsprache:
„Nicht präzise terminologisierter Begriff, Sammelbez.[eichnung] für Sprechweisen
Jugendlicher, für die auch Ausdrücke wie Studentenspr. [ache], Szenespr. [ache], Diskospr.
[ache], Psychospr. [ache], Teenager -Spr. [ache], und Soldatenspr. [ache] üblich sind.“43
Genau deshalb, dass die Jugendsprache keine „präzise terminologisierter Begriff“ ist,
meiden viele Sprachwissenschaftler in der Gegenwart den Begriff „Jugendsprache“
allgemein. Anstatt dessen bilden sie neue Begriffe für Benennung von diesem Phänomen. In
ihrer wissenschaftlichen Arbeit spricht zum Beispiel Susanna Augenstein über
„Sprechstil“44,Jiřina Malá dagegen über „Jugendslang“45.
Eine sehr gute Begriffsbestimmung kann man auch in dem Buch „Vernäht und
zugeflixt“ von Ilse Achilles und Gerda Pidgin finden. Sie nennen drei klare und kurze
Definitionen von der Jugendsprache:
„1. Sie (die Jugendsprache) existiert nur mündlich. Sie ist keine Schriftsprache.
2. Sie existiert nur in der Gruppe [...] Ein Jugendlicher allein entwickelt keine Jugendsprache
und sei er sprachlich noch so einfallsreich.
3. Sie ist kurzlebig. Nicht nur, dass Wörter und Slang sich ständig verändern. Auch die
Jugendlichen geben, sobald sie erwachsen sind, die Jugendsprache auf“46
Wenn man die Standardsprache vorwiegend den Erwachsenen zuordnen würde und
den Jugendlichen (in bestimmten kommunikativen Situationen) die Jugendsprache benutzen,
dann man etwas zugespitzt schlussfolgern, das die Sprache, die man in den Zeitschriften für
Jugend (egal ob in gedruckter Version oder online Version) verwendet, an sich keine
„Jugendsprache“, sondern eine Art Nachahmung von der „Jugendsprache“.
Obwohl der Terminus „Jugendsprache“ nicht präzise ist, werde ich ihn in dieser Arbeit
benutzen – im Sinne der geläufigen Bezeichnung mit Berücksichtigung der skizzierten
Abgrenzungen.
43
Glück, Helmut (Hrsg.): Metzler-Lexikon Sprache. Digitale Bibliothek. Stuttgart.Weimar: Metzler Verlag.,
2003, S. 4491, (vgl. MLSpr. S. 326)
44
Augenstein, Susanne. Funktionen von Jugendsprache. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1998
45
Malá, Jiřina. Einführung in die deutsche Stilistik., Brno: Masarykova Univerzita, 2003
46
Achilles, Ilse/ Pighin, Gerda. Venäht und zugeflixt! Mannheim: Duden, 2008, S.38
27Sie können auch lesen