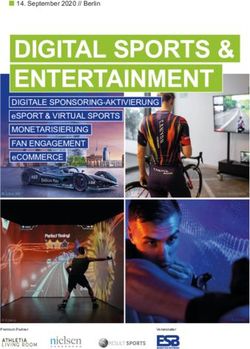Executive Report der GECKO-Sitzung vom 23. Januar 2023
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Überblick
• Stellungnahme der GECKO-Kommission zur avisierten Aufhebung der COVID-
19-Maßnahmengesetzgebung
Aus Sicht von GECKO muss bei der von der Bundesregierung für das erste Halbjahr
2023 geplanten Abschaffung der Meldepflicht für SARS-CoV-2 sowie des COVID-
19-Maßnahmengesetzes und weiterer rechtlicher Bestimmungen vor allem darauf
geachtet werden, ein entsprechendes Level an Surveillance weiterhin aufrecht zu
erhalten, um unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen die
Virusbelastung in der Gesamtbevölkerung zu beurteilen. Zudem ist der Schutz
vulnerabler Gruppen auch weiterhin in den Fokus zu stellen.
• Erste Erkenntnisse zu XBB.1.5
Der Omikron-Subtyp XBB.1.5 scheint deutlich leichter übertragbar zu sein als
andere Omikron-Subvarianten. In den USA ist XBB.1.5 aktuell die dominante
Variante.
• Update zum Wissensstand zur Pandemiesituation in China
Die Omikron-Subvarianten BF.7 und BA.5.2 sind in China dominant. Bezüglich
Fallzahlen, Hospitalisierungen und Todesfälle in China bleibt die Datenlage
unübersichtlich. Das von China ausgehende epidemiologische Risiko ist daher
schwierig einzuschätzen.
• Immunologisches Gedächtnis
Sowohl Corona-Schutzimpfungen als auch durchgemachte COVID-19-Infektionen
hinterlassen ein dauerhaftes immunologisches Gedächtnis, das vermutlich
jahrelang bestehen bleibt – das zeigen neueste Studien.
Executive Report der GECKO-Sitzung vom 23. Januar 2023 2 von 21• Effektivität bivalenter Varianten-Impfstoffe
Eine aktuelle Studie aus Israel mit mehr als 700.000 Studienteilnehmer:innen
zeigt, dass bivalente COVID-19-Impfstoffe Hospitalisierungen um 81 % und
Todesfälle um 86 % reduzieren.
• Health Literacy: Gesundheitskompetenz der österreichischen Bevölkerung
Eine aktuelle Erhebung zeigt: Im Zeitraum von 2020 bis 2022 veränderte sich die
Gesundheitskompetenz der österreichischen Bevölkerung kaum. Insbesondere
das Beurteilen und Abwägen von Gesundheitsinformationen fällt vielen schwer.
Executive Report der GECKO-Sitzung vom 23. Januar 2023 3 von 21Inhalt Überblick ....................................................................................................................... 2 Ausgangslage ................................................................................................................. 5 Prognose........................................................................................................................ 5 Aktuelle internationale Lage .......................................................................................... 6 Aktuelle Themen der GECKO-Kommission ...................................................................... 7 Stellungnahme der GECKO-Kommission zur avisierten Aufhebung der COVID-19- Maßnahmengesetzgebung ..................................................................................................... 7 Omikron-Varianten Update: Erste Erkenntnisse zu XBB.1.5 .................................................. 8 Update zum Wissensstand zur Pandemiesituation in China.................................................. 9 Update zur Dauer der Schutzwirkung der COVID-19-Impfung vor Infektion, schweren Krankheitsverläufen und Tod ............................................................................................... 10 Immunologisches Gedächtnis .............................................................................................. 12 Impfkommunikation aus epidemiologischer und medizinsicher Sicht ................................ 13 Health Literacy: Gesundheitskompetenz der österreichischen Bevölkerung ...................... 13 COVID-19-Medikamente ...................................................................................................... 15 Aktuelle Lage in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen ................................................ 16 Aktuelles Pandemiemanagement im EU-Vergleich ............................................................. 16 Gastvortrag Thomas Czypionka: Wirtschaftlicher Impact der Pandemie ............................ 18 Über die Kommission zur gesamtstaatlichen COVID-Krisenkoordination (GECKO) ......... 20 Impressum ................................................................................................................... 21 Executive Report der GECKO-Sitzung vom 23. Januar 2023 4 von 21
Ausgangslage
Für 23. Januar 2023 wurden österreichweit 2.612 SARS-CoV-2-Neuinfektionen gemeldet.
Die 7-Tage-Inzidenz lag an diesem Tag bei 159,4.
608 Personen befanden sich aufgrund einer COVID-19-Erkankung in Spitalsbehandlung,
davon 51 Personen auf Intensivstationen (sämtliche Zahlen laut AGES-Dashboard)1.
Update Influenza- und RSV-Geschehen
Derzeit verzeichnet Österreich noch eine epidemische Influenzaaktivität, jedoch zeigt sich
ein deutliches Absinken der Fallzahlen. In Kalenderwoche 3 lag die Positivitätsrate der
nachgewiesenen Influenzafälle bei 11 Prozent. Die Influenzawelle, die in Kalenderwoche
46 des Jahres 2022 begonnen hat, hat ihren Höhepunkt damit überschritten und ist seit
Ende Dezember2022 konstant rückläufig.
Auch die RSV-Fallzahlen sind weiter rückläufig. Die Positivitätsrate liegt bei knapp 10
Prozent. Vorausgesetzt der Trend hält an, ist davon auszugehen, dass die derzeit noch
epidemische RSV-Aktivität in den nächsten Wochen in eine sporadische Aktivität
übergeht.
Prognose
Die Prognose geht weiterhin von einem leichten Rückgang des Normalstationsbelags aus
und annähernd gleichbleibenden Intensivstationsbelagszahlen. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass der Rückgang des gemeldeten Spitalsbelags teilweise auf die
Reduktion der Testungen an asymptomatischen Personen zurückzuführen ist.
Die Dynamik der Entwicklung der COVID-19-Fallzahlen unterscheidet sich momentan nach
den Altersgruppen. Während bei über 65-Jährigen nach wie vor eine rückläufige Tendenz
sichtbar ist, zeigt sich bei den jüngeren Bevölkerungsgruppen eine gleichbleibende bis
1
https://covid19-dashboard.ages.at/dashboard.html (abgerufen am 24.01.2023)
Executive Report der GECKO-Sitzung vom 23. Januar 2023 5 von 21leicht ansteigende Entwicklung. Die Daten aus dem Abwassermonitoring weisen derzeit auf keine eindeutige Trendentwicklung hin. Übersicht auf der Webseite Datenplattform COVID-19: COVID-Prognose-Konsortium 2022 Datenbestand vom 24. Januar 2023: https://datenplattform- covid.goeg.at/sites/datenplattform- covid.goeg.at/files/Prognosen/2023/Prognose%20vom%2024.01.2023.pdf Aktuelle internationale Lage Anfang 2023 zeigten die gemeldeten Daten mit Ende der Kalenderwoche 2 eine Verbesserung der allgemeinen epidemiologischen Situation im EU/EEA-Raum. Die 14-Tages-Inzidenz in den EU/EEA-Ländern sinkt seit vier Wochen. Sie liegt bei einem Wert von 160,7. Die Aufnahmeraten auf den Normalstationen sinken seit drei Wochen, jene auf Intensivstationen sinken seit zwei Wochen. In den zehn EU/EEA-Ländern mit ausreichendem Sequenzierungsvolumen zeigte sich folgende Variantenverteilung: 49 % BQ.1; 24,3 % BA.5; 12,7 % BA.2.75; 2,7 % XBB; 1,4 % XBB.1.5; 0,8 % BA.2; 0,8 % BA.4. Weltweit ist im Zeitraum von 9. bis 15. Januar 2023 die Zahl der Fälle in den letzten 28 Tagen um sieben Prozent gesunken. Es wurden 13 Millionen neue Fälle gemeldet. Die WHO weist darauf hin, dass die Zahlen mit Vorsicht interpretiert werden sollten, da insgesamt weniger getestet wird und es aufgrund der Feiertage und des Jahreswechsels bei einigen Ländern zu verspäteten Meldungen gekommen ist. Das Update enthält Fallzahlen aus China bis zum 15.01.2023. Executive Report der GECKO-Sitzung vom 23. Januar 2023 6 von 21
Aktuelle Themen der GECKO-Kommission Die GECKO-Kommission tagte am 23. Januar 2023 unter der Leitung von Dr. Katharina Reich und General Rudolf Striedinger. Folgende Themen wurden von den Expert:innen diskutiert und die hier dargestellten Einschätzungen der Bundesregierung übermittelt. Stellungnahme der GECKO-Kommission zur avisierten Aufhebung der COVID-19-Maßnahmengesetzgebung Die Bundesregierung hat die GECKO-Kommission gebeten, zu den Implikationen der geplanten Aufhebung sämtlicher Corona-Maßnahmen im ersten Halbjahr 2023, insbesondere der Abschaffung der Meldepflicht für SARS-CoV-2 sowie des COVID-19- Maßnahmengesetzes und weiterer rechtlicher Bestimmungen, Stellung zu nehmen. Aus Sicht von GECKO muss dabei vor allem darauf geachtet werden, ein entsprechendes Level an Surveillance2 weiterhin aufrecht zu erhalten. Insbesondere das Abwassermonitoring und die genomische Surveillance (Sequenzierung von positiven Proben) haben sich als probate Mittel erwiesen, um die Virusbelastung in der Gesamtbevölkerung zu beurteilen. Dabei ist auch in Betracht zu ziehen, die Erreger anderer respiratorischer Infekte (etwa RSV, Influenza) zusätzlich zu SARS-CoV-2 in dieses Surveillance-System mit aufzunehmen. Sofern das individuelle Testregime in größerem Ausmaß eingestellt werden sollte, sind ggf. Übergangsbestimmungen anzudenken, durch die eine ausreichende Menge an Proben zur genomischen Surveillance sichergestellt wird (analog zum DINÖ für Influenza). Die Sammlung und Analyse bisheriger und zukünftiger Daten zu SARS-CoV-2, unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen, sollte daher einen wichtigen und unerlässlichen Aspekt in der Planung der Überführung des Pandemiemanagements in den Regelbetrieb darstellen. Weiters ist der Schutz vulnerabler Gruppen auch weiterhin und insbesondere bei Auslaufen des derzeitigen Regelwerks in den Fokus zu stellen. Bei den COVID-19- 2 Bzgl. der einzelnen Bestandteile eines Surveillance-Systems sei auf die Ausführungen im Executive Report der GECKO-Sitzung vom 23.11.2022 verwiesen: https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:a9fdec65- 110b-40cf-846c-142e421b084d/20221125_gecko_executive_report.pdf Executive Report der GECKO-Sitzung vom 23. Januar 2023 7 von 21
Medikamenten muss die Beschaffung und Verabreichung in den Regelbetrieb übernommen werden. Abschließend weist GECKO darauf hin, dass mit Aufhebung der rechtlichen COVID- Maßnahmen Implikationen auf viele weitere Normen, insbesondere im ASVG, aber auch in thematisch anders gelagerten Materien wie z.B. dem Strafrecht, verbunden sind. Auch sind spezifische Möglichkeiten des Epidemiegesetzes wie Einreisebeschränkungen an die Meldepflicht gekoppelt. Diese Auswirkungen sind im Einklang mit den Plänen zur Überführung der COVID-Regelungen in einen Regelbetrieb eingehend zu prüfen und zu beurteilen. Omikron-Varianten Update: Erste Erkenntnisse zu XBB.1.5 (AG Omikron: Schernhammer, Puchhammer, Kollaritsch, Bergthaler, Popper; unter Beiziehung Aberle; AG Gesundheitsdaten & Reportings: Bergthaler, Popper, Ditto, Kollaritsch, Striedinger, Platzer, Reiter) Die Subvariante XBB.1.5 scheint deutlich leichter übertragbar zu sein als andere zirkulierende Omikron-Subvarianten wie beispielsweise BQ.1.1. Die Wirksamkeit von Impfung und monoklonalen Antikörper-Therapien dürfte eingeschränkt zu sein. 3 Es gibt Hochrechnungen, dass die Prävalenz von XBB.1.5 in den kommenden Wochen in verschiedenen Ländern stark zunehmend wird.4 Der Omikron-Subtyp XBB.1.5 wurde bisher in 46 Ländern nachgewiesen.5 Der Großteil der Fälle tritt bisher in den USA auf, wo XBB.1.5 landesweit mit fast 50 % die dominante Variante ist. In den nordöstlichen Bundesstaaten der USA ist XBB.1.5 für teilweise mehr als 80 Prozent der Infektionsfälle verantwortlich. In Europa ist XBB.1.5 noch in verhältnismäßig geringem Ausmaß vorhanden und in Österreich war XBB.1.5 Anfang Januar in mehr als der Hälfte der Kläranlagen auf zumeist sehr geringen Niveau detektierbar. In der repräsentativen fall- basierten Surveillance wurde XBB.1.5 in 6 % der Proben von Kalenderwoche 2 detektiert (AGES/IMBA). 3 Alarming antibody evasion properties of rising SARS-CoV-2 BQ and XBB subvariants: Cell und: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2214314?query=featured_coronavirus 4 SARS-CoV-2-International/variant-share-latest.png at main · gerstung-lab/SARS-CoV-2-International · GitHub 5 https://cov-spectrum.org/explore/World/AllSamples/Past6M/variants?nextcladePangoLineage=xbb.1.5& Executive Report der GECKO-Sitzung vom 23. Januar 2023 8 von 21
Derzeitige Einschätzungen, die durch die limitierte Datenlage erschwert sind, gehen von
keiner erhöhten Pathogenizität bei Infektionen mit XBB.1.5 aus. Die EU-
Gesundheitsbehörde ECDC stuft das Risiko im Zusammenhang mit XBB.1.5 für
unvollständig bzw. nicht geimpfte Vulnerable derzeit als moderat bis hoch ein.6 Eine
gravierende Veränderung der epidemiologischen Situation wird bisher nicht
angenommen.
Update zum Wissensstand zur Pandemiesituation in China
(AG Omikron: Schernhammer, Puchhammer, Kollaritsch, Bergthaler, Popper; unter Beiziehung Aberle)
Insgesamt ist der Wissensstand zur Pandemiesituation in China von einer unklaren
Datenlage geprägt. Variantenseitig lassen sich aufgrund der verhältnismäßig wenigen
verfügbaren Sequenzierungsdaten aus China (1196 aus 15 Provinzen von 1.12.2022 bis
20.1.2023) nur bedingt Aussagen treffen. Die Omikron-Subvarianten BF.7 und BA.5.2
überwiegen dabei mit 80 Prozent. Bezüglich Hospitalisierungen und Todesfällen aufgrund
von COVID-19 bleibt die Datenlage unübersichtlich. Die WHO hat am 14.1.2023 mehr
Daten aus China erhalten, aus denen hervorgeht, dass die Infektionswelle in China
verstärkt vulnerable Bevölkerungsschichten betrifft und die Gesundheitsdienste starker
Belastung ausgesetzt sind.
In Europa und auch Österreich werden verstärkte Surveillanceanstrengungen im
Zusammenhang mit Einreisen aus China unternommen. Das epidemiologische Risiko, das
von China ausgehen mag, ist schwierig einzuschätzen angesichts von Aspekten wie
beispielsweise der sich ausbreitenden Variante XBB.1.5, die seinen Ursprung in
Nordamerika hat.
Prognose Pandemiegeschehen China
Aufgrund der nur limitiert vorliegenden Daten aus China ist es schwierig, konkrete
Szenarien und Risiken festzumachen. Schätzungen von bis zu 950 Millionen infizierten
Personen in China seit den Öffnungsschritten legen nahe, dass damit auch die
Wahrscheinlichkeit der Entstehung neuer Varianten steigt. Ob diese aber gefährlicher sein
6
Implications for the EU/EEA of the spread of the SARS-CoV-2 Omicron XBB.1.5 sub-lineage (europa.eu)
Executive Report der GECKO-Sitzung vom 23. Januar 2023 9 von 21könnten als die schon bei uns in Europa zirkulierenden Varianten mit starken
Immunfluchteigenschaften, ist unklar.
Update zur Dauer der Schutzwirkung der COVID-19-Impfung vor
Infektion, schweren Krankheitsverläufen und Tod
(AG Omikron: Schernhammer, Puchhammer, Kollaritsch, Bergthaler, Popper; unter Beiziehung Aberle)
Der GECKO Executive Report vom 23. November 20227 geht ausführlich auf die Effektivität
der Corona-Schutzimpfung ein.
Auch der aktuelle Bericht der britischen Gesundheitsbehörde UK Health Security Agency
(UKHSA)8 bestärkt die bisherigen Aussagen zur Effektivität der Corona-Schutzimpfung:
Impfungen gegen COVID-19 vermitteln einen nur über einige Wochen anhaltenden
Infektionsschutz9, einen etwas längeren, über wenige Monate anhaltenden Schutz vor
symptomatischer Infektion und einen lange anhaltenden (mehr als 6 Monate) Schutz vor
schwerer Infektion, Hospitalisierung und Tod.
Beeinflusst werden diese Zeitangaben zur Dauer des Schutzwirkung der Impfungen
gegen COVID-19 durch mehrere Faktoren:
• durch das Auftreten neuerer Virusvarianten, die bessere Immunflucht und/oder
höhere Infektiosität10 besitzen. Dies dürfte in besonderem Ausmaß für XBB.1.5
gelten11
• durch die Immunkompetenz der Geimpften
• durch (zusätzlich) durchgemachte COVID-19-Infektionen
• im Falle einer Infektion durch die infizierende Virusvariante
7
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:a9fdec65-110b-40cf-846c-
142e421b084d/20221125_gecko_executive_report.pdf
8
COVID-19 vaccine surveillance report: week 48 (publishing.service.gov.uk)
9
Infectiousness of SARS-CoV-2 breakthrough infections and reinfections during the Omicron wave | Nature
Medicine
10
Substantial Neutralization Escape by SARS-CoV-2 Omicron Variants BQ.1.1 and XBB.1 (nejm.org)
11
ebd.
Executive Report der GECKO-Sitzung vom 23. Januar 2023 10 von 21• durch den verabreichten Impfstoff12 • durch die Zahl der verabreichten Impfungen13 Einige Studien belegen den positiven Effekt auf den Immunschutz durch die Auffrischungsimpfung mit einem bivalenten COVID-19-Varianten-Impfstoff. Ähnliches gilt für den Infektionsschutz bei Personen, die nach einer Infektion geimpft wurden, wie Daten aus Dänemark14 belegen. Laborbasierte Studien15 zeigen eindeutig, dass Auffrischungsimpfungen mit einem bivalenten Varianten-Impfstoff eine verbesserte neutralisierende Immunantwort gegen die Omikron-Subvarianten BA.5 und auch gegen XBB hervorrufen. Eine aktuelle Studie aus Israel16 zeigt bei mehr als 700.000 Studienteilnehmer:innen, wovon rund 85.000 über 65 Jahre alt waren, dass die bivalenten COVID-19-Vakzine die Hospitalisierungen um 81 % und die Todesfälle um 86 % reduzieren. Auch zwei Studien17 aus den USA zeigen, dass ein bivalenter angepasster COVID-19-Impfstoff bei Personen mit mindestens zwei vorangegangenen monovalenten Impfungen einen zusätzlichen Schutz vor schwerem COVID-19-Verlauf und Hospitalisierung gewährleisten. Beide Publikationen differenzieren dabei nicht, ob ein Unterschied in der Wirksamkeit der Auffrischungsimpfung abhängig von der Zahl der Vorimpfungen ist. Die Autoren gehen von der Annahme aus, dass das Immungedächtnis bereits nach zwei Impfungen gut genug ausgebildet ist, um später auf eine Auffrischungsimpfung adäquat zu reagieren. Die Studien beziehen ihre Aussagen zur Effektivität der Corona-Schutzimpfung auf eine 12 Enhanced SARS-CoV-2 IgG durability following COVID-19 mRNA booster vaccination and comparison of BNT162b2 with mRNA-1273 - Annals of Allergy, Asthma & Immunology (annallergy.org) 13 ebd. 14 Vaccine effectiveness against SARS-CoV-2 reinfection during periods of Alpha, Delta, or Omicron dominance: A Danish nationwide study | PLOS Medicine 15 Immunogenicity of BA.5 Bivalent mRNA Vaccine Boosters (nejm.org) und: Antibody Response to Omicron BA.4–BA.5 Bivalent Booster (nejm.org) 16 Effectiveness of the Bivalent mRNA Vaccine in Preventing Severe COVID-19 Outcomes: An Observational Cohort Study by Ronen Arbel, Alon Peretz, Ruslan Sergienko, Michael Friger, Tanya Beckenstein, Shlomit Yaron, Ariel Hammerman, Natalya Bilenko, Doron Netzer :: SSRN 17 https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm715152e2.htm#:~:text=What%20is%20added%20by%20t his,past%20monovalent%20mRNA%20vaccination%20only. und: Early Estimates of Bivalent mRNA Vaccine Effectiveness in Preventing COVID-19–Associated Emergency Department or Urgent Care Encounters and Hospitalizations Among Immunocompetent Adults — VISION Network, Nine States, September–November 2022 | MMWR (cdc.gov) Executive Report der GECKO-Sitzung vom 23. Januar 2023 11 von 21
Population, die erwartungsgemäß auch zum Teil natürliche Infektionen in variablem Abstand zur Corona-Schutzimpfung erlebt haben, spiegeln also ein „real world“ Szenario wider, wie es auch in der österreichischen Bevölkerung zu finden ist. Immunologisches Gedächtnis (AG Omikron: Schernhammer, Puchhammer, Kollaritsch, Bergthaler, Popper; unter Beiziehung Aberle) Sowohl Corona-Schutzimpfungen als auch durchgemachte COVID-19-Infektionen hinterlassen ein dauerhaftes immunologisches Gedächtnis, das vermutlich jahrelang bestehen bleibt. Das zeigen neueste Studien zu immunologischen Auswirkungen von Corona-Schutzimpfungen 18 oder auch Daten19 zur Immunitätsausbildung nach Infektionen. Es zeigt sich, dass eine Hybridimmunität, ausgelöst durch eine Grundimmunisierung durch die Corona-Schutzimpfung plus eine durchgemachte COVID- 19-Infektion den besten Schutz und das beste Immungedächtnis beim Betroffenen induziert. Es ist jedoch nicht vorhersehbar, welche Entwicklungen im Bereich der Virusvarianten zu erwarten sind. Es ist denkbar, wenn gleich nicht sehr wahrscheinlich, dass – ähnlich wie bei Influenza in den vergangenen Dekaden erlebt – eine massive Veränderung der antigenetischen Struktur des Virus die Bedeutung bisheriger erworbener Immunitäten durch Infektion und/oder Impfung deutlich mindert. 18 Immunological memory to SARS-CoV-2 infection and COVID-19 vaccines - PMC (nih.gov) 19 Duration of immune protection of SARS-CoV-2 natural infection against reinfection | Journal of Travel Medicine | Oxford Academic (oup.com) Executive Report der GECKO-Sitzung vom 23. Januar 2023 12 von 21
Impfkommunikation aus epidemiologischer und medizinsicher Sicht (AG Omikron: Schernhammer, Puchhammer, Kollaritsch, Bergthaler, Popper; unter Beiziehung Aberle) Da der aktuelle Forschungsstand die begrenzte Dauer des Immunschutzes und zugleich die Effektivität der Auffrischungsimpfung belegt, ist empfohlen, Personen, die bisher nur zwei- oder dreimal geimpft sind und deren letzte Impfung länger zurückliegt, direkt auf das Impfangebot anzusprechen. Dies gilt für alle Altersgruppen ab dem 5. Lebensjahr, da die Impflücken in Bezug auf die Corona-Schutzimpfung in der gesamten österreichischen Bevölkerung zunehmen. Auch Personen mit einer lange zurück liegenden Infektion ohne weitere Impfungen sollten über den durch eine Auffrischungsimpfung erzielbaren Zusatzschutz informiert werden. Nach wie vor gilt dies insbesondere für alle Personen mit eingeschränkter Immunfunktion. An dieser Stelle sei auf die vom NIG ausgearbeitete Impfempfehlung verwiesen. Impfkommunikationsmaßnahmen sollten vermutlich vor dem Herbst wieder verstärkt durchgeführt werden – insbesondere bei parallel zu COVID-19 verstärkter Infektionsdynamik durch Influenza und RSV. Es ist nicht ausreichend, sich in der Impfkommunikation auf COVID-19 und dessen Prävention zu beschränken. Die Auswirkungen der oft synchron auftretenden RSV und Influenzaerkrankungen im Kontext mit COVID stellen aus medizinischer und systemrelevanter Sicht die weitaus größere Bedrohung dar als dies COVID-19 alleine ist. Health Literacy: Gesundheitskompetenz der österreichischen Bevölkerung (AG Kommunikation und Psychosoziale Faktoren: Partheymüller, Böhm, Steinhart) Die Gesundheitskompetenz (health literacy) wurde im Rahmen von ACPP zuletzt Ende März 2022 abgefragt20. Dabei wurden ausgewählte Fragen aus dem European Health 20 Holl, Florian, Christina Walcherberger, Thomas Resch und Julia Partheymüller (2022): “Gesundheitskompetenz in Zeiten von COVID-19”, URL: https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/corona-blog- beitraege/blog148/ Executive Report der GECKO-Sitzung vom 23. Januar 2023 13 von 21
Literacy Survey (HLS-EU 2011, Juli bis August 2011)21 übernommen, die auch bereits in der Frühphase der Pandemie im Rahmen der Gesundheitskompetenz-Erhebung (HLS19-AT, März bis Mai 2020)22 abgefragt wurden. Die Gesundheitskompetenz-Erhebung aus dem Jahr 2020 (HLS 19-AT) ließ nur eine leichte Verbesserung der Gesundheitskompetenz in Österreich erkennen. Im Zeitraum von 2020 bis 2022 veränderte sich die Gesundheitskompetenz kaum. Die geringfügigen Unterschiede, die tendenziell in Richtung einer Verschlechterung der Gesundheitskompetenz hindeuteten, könnten durch methodische Aspekte des Befragungsmodus bedingt sein (Telefon- vs. Onlinebefragung). Insgesamt bestätigten die Ergebnisse von 2022 die bereits in 2020 ermittelten Muster. Die größten Schwierigkeiten zeigten sich im Zusammenhang mit der digitalen Gesundheitskompetenz (digital health literacy), wie z.B. dem Beurteilen des Einflusses von wirtschaftlichen Interessen und der Vertrauenswürdigkeit von Gesundheitsinformationen aus dem Internet. Aber auch das eigenständige Abwägen von Vor- und Nachteilen von Behandlungen sowie der Umgang mit psychischen Problemen stellten für die Mehrheit der Befragten eine Herausforderung dar. Am einfachsten war es für die Befragten, den Empfehlungen ihres Arztes, ihrer Ärztin oder Apothekers oder Apothekerin zu folgen. Es zeigte sich zudem ein (schwacher) statistischer Zusammenhang zwischen dem Gesundheitskompetenz-Index und der Impfquote, wobei Personen mit einer sehr geringen Gesundheitskompetenz die geringste Impfquote aufwiesen23. Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass die Gesundheitskompetenz in Österreich weiterhin eher gering ist, sich in den vergangenen Jahren trotz der enorm hohen Salienz des Gesundheitsthemas kaum verbessert hat und insbesondere das Beurteilen und Abwägen von Gesundheitsinformationen der Bevölkerung Schwierigkeiten bereitet. 21 Sørensen, K., Pelikan, J. M., Röthlin, F., Ganahl, K., Slonska, Z., Doyle, G., ... & Brand, H. (2015). Health literacy in Europe: Comparative results of the European health literacy survey (HLS-EU). European Journal of Public Health, 25(6), 1053-105: https://doi.org/10.1093/eurpub/ckv043 22 Griebler, Robert; Straßmayr, Christa; Mikšová, Dominika; Link, Thomas; Nowak, Peter und die Arbeitsgruppe Gesundheitskompetenz-Messung der ÖPGK (2021): Gesundheitskompetenz in Österreich: Ergebnisse der österreichischen Gesundheitskompetenzerhebung HLS19-AT. Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Wien. https://oepgk.at/wp- content/uploads/2021/08/hls19-at-bericht-bf.pdf 23 Holl, Florian, Christina Walcherberger, Thomas Resch und Julia Partheymüller (2022): “Gesundheitskompetenz in Zeiten von COVID-19”, URL: https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/corona-blog- beitraege/blog148/ Executive Report der GECKO-Sitzung vom 23. Januar 2023 14 von 21
COVID-19-Medikamente
(AG Medikamente: Mursch-Edlmayr, Müller, Schörghofer, Popper; unter Beiziehung Neiß, Pernsteiner)
In Österreich sind weiterhin, unter Berücksichtigung der aktuellen Verbrauchsdaten,
ausreichend Arzneimittel zur Behandlung von COVID-19 verfügbar. Die
Verteilungsprozesse zur intramuralen und extramuralen Bereitstellung der Arzneimittel
sind etabliert, sodass derzeit keine Engpässe bekannt sind.
Der aktuelle Verbrauch der COVID-19-Arzneimittel (Anzahl der Behandlungen) ist der
nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.
Lieferung Abruf Auslieferung Verab- Verab- Restbestand
nach durch an reichung reichung (Lieferung –
Österreich SPOC Apotheken intramural niederge- Verab-
lassener reichung)
Ärzte
Xevudy® 28.585 12.556 -9.018 19.567
(Sotrovimab,
VIR-7831)
Lagevrio® 123.642 28.559 12.143 -18.792 -3.739 101.111
(Molnupiravir)
Regkirona® 60.000 4.072 -109 59.891
(Regdanvimab)
Paxlovid® 179.997 38.743 70.009 -22.822 -42.172 115.003
(PF-07321332
+ Ritonavir)
Evusheld® 8.640 5.089 -3.529 5.111
(AZD7442)
Zusatzerklärungen:
Lieferungen nach Österreich: mit dem Hersteller vertraglich vereinbarte und bis 3. Januar gelieferte Menge.
Abruf durch SPOC: von den SPOC (single point of contact; 1/Bundesland) Apotheken bis 3. Januar bestellte
und an die Landeskrankenanstalten ausgelieferte Menge.
Auslieferung an Apotheken: an öffentliche Apotheken bis 3. Januar ausgelieferte Menge.
Verabreichung intramural: Anzahl an Behandlungen in den Krankenanstalten bis 3. Januar.
Verabreichung niedergelassene Ärzt:innen: Anzahl an Behandlungen durch niedergelassene Ärzt:innen bis
31. Dezember; bisher nur bei Paxlovid® vorgesehen; seit 1. September auch für Lagevrio® vorgesehen; in
weiterer Folge monatliche Aktualisierung.
Die Lieferungen nach Österreich sind den jeweiligen Verträgen und den Informationen der Herstellerfirmen
Executive Report der GECKO-Sitzung vom 23. Januar 2023 15 von 21entnommen, die Auslieferungen und Anzahl der Behandlungen basieren auf Rückmeldungen der Bundesländer, PHAGO und Apothekerkammer. Aktuelle Lage in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen (AG Schutz kritische Infrastruktur: Ditto, Reich, Puchhammer, Kopf, Hruška-Frank, Popper, Stöger; unter Beiziehung Aberle) Die gemeldeten SARS-CoV-2-Fallzahlen sind seit einiger Zeit stagnierend, das Abwassersignal ist seit einiger Zeit rückläufig. Bei anderen respiratorischen Infektionen ist ebenfalls ein rückläufiger Trend zu beobachten; für eine endgültige Entwarnung ist es hier jedoch noch zu früh. Diese Entwicklung schlägt sich auch auf die Personalausfälle in den Krankenhäusern nieder, die in allen Bundesländern deutlich geringer als noch vor einigen Wochen sind. Während die Anzahl an COVID-19-Patient:innen auf Intensivpflegestationen seit einigen Wochen nahezu unverändert auf relativ niedrigem Niveau ist, ist sie auf den Normalpflegestationen deutlich zurückgegangen. Dieser Trend wird auch für die kommenden zwei Wochen prognostiziert. Da jedoch die Grippewelle in Verbindung mit anderen respiratorischen Infektionen zu mehr Patient:innen auf Normal- und Intensivpflegestationen führen könnte, sollte die Lage in den Krankenanstalten weiterhin engmaschig beobachtet werden. Aktuelles Pandemiemanagement im EU-Vergleich (AG Schutzmaßnahmen: Ostermann, Druml, Popper, Starlinger; AG Gesundheitsdaten & Reportings: Bergthaler, Popper, Ditto, Kollaritsch, Striedinger, Platzer, Reiter) Die EU-Staaten konnten sich am 04.01.2023 nicht auf eine EU-weite Testpflicht für Einreisende aus China einigen. Die schwedische Ratspräsidentschaft teilte mit, dass die EU-Länder nachdrücklich dazu aufgefordert werden, für Reisende aus China in Richtung Europa vor der Abreise einen negativen Corona-Test vorzuschreiben, der nicht älter als 48 Stunden ist. Weiters wird empfohlen, Reisende aus China bei Ankunft in der EU künftig stichprobenartig auf SARS-CoV-2 zu testen. Positive Proben sollten gegebenenfalls sequenziert werden. Zudem solle das Abwasser von Flughäfen untersucht werden, an denen Maschinen aus China ankommen. Executive Report der GECKO-Sitzung vom 23. Januar 2023 16 von 21
Einige europäische Länder haben eine (temporäre) Testpflicht für Einreisende aus China eingeführt. So muss aufgrund der derzeitigen Situation in China in Belgien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Niederlande, Schweden, Spanien, Italien, Finnland, Luxemburg, Österreich, Malta, Zypern, Lettland, Portugal, Tschechien und England bei Einreise aus China ein negativer Test bei der Einreise vorgewiesen werden. Es gibt derzeit (Stand 23.01.2023) keine Einreisebeschränkungen für Reisende aus China in der Schweiz, Dänemark24, Irland (nur Empfehlungen), Bulgarien, Kroatien25 , Island26, Slowenien (nur Empfehlungen)27. In den meisten europäischen Staaten wurde ansonsten eine vollständige Öffnung des wirtschaftlichen und sozialen Lebens weitgehend umgesetzt. Zuletzt haben einige Bundesländer in Deutschland die Isolation von Corona-positiven Personen fallen gelassen. Der „grüne Pass“ ist überwiegend nicht mehr verpflichtend. Breitflächige Maskenpflichten wurden weitgehend aufgehoben. In rund der Hälfte der beobachteten Länder gilt eine Maskenpflicht spezifisch in vulnerablen Bereichen wie Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie fallweise auch öffentlichen Verkehrsmitteln. In einem Großteil der verbleibenden Länder gilt eine Empfehlung zum Maskentragen in diesen Settings, die vor dem Hintergrund steigender Fallzahlen vereinzelt erneuert bzw. bekräftigt wurde. Zuletzt steigende Fallzahlen werden auf die zunehmende Verbreitung der Variante BQ.1.1 zurückgeführt (z. B. Frankreich, Deutschland). Das Testangebot wurde in den meisten Ländern stark eingeschränkt. Abgesehen von Verdachtsfällen und Kontaktpersonen werden in den meisten Ländern nur noch Personen in vulnerablen Bereichen wie Gesundheitseinrichtungen oder Gefängnissen getestet. Kostenfreie Tests stehen in den meisten Ländern für die Allgemeinbevölkerung nicht mehr breitflächig zur Verfügung. 24 https://sum.dk/nyheder/2023/januar/epidemikommissionens-vurdering-af-tiltag-i-forbindelse-med-covid- 19-og-indrejse-fra-kina (zuletzt aufgerufen am 23.01.2023) 25 Croatia not to impose restrictive COVID measures on Chinese passengers - China.org.cn (zuletzt aufgerufen am 23.01.2023) 26 No Further Restrictions for Chinese Travellers (icelandreview.com) (zuletzt aufgerufen am 23.01.2023) 27 Empfehlungen für Passagiere, die nach China reisen oder aus China zurückkehren | Nijz (zuletzt aufgerufen am 23.01.2023) Executive Report der GECKO-Sitzung vom 23. Januar 2023 17 von 21
Gastvortrag Thomas Czypionka: Wirtschaftlicher Impact der Pandemie Gesundheitsökonomische Modellierung kann wissenschaftliche Grundlagen für gesundheits- und wirtschaftspolitische Entscheidungen in der Pandemie liefern. Schon Anfang 2020 war das Institut für höhere Studien (IHS) beauftragt, wöchentlich den wirtschaftlichen Impact der Pandemie abzuschätzen. Hierzu wurden alle verfügbaren Informationen aus der österreichischen Wirtschaft, der Weltwirtschaft und der medizinischen Literatur zusammengestellt sowie Abschätzungen der epidemiologischen Entwicklungen in Österreich und seinen wichtigen Handelspartnern durchgeführt. Diese Informationen wurden mithilfe eines multiregionalen Input-Output-Modells in wirtschaftliche Größen umgesetzt. Der wirtschaftliche Impact auf die Bundesländer sowie die einzelnen Branchen konnte so gut vorhergesagt werden. Der wirtschaftliche Impact ist das Ergebnis eines komplexen Zusammenwirkens aus nachfrage- und angebotsreduzierenden Effekten. Um dies ex-post quantitativ zu ermessen, bietet sich an, die IHS Mittelfristprognose mit der tatsächlichen BIP- Entwicklung zu vergleichen. Ab 2022 wird dieser Vergleich aber unzulässig, da andere Einflussfaktoren wie der Russland-Ukraine-Krieg und sich anheizende Inflation dämpfende Effekte auf die wirtschaftliche Entwicklung haben. Im Vergleich der realen Wachstumsraten zeigt sich ein starker Einbruch 2020 auf -6,45% (Prognose 1,6%), 2021 war jedoch bereits ein Rebound zu beobachten: voraussichtlich 4,8% gegenüber der Mittelfristprognose von 1,5%. Dies zeigt sich auch im Niveau: Während das reale BIP 2020 fast € 30 Mrd. unter der Mittelfristprognose lag, waren es 2021 nur mehr € 21,7 Mrd. Dies liegt an Nachholeffekten in Verbindung mit dem weitgehenden Erhalt der Wirtschaftsstruktur. Dennoch werden nachhaltige Veränderungen in der Arbeitswelt, Long COVID und pandemiebedingte Bildungsrückstände die weitere Entwicklung beeinflussen. Ein weiteres Beispiel der Verbindung von gesundheitlichen und wirtschaftlichen Effekten stellt die Koppelung des agentenbasierten Netzwerkmodells von dwh/TU mit dem multiregionalen Input-Output-Modell des IHS dar. Hiermit konnten epidemiologische und wirtschaftliche Effekte parallel betrachtet werden und somit eine Einschätzung gegeben werden, welche Effekte eine Maßnahme, z.B. die Schließung der Oberstufe oder ein zehntägiger Lockdown, auf epidemiologische und welche sie auf wirtschaftliche Kennzahlen hat. Der Vergleich erfolgt mit dem Basisszenario der seinerzeit geltenden Maßnahmen vom 27.10.2020. Die Ergebnisse sind oft nicht auf den ersten Blick intuitiv verständlich, da entstehende Quarantänefälle, Branchenunterschiede in der Möglichkeit Executive Report der GECKO-Sitzung vom 23. Januar 2023 18 von 21
zu Teleworking aber auch Betreuungspflichten für Schul- und Kindergartenkinder ebenfalls eine Rolle spielen. Zukünftige Arbeiten befassen sich mit Long COVID und den kritischen Infrastrukturen. In der Forschungsinitiative Gesundheit und Wirtschaft entwickelt das IHS das Austrian Long Covid Macro Modell, welches den wirtschaftlichen Impact von Long Covid abschätzen soll. Es besteht aus zwei Teilen, der Abschätzung der gesundheitlichen Effekte von Long Covid auf produktivitätsrelevante Einflussgrößen und der Einpflegung dieser Information in bestehende Makromodelle wie das Multiregionale Input-Output-Modell, das Humankapitalmodell und das TAXLAB. Während ersteres Effekte in der kurzen Frist sehr detailliert darstellen kann, ist das Humankapitalmodell in der Lage, Effekte auf das Arbeitskräftepotential nach Alter und Geschlecht auch über den Lebenszyklus darzustellen. TAXLAB ist eine Computersimulation der österreichischen aber auch anderer europäischer Volkswirtschaften und kann für mittel- und längerfristige Effekte auf wirtschaftliche Größen verwendet werden. Im EU Horizon-Europe Projekt SUNRISE, das Ende 2022 startete und 41 Partner umfasst, geht es um Strategien und Technologien, um kritische Infrastrukturen in Europa resilienter gegen zukünftige Pandemien aber auch andere Schocks wie Blackouts zu machen. Das IHS ist hier wieder damit befasst, die wirtschaftlichen Folgen unterschiedlicher Szenarien zu berechnen, aber auch seine Expertise aus dem EU-Projekt PERISCOPE einzubringen, in dem es um die Erhöhung der Resilienz von Gesundheitssystemen gegenüber Pandemien ging. Executive Report der GECKO-Sitzung vom 23. Januar 2023 19 von 21
Über die Kommission zur gesamtstaatlichen COVID-Krisenkoordination (GECKO) Die GECKO-Kommission besteht aus Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Disziplinen und wird von Dr. Katharina Reich (Chief Medical Officer im Gesundheitsministerium) und General Mag. Rudolf Striedinger (Generalstabschef im Verteidigungsministerium) geleitet. GECKO berät die Bundesregierung in Fragen der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Die Beratung erstreckt sich insbesondere auf folgende Bereiche: • Bewertung der aktuellen COVID-19-Situation • Impf-, Medikamenten- und Teststrategie • Operative Umsetzung • Information der Bevölkerung Die Kommission institutionalisiert und ermöglicht einen laufenden Informationsaustausch. GECKO berichtet regelmäßig an die Bundesregierung, diese leitet auf Grundlage von GECKO-Empfehlungen politische Entscheidungen ab. Die Kommission tritt in Form der als Executive Report auf der Website des Bundeskanzleramts veröffentlichten Beurteilungen nach außen hin auf. Darüber hinaus sprechen die beiden Vorsitzenden, sofern sie in ihrer Rolle als Vorsitzende der Kommission auftreten, für die Kommission in ihrer Gesamtheit. Mitglieder der GECKO-Kommission: Andreas Bergthaler, Robert Böhm, Manfred Ditto, Christiane Druml, Silvia Hruška-Frank, Herwig Kollaritsch, Karlheinz Kopf, Markus Müller, Ulrike Mursch-Edlmayr, Herwig Ostermann, Julia Partheymüller, Dieter Platzer, Niki Popper, Elisabeth Puchhammer- Stöckl, Katharina Reich, Ronald Reiter, Eva Schernhammer, Reinhard Schnakl, Volker Schörghofer, Thomas Starlinger, Johannes Steinhart, Karl Stöger, Rudolf Striedinger Executive Report der GECKO-Sitzung vom 23. Januar 2023 20 von 21
Impressum Medieninhaber, Verleger und Herausgeber: Bundeskanzleramt, Geschäftsstelle der GECKO – Gesamtstaatliche COVID- Krisenkoordination, Ballhausplatz 2, 1010 Wien Autorinnen und Autoren: GECKO – Gesamtstaatliche COVID-Krisenkoordination Fotonachweis: Cover (iStock/simpson33) Wien, 2022. Stand: 27. Januar 2023 Copyright und Haftung: Auszugsweiser Abdruck ist nur mit Quellenangabe gestattet, alle sonstigen Rechte sind ohne schriftliche Zustimmung des Medieninhabers unzulässig. Es wird darauf verwiesen, dass alle Angaben in dieser Publikation trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr erfolgen und eine Haftung des Bundeskanzleramtes und der Autorin / des Autors ausgeschlossen ist. Rechtausführungen stellen die unverbindliche Meinung der Autorin / des Autors dar und können der Rechtsprechung der unabhängigen Gerichte keinesfalls vorgreifen.
Sie können auch lesen