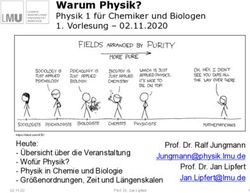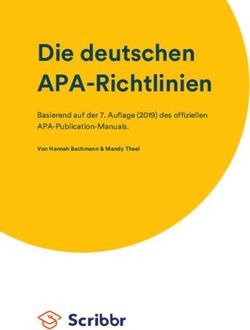Das Atommodell im Wandel der Zeit - Valeria Zittel, Michael Frank, Johanna Sommermeyer - Universität Leipzig
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
„We each exist for but a short time, and in that time explore but a small part of the whole universe. But humans are a curious species. We wonder, we seek answers.” - STEPHEN HAWKING (1942-2018), britischer Physiker
Gliederung 1. Einführung 2. Was ist ein Modell? 3. Atomvorstellung in der Antike und im Mittelalter 3.1 Demokritos von Abdera 3.2 Aristoteles 3.3 Galenos von Pergamon 3.4 Atommodell im Mittelalter 4. Atommodelle in der neuzeitlichen Wissenschaft 4.1 Atommodell nach Dalton (1803) 4.2 Atommodell nach Thomson (1903) 4.3 Atommodell nach Rutherford (1911) 4.4 Atommodell nach Bohr (1913) 4.5 Modellerweiterungen 5. Quellen
2. Was ist ein Modell? • Beschränkte Abbildungen der Realität • Eigenschaften: • Anschaulich und einfach • Transparent • Weiterentwickelbar! • Passend oder unpassend Modelle als vereinfachte Abbildungen der Realität.
Zeitstrahl Antike Mittelalter Frühe Neuzeit Gegenwart 4-Elemente-Brunnen aus Gröbenzell Alchemistische Symbole von Elementen Atommodell nach Thomson Orbitalmodell
Antike 3.1 Demokritos von Abdera • lebte von ca. 460 v. Chr. bis 370 v. Chr. • Mit Lehrer Leukippos Mitbegründer des Atomismus • Griechischer Philosoph und Wissenschaftler „Nur scheinbar hat ein Ding eine Farbe, nur scheinbar ist es süß oder bitter, in Wirklichkeit gibt es nur Atome im leeren Raum.“ (Zitat von Demokritos nach Galenos) Büste von Demokritos
Antike 3.1 Demokritos von Abdera • Erste Anhänger des Atomismus im antiken Griechenland • DEMOKRIT: nicht sichtbare, unzerteilbare (griech. atomos) und unvergängliche Teilchen • Relativ fortschrittlich, aber eher philosophische Betrachtung • PROBLEME dieser Modellvorstellung: • Keine Kenntnis von Kernspaltung und -fusion • Keine Kenntnis von existenten Molekülen
Antike 3.2 Aristoteles • Lebte von 384 v. Chr. Bis 322 v. Chr. • Antiker griechischer Universalgelehrter und Philosoph • Mitbegründer wissenschaftlicher Theorie und des Aristetolismus Aristoteles-Porträt in moderner Büste
Antike 3.2 Aristoteles • EMPEDOKLES: • Einführung der vier Elemente: Feuer, Wasser, Erde und Luft • Einteilung nach Eigenschaften warm-kalt und feucht-trocken Einteilung der Elemente mit entsprechenden Eigenschaften
Diskussion • Ist das antike Atommodell heute noch relevant? • Wo ist das antike Atommodell heute noch relevant?
Antike Diskussion • Ist das antike Atommodell heute noch relevant? • Wo ist das antike Atommodell heute noch relevant? • WO? Unterhaltungsmedien: Bücher, Videospiele, Filme und Serien Esoterik: Tierkreiszeichen, esoterisch- pseudowissenschaftliche Themen Trigonaspekte der Zeichen, zugleich Zuordnung der Zeichen zu den vier Elementen
Mittelalter 3.3 Galenos von Pergamon • Lebte ca. von 129 bis 200 n. Chr. • Arzt und Mediziner der Spätantike • Begründer der Galenik, der mittelalterlichen medizinischen Therapie/Heilkunde • Ablösung erst durch Paracelsus´ Heilkunde Galen, Phantasieporträt, Pierre Roch Vigneron, unbek.
Mittelalter 3.4 Atommodell im Mittelalter • Keine direkte Relevanz, da Verfolgungen durch Kirche • AUSNAHME: Medizin und Alchemie • Alchemie: • Einteilung von Stoffen und Erforschung der Überführung • Später Suche nach Quintessenz und Stein der Weisen • Medizin: • Humoralpathologie nach GALENOS von Pergamon aus „Der Natur des Menschen“ von Polybios/Hippokrates • relevante medizinische Therapie bis in die frühe Neuzeit Joseph Wright of Derby, 1771, Der Alchemist beim Suchen nach dem Stein der Weisen, Derby, VK
Mittelalter 3.4 Atommodell im Mittelalter • Alchemie: • Versuch der Stoffumwandlung (Transmutation) • Entspricht der experimentalen Chemie • Wichtigstes Ziel: Transmutation in Gold • Umwandlung von unedlen Metallen in Gold • Erschaffung des Steins der Weisen • Erschaffung von Quintessenz Pyrit (FeS₂)
Mittelalter 3.4 Atommodell im Mittelalter • Vier Säfte (engl. humors), welche die antiken vier Elemente symbolisieren: • Schwarze Galle (Erde) • Gelbe Galle (Feuer) • Schleim (Wasser) • Blut (Luft) • Gesundheit bei Gleichgewicht; Krankheit bei Unausgewogenheit • Anwendung passender „Medizin“ zum Ausgleich, z. B. Aderlass
Diskussion Mittelalter Was sind die Errungenschaften im Mittelalter?
Mittelalter Diskussion • Was sind die Errungenschaften im Mittelalter? • Systematisierung von Stoffen aus Natur und menschlichen Erzeugnissen • Verlagerung der Betrachtungsweise von philosophischer auf experimentelle Ebene • Beginn der Aufzeichnung von Synthesen
Zwischenfazit Die veralteten Modelle haben auch heute noch ihre Relevanz, obwohl sie große Abweichungen haben und viele Phänomene nicht erklären können. Die Modelle werden hauptsächlich zur Simplifizierung und Vereinfachung hergenommen und teilweise für die eigenen Zwecke angepasst oder erweitert. Die Modelle werden hingegen heute kaum noch ernsthaft von Wissenschaftlern vertreten und wird in der Lehrmeinung oder Therapien nicht mehr angewendet.
4. Atommodelle in der neuzeitlichen Wissenschaft
4.1 Atommodell nach Dalton (1803) • Englischer Naturforscher und Lehrer • 1801: Gesetz der Partialdrücke = =1 • Beschäftigt sich mit der Atomvorstellung nach Demokrit • Atommasseneinheit u (früher Dalton Da) John Dalton (1766-1844)
4.1 Atommodell nach Dalton (1803) Daltons Atomhypothese: 1. Elemente sind Häufungen von Atomen 2. Atome eines Elementes sind identisch und besitzen spezifische Volumina und Massen 3. Es existieren genauso viele Atome als homogene Massenkugeln Atomsorten wie Elemente 4. Atome können weder erschaffen Grundlage: noch zerstört werden • Aufbau der Materie aus Atomen 5. Chemische Verbindungen sind in • Atome als kleinste unteilbare Teilchen bestimmten Anzahlverhältnissen verknüpft
4.1 Atommodell nach Dalton (1803) Gesetz der multiplen Proportionen → Chemische Verbindungen werden durch bestimmte Anzahlverhältnisse verknüpft
4.1 Atommodell nach Dalton (1803) Atomvorstellung nach Dalton Heutige Atomvorstellung
4.1 Atommodell nach Dalton (1803) Vorteile: • Einfach, Leicht zu verstehen • Atome besitzen kugelförmige Gestalt • Atome besitzen bestimmte Massen und Volumen Nachteile: • Atommassen? • Zusammensetzung von Verbindungen? Atome als homogene Massenkugeln • Eigenschaften der Stoffe? • Reaktionsfähigkeit? • Atome als kleinste unteilbare Teilchen?
4.2 Atommodell nach Thomson (1903) • Britischer Physiker • Entdecker des Elektrons • 1906 Nobelpreis für Physik Sir Joseph John Thomson (1856-140) Gasentladungsröhren
4.2 Atommodell nach Thomson (1903) • Es existieren Teilchen, die kleiner und leichter als Atome sind • Atome besitzen einen inneren Aufbau • Atom als gleichmäßige, positiv geladene Masse → Darin werden negativ geladene Elektronen eingebettet
4.2 Atommodell nach Thomson (1903) Dalton Thomson Heutige Atomvorstellung
4.2 Atommodell nach Thomson (1903) Vorteile Nachteile • Atome besitzen innere Struktur • Lichterscheinungen? mit Elektronen • Radioaktivität? • Ionisierung von Atomen • Wie sind Elektronen im Atom • Elektrischer Strom verteilt? • Intramolekulare Wechselwirkungen Atommodell nach Thomson
4.2 Atommodell nach Thomson (1903) Experiment: • Elektronenstrahlen können dünne Metallfolien ungehindert durchdringen →Atome sind „leer wie das Weltall“ Elektronenbeugung an Metallfolien →Wiederspruch zum Atommodell nach Thomson Philipp Lenard (1862-1947) • Dynamidenmodell Dynamidenmodell
4.3 Atommodell nach Rutherford (1911) • neuseeländischer Physiker • 1907 Professorenstelle für Physik, Universität Manchester • 1909: Durchführung des Streuversuchs zusammen mit Hans Geiger, Ernest Marsden Ernest Rutherford (1871-1937)
4.3 Atommodell nach Rutherford (1911) • viele Alphateilchen dringen ungehindert durch Goldfolie durch • einige Alphateilchen um 90° oder mehr abgelenkt • wenige Alphateilchen werden reflektiert Aufbau des Streuversuchs
4.3 Atommodell nach Rutherford (1911) Welche wesentlichen Unterschiede fallen auf bzw. wie könnten diese anhand des Streuversuchs erklärt werden? Rosinenkuchen-Modell nach Thomson Kern-Hülle-Modell nach Rutherford „Es war beinahe so unglaublich, als ob man mit einem 15-Zoll-Geschoss auf ein Stück Seidenpapier schießt und das Geschoss zurückkommt und einen selbst trifft.“ - Ernest Rutherford
4.3 Atommodell nach Rutherford (1911) • positiver Atomkern trägt fast die gesamte Masse • Atomhülle nimmt das meiste Volumen ein • Atomhülle enthält Elektronen • Elektronen umkreisen den Atomkern
4.3 Atommodell nach Rutherford (1911) Schwächen des Modells: • Emission und Absorption? • Warum stürzen die Elektronen nicht in den Kern?
4.4 Atommodell nach Bohr (1913) • dänischer Physiker • 1913: Theorie über die Elektronen- struktur des Wasserstoffatoms • 1922: Nobelpreis für Physik Niels Bohr (1885-1962)
4.4 Atommodell nach Bohr (1913) • Wasserstoff besteht aus einem Atomkern (Proton) und einem Elektron • Elektron umkreist Atomkern auf konzentrisch angeordneten Bahnen • jede Bahn entspricht einem diskreten Energieniveau Bohrsches Atommodell
4.4 Atommodell nach Bohr (1913) 1) Dem Elektron steht nur eine kleine Anzahl an Bahnen zur Verfügung, auf denen es sich strahlungslos um den Kern bewegt. 2) Elektronen absorbieren oder emittieren Energie beim Übergang in verschiedene Energieniveaus (Quantensprünge). Erklärung der Emission anhand des Bohrschen Atommodells
4.4 Atommodell nach Bohr (1913) Schwächen des Modells: • Postulate durch kein wissenschaftliches Fundament gestützt • erklärt „nur“ das Absorptions- und Emissionsspektrum von Wasserstoff oder wasserstoffähnlichen Ionen
4.5 Modellerweiterungen • Schalenmodell - Atomhülle aus verschiedenen Schalen K,L,M… - Schalen können eine gewisse Anzahl an Elektronen aufnehmen: mit e … Elektronenanzahl n … Nummer der Schale
4.5 Modellerweiterungen • Orbitalmodell: - Elektronen bewegen sich dreidimensional um den Kern (Orbitale) - Orbitale sind der Raum, in dem sich die Elektronen am wahrscheinlichsten aufhalten
4.5 Modellerweiterungen
Fazit
„We each exist for but a short time, and in that time explore but a small part of the whole universe. But humans are a curious species. We wonder, we seek answers.” - STEPHEN HAWKING (1942-2018), britischer Physiker
5. Quellen • Bildquellen: https://www.chemie-schule.de/KnowHow/Datei:Rutherfordsches_Atommodell.png (07.06.2021) https://www.leifiphysik.de/atomphysik/atomaufbau/grundwissen/streuversuch-und-atommodell-von-rutherford (07.06.2021) https://www.wissen.de/lexikon/rutherford-ernest-baron (07.06.2021) http://www.tomchemie.de/rutherford.htm (07.06.2021) http://www.biologie-schule.de/niels-bohr.php (07.06.2021) https://physik.osz-biv.de/GK/ph-4_2015/bohr15.php (08.06.21.) https://www.youtube.com/watch?v=ZD2HWNkA6WI (29.05.2021) https://timenote.info/de/John-Dalton (31.05.2021) https://meinstein.ch/physik/atomlehre/ (03.06.2021) https://www.halbleiter.org/grundlagen/atombau/ (03.01.2021) https://www.grund-wissen.de/physik/atomphysik/atommodelle.html (03.06.2021) http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/philo/galerie/antike/demokrit.html (07.06.2021)
5. Quellen • Bildquellen https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/bewegte-ladungen-feldern/geschichte/joseph-john-thomson- 1856-1940 (03.06.2021) https://www.google.com/search?q=thomson+rosinenkuchenmodell&client=firefox-b- d&sxsrf=ALeKk0277PV0zAQZbwUii3EzQT269mGNLw:1622783466800&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ah UKEwi-wNfAm_3wAhV68OAKHeLQDcAQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1600&bih=758#imgrc=Jorz3q6OSVYzjM (04.06.2021) http://ritaroots.weebly.com/chemistry-lessons.html (04.06.2021) https://www.schullv.de/chemie/basiswissen/grundlagen_chemie/atommodelle (04.06.2021) https://www.wissen.de/lexikon/lenard-philipp (04.06.2021) https://www.leifiphysik.de/quantenphysik/quantenobjekt-elektron/versuche/elektronenbeugungsroehre (04.06.2021) https://histomania.com/app/Dynamidenmodell_W1268904 (04.06.2021) https://de.wikipedia.org/wiki/Alchemie#/media/Datei:ElementeAlchemisten.svg (07.06.2021) https://www.helpster.de/kugelwolkenmodell-erklaerung_212734 (17.06.2021)
5. Quellen • Textquellen: K. W. Ford, The Physics Teacher 2018, 56, 500—502. L. K. James, Nobel Laureats in Chemistry 1901—1992, American Chemical Society and the Chemical Heritage Foundation, United States, 1993, 57. M. Eckert, Physik in unserer Zeit 2013, 44 (4), 168—173. J. Bleck-Neuhaus, Elementare Teilchen Von den Atomen über das Standardmodell bis zum Higgs-Boson, Springer Verlag Berlin Heidelberg, Berlin, 2013, 73—117. https://www.youtube.com/watch?v=ZD2HWNkA6WI (29.05.2021) J. Höcht, Atommodelle-experimentelle und theoretische Meilensteine 2015, 5—7. M. Welke, Die Atomtheorie im Wandel der Zeit 2008, 1,9 https://www.cumschmidt.de/s_modelle03.htm (03.06.2021)
Sie können auch lesen