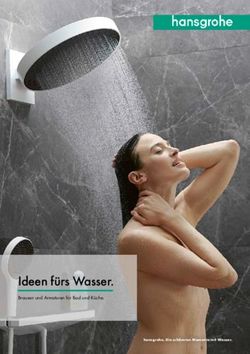Der Jet-Ventilator Universitätsspital Basel Jahrgang 2003-2005 - Hofhansl Alfred Am unteren Sonnenrain 2
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Der Jet-Ventilator
Hofhansl Alfred
Am unteren Sonnenrain 2
79539 Lörrach
Universitätsspital Basel
Jahrgang 2003-2005Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis...................................................................................................................2
1. Einleitung.......................................................................................................................3
2. Grundlagen.....................................................................................................................4
2.1. Definition ...............................................................................................................4
2.2. Begriffserklärung:...................................................................................................5
3. Indikationen ...................................................................................................................6
4. Kontraindikationen .........................................................................................................6
5. Vorteile der Jet-Ventilation.............................................................................................7
6. Nachteile der Jet-Ventilation...........................................................................................7
7. Techniken.......................................................................................................................8
8. Einstellungen und Parameter ........................................................................................10
9. Atemwegsdruck............................................................................................................11
10. Der Fragebogen ........................................................................................................13
10.1. Teilnehmer der Umfrage ...................................................................................14
10.2. Die Auswertung des Fragebogens .....................................................................14
11. Der Standard.............................................................................................................16
11.1. Der Jet-Ventilator: Monsoon von ACUTRONIC...............................................16
11.2. Grundeinstellung...............................................................................................16
11.3. Einwilligung: ....................................................................................................17
11.4. MSS..................................................................................................................17
11.5. Medikamente ....................................................................................................17
11.6. Standort ............................................................................................................18
11.7. Inbetriebnahme .................................................................................................18
11.8. Vorbereitung Material.......................................................................................18
11.9. Der Jet-Katheter................................................................................................19
11.10. Anschlüsse Geräteseite......................................................................................19
11.11. Bypass ..............................................................................................................19
11.12. Dichtigkeitstest .................................................................................................20
11.13. Befeuchtungseinheit..........................................................................................21
11.14. Abkürzungen und ihre Bedeutungen..................................................................23
11.15. Beenden ............................................................................................................23
12. Ein Blick über die Grenzen .......................................................................................24
13. Fazit .........................................................................................................................25
14. Literatur....................................................................................................................26
21. Einleitung
Mit dem Beginn meiner Weiterbildung musste ich mich mit neuen medizintechnischen
Geräten auseinandersetzen. Der Jet-Ventilator war für mich völlig neu. Auf Grund meines
persönlichen Interesses an verschiedenen Beatmungsformen, wurde ich auf dieses Gerät
aufmerksam.
Da das Gerät wenig zum Einsatz kommt, treten immer wieder Unklarheiten und
Unsicherheiten bei der Bedienung des Gerätes auf. Für mich war es wichtig herauszufinden,
welche Problematiken im Vordergrund stehen und ein geeignetes Instrument zu ermitteln, mit
dem eine adäquate Bedienung des Gerät gewährleistet ist.
Mit einem Fragebogen konnte ich die Bedürfnisse und die Hauptinteressen meiner
MitarbeiterInnen, im Umgang mit dem Jet-Ventilator, aufzeigen.
Mit den Antworten aus diesem Fragebogen erarbeitete ich Lösungs- und
Verbesserungsvorschläge, welche zu mehr Sicherheit im Umgang mit dem Jet-Ventilator
beitragen sollen. Instrumente zur Qualitätssteigerung könnten sein: neue Standards,
Kurzbeschreibungen, Lehrfilme, Fortbildungen oder Arbeitsgruppen.
Wenn eines dieser Instrumente zum Einsatz kommt, kann man dieses Instrument evaluieren.
Mit einer Umfrage, nach zum Beispiel einem Jahr, werden dann die Rückmeldungen der
MitarbeiterInnen erfasst, ausgewertet und den Bedürfnissen wieder neu angepasst.
Interessant fand ich auch die unterschiedlichen Techniken und Einsatzmöglichkeiten, welche
andere Spitäler haben. Deshalb habe ich über die Grenzen des Universitätsspitals Basel
(USB) geschaut und einige Details dazu aufgeschrieben.
Auch war es mir wichtig zu erfahren, wie oft andere Spitäler das Gerät im Einsatz haben und
welche Indikationen dafür gestellt werden.
Da das Thema sehr umfangreich ist und in der Literatur immer wieder verschiedene
Einsatzorte aufgezeigt werden, habe ich mich speziell auf unsere Möglichkeiten im USB
konzentriert.
Die Jet-Ventilation ist eine bestimmte Beatmungsform und ordnet sich in die Reihe der
Hochfrequenzbeatmung ein. Hier gibt es wiederum verschiedne Formen der Ventilation. Ich
möchte nicht auf die einzelnen Formen eingehen, da dies den Rahmen sprengen würde. Aus
diesem Grund widme ich mich dem Wesentlichen - der Qualitätssteigerung in der Bedienung
mit dem Jet-Ventilator.
32. Grundlagen
2.1. Definition
1. Jet-Ventilation bedeutet die gepulste Abgabe von Gasportionen hoher bewegender
Energie durch englumige Röhren in die Atemwege. Zitat: Biro P, Pasch T (1995)
Die Schwierige Intubation: erschwert zugängliche Atemwege.
Huber, Bern Göttingen Toronto
Damit werden große Gasvolumina freigesetzt. Sie dringen vornehmlich im Zentrum der
Atemwege vor. Gleichzeitig entweicht das Expirationsvolumen vorwiegend im wandnahen
Bereich des Atemwegquerschnitts.
Dieser simultane, koaxiale Ein- und Aus-Strom ist der wirksamste Mechanismus des
Gastransports unter Jet-Ventilation.
2. Hindernisse aboral der Austrittsöffnung vermindern den Gasfluss zur Lunge. Wegen
des dadurch verringerten Atemhubvolumens ist die gleichzeitige Abstrombehinderung
weniger bedeutsam. Zitat: Biro P, Pasch T (1995) Die Schwierige Intubation:
erschwert zugängliche Atemwege. Huber, Bern Göttingen Toronto
Dagegen beeinträchtigen Hindernisse oral der Austrittöffnung den Gasfluss zur Lunge nicht,
wohl aber den Abstrom unter Umständen so, dass Überblähung und Barotrauma entstehen
können.
Durch den Unterdruck an der
Austrittsöffnung wird Gas aus der
Umgebung mitgerissen und vermehrt das
transportierte Gasvolumen (grün). Dieser
Effekt wird mit dem Begriff „Entraintment“
oder als „Venturi-Effekt“ bezeichnet. Wird
Jet-Ventilation mit Sauerstoffkonzentrat über
21% betrieben, resultiert aus dem
Entrainment eine Absenkung der trachealen
Sauerstoffkonzentration, der FiO2.
Der Gaswechsel bei Jet-Ventilation wird geräteseitig von:
Beatmungsfrequenz
Arbeitsdruck
Inspirationsdauer
FiO2
Jet-Katherter oder Jet-Düse
Sowie patientenseitig im Wesentlichen von:
Compliance und Resistance
bestimmt.
4Die Charakteristischen Merkmale einer Jet-Ventilation sind demzufolge:
offenes System
stark beschleunige Gasportionen durch dünne Austrittspforte (Jet).
Hoher Gasfluss (10-30 l/min) bei kleinem Atemzugvolumen (50-250ml)
Breiter Frequenzbereich
Einbezug von Umgebungsluft
Aktive Insufflation und passive Exhalation über den nach außen offenen Atemweg
sequenzieller und teilweise simultaner Ein- und Ausstrom der Atemgase
Koaxiale Gasflüsse in den Atemwegen
Gegenläufige Konzentrationsgradienten für Sauerstoff und Kohlendioxid entlang der
Atemwege.
2.2. Begriffserklärung:
Jet-Ventilation fällt unter den Oberbegriff der Hoch-Frequenz-Ventilation (HFV).
Unter diesen findet sich eine heterogene Gruppe von Beatmungstechniken, denen allen eine
mindestens 4mal höhere Beatmungsfrequenz gemeinsam ist, als sie bei normaler
Spontanatmung vorliegt.
Sie unterscheiden sich unter anderem durch den Frequenzbereich, welchen sie innerhalb des
Spektrums von 60-2400 Impulsen pro Minute abdecken.
Form AF Gasbewegung Gasbewegung AZV AMV Spitzenflow
(l/min) Insp. Exp. (ml) (l) Vmax
(l/min)
HPPV 60-110 Aktiv Passiv 200-300 20-30 1,5
HFJV 100-400 Aktiv Passiv 50-250 25-30 2,5
FDV 350-1500 Aktiv Passiv 10-250 10-50 0,7
HFO 300-2400 Aktiv Aktiv 90-120 90-120 4,0
CHFV CMV: 1-60 Aktiv Aktiv o. Passiv
HFV: 100-3000
Tabelle aus: Biro P, Pasch T (1995) Die Schwierige Intubation: erschwert zugängliche
Atemwege. Huber, Bern Göttingen Toronto
HFPPV = High Frequency Pressure Ventilation
HFJV = High Frequency Jet-Ventilation
FDV = Forcierte Diffusions-Ventilation
HFO = High Frequency-Oscillation
CHFV = CMV, kombiniert mit High-Frequency-Ventilation
53. Indikationen
Das operative Indikationsgebiet des Jet-Ventilators beschränkt sich zurzeit im wesentlichen
auf diagnostische und chirurgische Eingriffe an Kehlkopf, Atemwegen und Lunge. An den
oberen Atemwegen werden folgende operative Zugangswege verwendet:
- Translaryngeal
- Transcutan (Membrana cricothyroidea, Koniotomie)
Einerseits handelt es sich um endoskopische diagnostische und chirurgische Interventionen
mit starrem Bronchoskop, Stützlaryngoskop und diversen Optiken. Hierbei gelangen sowohl
mikrochirurgische Techniken als auch Laserresektionen zum Einsatz. Tiefer gelegene
Läsionen (Verletzungen) werden auf direktem Weg (transkutan) angegangen, wie im Fall von
Trachea- oder Bronchusresektion und –Plastiken oder Operationen am Tracheostoma. Die
Kombination beider Zugänge kommt bei der Im- und Explantation von laryngotrachealen
Stents sowie von Stimmprothesen vor.
Eine umstrittene Anwendung der Jet-Ventilation ist die Notfalloxygenation in der „cannot
intubate - cannot ventilate“- Situation. In der Hand des erfahrenen Anwenders ist sie eine sehr
schnell und effektiv praktikable Möglichkeit, den Patienten in einer Notfallsituation zu retten.
Sie beinhaltet aber auch hohe Komplikationsrisiken (z.B. paratracheale Fehlpunktion,
Spannungspneumothorax) und sollte daher streng indiziert, individuell abgewogen und als
letztes Mittel der Wahl eingesetzt werden.
Mit Rücksprache des zuständigen Anästhesie Oberarztes auf der HNO und einer Befragung
der Oberärzte der HNO im USB, kamen wir auf folgende
Indikationen:
Stenteinlage oder Stentwechsel
Lasereingriffe (Entfernung von Neoplasien)
Stimmlippenaugmentation
Panendoskopie
4. Kontraindikationen
Eine absolute Kontraindikation ist die hochgradige Behinderung des Gasabflusses, bei
weniger als 20% verbleibendem Atemwegsquerschnitt. Dies liegt vor bei sehr engen
und/oder langstreckigen Atemwegsstenosen, Atemwegstumoren und Luftwegstraumen.
Sofern der Gasabflußweg ausreicht oder mit Hilfsmitteln wie Entlastungspunktion oder
Endoskoprohren offen gehalten werden kann, erweist sich die Jet-Ventilation gerade bei
Atemwegsstenosen als ein geeignetes zum Teil auch als einzig mögliches-
Beatmungsverfahren.
Aus der schwierigen Abschätzung der Beatmungseffktivität unter Jet-Ventilation leiten sich
relative Kontraindikationen im Zusammenhang mit pulmonalen Funktionsstörungen ab.
Während Diffusionsstörungen, ungleiche belüftete Lungenbezirke und restriktive
Veränderungen vor allem die Oxygenation erschweren, entstehen sowohl bei Restriktion als
auch bei Obstruktion vorwiegend Probleme mit der CO2-Elimination.
Kontraindikationen: Relative Kontraindikationen:
6
Behinderung des Gasabflusses Hoher BMI
Erhöhte Aspirationsgefahr (nicht nüchtern) Gerinnungsstörungen5. Vorteile der Jet-Ventilation
Die begrenzten räumlichen Verhältnisse im Bereich der oberen Atemwege ergeben für
Operateur und Anästhesist eine ganze Reihe spezifischer Probleme. Dies führt sowohl zu
höheren Beatmungsbezogenen Risiken, als auch Gefährdung des Operationserfolgs. Daher
sind Beatmungstechniken und – Material von Vorteil, die im Pharyngeal – und
Laryngealbereich wenig Platz beanspruchen und gegenüber Manipulationen des Operateurs
wenig störanfällig sind. Zusätzliche Risiken ergeben sich durch die Brandgefahr bei der weit
verbreiteten Anwendung von Laserlicht in den Atemwegen. Daher ist die Jet-Ventilation
besonders vorteilhaft, da sie ohne entflammbares Tubusmaterial auskommt.
Der für die IPPV notwendige inspiratorische Beatmungshub setzt eine ausreichende
Dichtigkeit aller Komponenten des Beatmungssystems voraus. Gerade im Rahmen von
Eingriffen an den Atemwegen ist jedoch eine dichte Verbindung zwischen Tubus und
Atemweg oft nicht möglich. In dieser Situation ist die Jet-Ventilation besonders vorteilhaft,
da sie den Gasaustausch unter den Bedingungen eines offenen Atemwegs gewährleisten kann
(sog. “lose Kopplung“).
Zusammengefasst sind dies die Vorteile der Jet-Ventilation bei Atemwegseingriffen:
Platzbedarf ist gering
Störanfälligkeit gegenüber Manipulation durch Operateur ist gering
Beeinträchtigung bei der Durchführung des Eingriffs ist gering
Bewahrung des Operationsergebnisses ist einfacher
Druckbelastungen von Atemwegsanastomosen sind gering
Dichtigkeit des Beatmungssystems gegenüber der Aussenwelt sind nicht erforderlich
Beeinträchtigung der Hämodynamik ist gering
Einzelne dieser Bedingungen lassen sich zwar mit alternativen Vorgehensweisen ebenfalls
erreichen, beispielsweise durch wiederholte Apnoephasen nach Stickstoffauswaschung unter
sog. apnoeischer Oxygenation oder mit Lokalanästhesie oder Analgosedierung bei erhaltener
Spontanatmung. Keine dieser Methoden erfüllt jedoch alle obigen Vorteile gleichzeitig, bzw.
ermöglicht deren zeitlich unlimitierte Muskelrelaxation, wie das mit Jet-Ventilation der Fall
ist.
6. Nachteile der Jet-Ventilation
Die geringe Verbreitung und Akzeptanz der Jet-Ventilation liegt vor allem an der – teils nur
scheinbaren – Schwierigkeit, die aus der Konventionellen Beatmung bekannten Mechanismen
des Gastransports und des Gasaustauschs anzuwenden und in die klinische Praxis
umzusetzen. Dies gilt insbesondere für die Abschätzung der zu erwartenden Oxygenation und
7CO2-Elimination; beide Zielgrößen des Gasaustausches sind unter Jet-Ventilation stets
weniger präzise vorhersehbar als unter konventioneller Beatmung, was die Anpassung der
Ventilationseinstellung erheblich erschwert.
Zusammengefasst sind die Nachteile der Jet-Ventilation:
Die Vorhersehbarkeit der Beatmungseffektivität ist gering
Inhalationsanästhetika sind nicht anwendbar
Barotraumagefahr bei Obstruktion des Gasabflusswegs
Potentielle Aspirationsgefahr
7. Techniken
Infraglottische Jet-Ventilation
Supraglottische Jet-Ventilation
Infraglottische Jet-Ventilation über Trachealkanüle, zwischen Schild- und
Ringknorpel
Jet-Ventilation über Trachealtubus
Jet-Ventilation am starren Bronchoskop
Der Jetkatheter ist das Bindeglied zwischen Patienten und Jet-Ventilations-Gerät, welcher
bezogen auf die Glottisebene verschieden positioniert werden kann. Er kann analog zum
Endotrachealtubus oro- oder nasotracheal mit der Spitze bis oberhalb der Karina eingeführt
werden.
Abb.1
Stützlaryngoskopie mit Kleinasser-
Instrument und infraglottische Jet-
Ventilation über einen orotracheal
eingelegten Doppellumen-Katheter. a) b
Jetleitung, b) Messleitung zur kontinu- a
ierlichen Übertragung des
Atemwegsdrucks.
Insbesondere bei Laseranwendung ist der aus Teflon gefertigte Katheter geeignet. Einige
Katheter sind endständig mit einer Stabilisierungsvorichtung versehen, die eine axiale
Ausrichtung in der Trachea und Schutz der Schleimhaut vor Auslenkungen gewähren soll.
Außerdem ist ein zweites Lumen für die kontinuierliche Atemwegsüberwachung vorhanden
(Abb.1). Für die diagnostische Inspektion des Kehlkopfs kann ein supraglotisch
angebrachter Jetkatheter verwendet werden, der auch als fixer Bestandteil in das Kleinasser-
Instrument eingebaut werden kann (Abb.2). eine spezielle Katheterposition liegt bei der
transtrachealen Punktion mittels einer dünnen Transtrachealkanüle vor (Abb.3). sie ist
insbesondere bei der schwierigen Einstellbarkeit der Stimmbandebene mit dem
Stützlaryngoskop und bei pathologischen Prozessen im Bereich der hinteren Kommissur von
Vorteil. Außerdem bietet die transtracheale Punktion eine einfache und schnell realisierbare
Möglichkeit für die notfallmäßige Oxygenation bei drohendem Atemstillstand und Herz-
Kreislauf-versagen bei Atemwegsverlegung oder Atemwegslähmung. Angebracht ist diese
8Methode auch bei unmöglicher Intubation. Die sichere Identifizierung der intratrachealen
Lage der Kanülenspitze ist entscheidend, denn eine paratracheale Gasinsufflation führt
unvermeidlich zu einem massiven Haut –und Gewebsemphysem mit Verlust der
Atemwegskontrolle.
Abb.2
Stützlarynkoskopie mit einem
modifizierten Kleinasserinstrument,
welches mit eigenem Kanal und eigener
Düse für die supraglottische
Jetventilation ausgestattet ist.
Abb.3
Infraglottische Jetventilation über eine
zwischen Schild- und Ringknorpel
eingeführte Trachealkanüle. Wichtigste
Voraussetzung ist ein ungehinderter
Abstrom des insufflierten Gasvolumens.
Der Jetkatheter kann auch innerhalb eines liegenden Trachealtubus eingeführt werden,
sofern der Gasabfluss nach außen gewährleistet ist. Diese Konfiguration erlaubt die Erhaltung
eines hohen FiO2 trotz Einwirkung des Venturi-Effekts, weil die Sauerstoffkonzentration in
der „Umgebung“ des Jetkatheters mit einem kontrollierten Flow eingestellt werden kann.
Das starre Bronchoskop kann mittels Jet-Ventilation als Eingriffs- und Beatmungsinstrument
zugleich über Zeiträume von mehr als 90 min genutzt werden. Am proximalen Ende des
Bronchoskops ist in einem Seitenarm (Abb.4) eine Jet-Düse eingesetzt, die mit dem Jet-
Ventilator über einen Schlauch niedriger Compliance verbunden ist. Die Spitzwinklige
Einmündung des Seitenarms ist für die unbehinderte Fortleitung des Jetstrahls und für die
Erzeugung des sog. Entrainments in die Trachea wichtig. Die Höhe des maximalen Flusses
durch ein starres Bronchoskop hängt vom Arbeitsdruck und vom Durchmesser der Jetdüse
und des Bronchoskoprohres ab.
Abb.4
Jetventilation bei starrer Bronchoskopie.
Die Jetleitung a) mündet in eine
spitzwinklig angebrachte Düse am
proximalen Rohrende. b) Lichtleitung;
c) offener Seitenarm für zusätzliche
9Sauerstoffinsufflation sog „bias- a c
flow“, bei ungenügender Oxygenation.
b
8. Einstellungen und Parameter
Wichtige Einstellungen:
Arbeitsdruck
Beatmungsfrequenz
Inspirationsdauer
Inspiratorische Sauerstoffkonzentration
Einfluss der Jet-Ventilations- Einstellparameter auf den arteriellen Blutgasstatus
Parameteränderung paO2 paCo2
● Erhöhung der FiO2 +++ Ø
● Senkung der FiO2 --- Ø
● Erhöhung des Arbeitsdrucks ++ ---
● Senkung des Arbeitsdrucks - - +++
● Erhöhung der Beatmungsfrequenz + +
● Senkung der Beatmungsfrequenz - -
● Erhöhung der Inspirationsdauer + Ø
● Senkung der Inspirationsdauer - Ø
(+ = Anstieg des Partialdrucks; - = Abfall des Partialdrucks; Ø = geringer oder kein
Einfluss auf den Partialdruck)
Die vom Anwender einstellbare Drosselung des an der primären Gasquelle anstehenden
Drucks ergibt den Arbeitsdruck, welcher in der Jetleitung nach Freigabe durch das
Hauptventil zustande kommt.
Bei lungengesunden Erwachsenen wird bei Gebrauch von englumigen Jetkathetern (relativ
hoher Widerstand) in der Regel ein Arbeitsdruck zwischen 1,5 und 2,5 bar eingestellt, beim
starren Bronchoskop (relativ geringer Widerstand) genügen 0,5 bar weniger. Mit dem
Arbeitsdruck wird in erster Linie die CO2-Elimination und in zweiter Linie die Oxygenation
beeinflusst.
Die Frequenz hat einen geringeren Einfluss auf die CO2- Eliminierung. Das Optimum der
Interaktion zwischen den verschiedenen Gasaustauschmechanismen liegt im Bereich von 100
10bis etwa 200 Pulsen pro Minute. Ab einer Frequenz von 300 pro Minute nimmt die
Wirksamkeit der CO2-Elimination ab.
Der Einfluss der Inspirationsdauer (ID) auf den Gasaustausch ist insofern schwierig zu
beschreiben, als dass sie unvermeidlich mit anderen Parametern in Wechselwirkung tritt; eine
ID - Verlängerung vergrößert beispielsweise das Minutenvolumen, welches vom Jet-
Ventilator abgegeben wird,, was sekundär Oxygenation und CO2-Elimination verbessert.
Zufolge einer experimentellen Untersuchung an künstlichen Lungen ergibt sich eine optimale
ID, wenn sie mit dem Zeitpunkt von Zyklusbeginn bis zum Einsetzen des Luftrückflusses
übereinstimmt. In der Regel wird daher eine ID von 50% verwendet.
Ein wichtiger Parameter ist die tracheale inspiratorische Sauerstoffkonzentration (FiO2).
Aufgrund des Entraiments stimmt dieser oft nicht mit der eingestellten bzw. in der Jetleitung
tatsächlich vorhandenen Sauerstoffkonzentration überein. Dieses Phänomen ist je nach
Konfiguration des Beatmungssystems und der anderen Einstellparameter unterschiedlich stark
ausgeprägt und bewirkt in der Regel eine Verminderung der FiO2 um bis zu 20%.
Insbesondere, wenn Laserlicht zur Anwendung kommt, gilt es, so wenig wie möglich und nur
so viel wie nötig Sauerstoff zu verabreichen. Allerdings wird das Entflammrisiko weitaus
mehr von anderen Faktoren wie Kathetermaterial, Wattleistung und Impulsdauer des Lasers
beeinflusst.
9. Atemwegsdruck
PIP Atemwegsspitzendruck
mPaw Atemwegsmitteldruck
EEP Endexpiratorischer Atemwegsdruck
Der Atemwegsdruck (Paw) ist eine resultiernde Variable, die selbst inter- und intraindividuell
extrem schwanken kann. Ihre Größe ergibt sich u.a. aus Atemwegswiderständen, der
Thoraxcompliance und dem intrathorakalen Gasvolumen. Charakteristische Eckdaten des
Paw sind der Atemwegsspitzendruck (PIP = „peak inspiratory pressure“ Abb.5), der
Atemwegsmitteldruck (mPaw = „mean airway pressure“ und der endexpiratorische
Atemwegsdruck (EEP = „end expiratory pressure“). Obwohl der Druckverlauf im
Beatmungssystem eher einer Rechteckwelle nahe kommt, resultiert in den Atemwegen eine
trianguläre Druckwelle.
Durchweg höhere Beatmungsdrücke können die Oxygenation aufgrund des Recruitments
(Zunahme der Belüftung) von atelektatischen Alveolen verbessern. Gleichzeitig behindern
hohe Paw den venösen Rückstrom in den Thorax und verursachen eine Zunahme des
pulmonal-ateriellen Widerstands. Beeinträchtigungen der Lungendurchblutung wiederum
bewirken eine Zunahme der Totraumventilation, die sich vorwiegend zuungunsten der CO2-
Elimination auswirkt. Eine hohe Paw-Amplitude begünstigt die CO2-Elimination, da sie zur
Vergrößerung der tidalen Thorax-exkursonen führt. Bei der Messung und der Überwachung
des Paw kommt es entscheidend auf den Meßort an.
11Messungen im starren Abb.5
Bronchoskop sind verhältnis-
mäßig schlecht, sie stimmen
nicht mit dem intrapulmonalen
Drücken überein. Der tracheale
Druck gilt als ein zuverlässiger
Messort für den alveolären Paw.
Solange das System nach außen
offen ist, bleibt der
Atemwegsdruck meist tiefer als
bei IPPV. Es gehört zu den
Grundprinzipien der Jet-
Ventilation, stets einen
ungehinderten Abfluss für das
auszuatmende Gas offenzu-
halten, um einen ungewollten
Druckanstieg auszuschließen.
.
Display eines Jetventilators
Die Atemwegsdrücke werden, wie in Abb.6, numerisch und als Druckkurve angezeigt
Abb.6
1210. Der Fragebogen
Um den Fragebogen (Abb.7) zu erstellen, musste ich erst einmal wissen, wo die Bedürfnisse,
meiner Arbeitskollegen sind. Ich habe Interviews mit verschiedenen Personen geführt. Nach
kurzer Zeit sind dann Einzelne direkt auf mich zugekommen um mir ihre Problematik mit
dem Gerät zu schildern. Mir war von vornherein klar, das das Hauptproblem, die wenige
Benutzung des Gerätes ist. Die Fragen sollten mir also helfen, ein oder mehrere Instrumente
zu erstellen, welche im täglichen Alltag den Umgang mit dem Jet-Ventilator vereinfachen.
Hier die Auswertung:
Von 122 verteilten Fragebögen sind 64 Stück beantwortet worden. Vier Fragebögen wurden
nicht ausgefüllt abgegeben, mit der Begründung, noch nicht mit dem Jet-Ventilator gearbeitet
zu habe
Dies ist der Fragebogen, den die Teilnehmer ausgefüllt haben.
Abb.7
Oberarzt Facharzt Assistent Pflegefachperson Pflegefachperson
Oberärztin Fachärztin Assistentin Anästhesie Anästhesie
Anästhesie in Weiterbildung
Ja Teilweise Nein
1. Grundlagenkenntnisse
Ich habe schon mit dem Jet-Ventilator gearbeitet
Ich kenne den Standort des Jet-Ventilators
Ich kenne das Prinzip der Jet-Ventilation
Ich kann den Dichtigkeitstest, mit der beiliegenden Anleitung, durchführen
2. Material und Zubehör
Ich kenne das Material, welches ich brauche um zu jetten und weis, wo das Ersatzmaterial gelagert ist
Ich kenne die Anschlüsse und ihre Verbindungen
Ich kenne die Befeuchtung und weis wie sie in Betrieb genommen wird
3. Bedienung
Ich kenne das Bedienungsfeld und kenne mich im Menü und im Untermenü aus
Ich kenne die Abkürzungen und ihre Bedeutungen
( PIP, PP, ZPM, ID, AD, LPM)
4. Parameter
Ich kenne die Grundeinstellung des Jet-Ventilators
Ich kann die Einstellung, anhand der transcutanen- PaCO2 und PaO2 Messung, dem Patienten
anpassen
5. Meinungen, Anregungen und Kommentare zum Jet-Ventilator
1310.1. Teilnehmer der Umfrage
Oberärzte (AO) 13 Teilnehmer
Fachärzte (FA) 4 Teilnehmer
Assistenten (AA) 12 Teilnehmer
AnästhesieFachpflegefrau/Mann (AFP) 19 Teilnehmer
AnästhesieFachpflegefrau/Mann in Weiterbildung (AFPW) 6 Teilnehmer
10.2. Die Auswertung des Fragebogens
Funktion und Grundlagen- Material Bedienung Grundeinstellungen
Beschäftigungsgrad Kenntnisse
OA 11 Teilnehmer von 13 12 von 13 kannten 8 von 13 waren 11 von 13 kennen die
kreuzten ein Ja an. 2 das Material und sich sicher im Grundeinstellung.
13 Teilnehmer einer Teilweise und wussten wo es zu Umgang mit der
von ihnen hat noch bestätigten damit, finden ist. Bedienung des
nie mit dem Jet- dass die Grundlage- Allerdings gab es Gerätes.
Ventilator kenntnisse vorhanden Unsicherheiten mit
gearbeitet. sind. dem
Ersatzmaterial.
FA 3 von 4 kennen die 3 von 4 wissen 2 von 4 kennen Alle kannten die
Grundlagen- welches Material sich in der Grundeinsstellung.
4 Teilnehmer kenntnisse. zu gebrauchen ist Bedienung aus.
und wo es sich
befindet.
AA 11 von 12 kennen die 6 von 12 kennen 3 von 12 wissen 7 von 12 kennen die
Grundlagen- das Material. wie das Gerät zu Grundeinstellung.
12 Teilnehmer kenntnisse. bedienen ist.
1 Teilnehmer hat
noch nie mit dem
Jet-Ventilator
gearbeitet
AFP 16 von 19 haben die 15 von 19 kenne 10 von 19 fühlen 12 von 19 kenne die
Grundlagenkenntnisse sich mit dem sich in der Grundeinstellung
19 Teilnehmer. Material aus. Bedienung sicher
2 von ihnen hatten
noch nie mit dem
Jet-Ventilator
gearbeitet
AFPW 3 von 6 haben die 3 von 6 kennen das 1 von 6 fühlt sich 4 von 6 kenne die
Grundlagenkenntnisse Material. sicher in der Grundeinstellung.
6 Teilnehmer. Bedienung.
Einer davon hatte
noch nie mit dem
Jet-Ventilator
gearbeitet.
14Anhand der Tabelle erkennt man, wo die Defizite im Umgang mit dem Jet-Ventilator liegen.
Sie zeigt uns auch, welche Berufsgruppen sich gut mit dem Gerät auskennen und wo die
Schwachstellen der Teilnehmer sind.
Das Diagramm soll auf einen Blick verdeutlichen, was tabellarisch aufgezählt ist.
20
18
16
14 Anza hl de r Te ilne hm e r
12 Grundla ge nke ntnisse
10 Ma te ria l
8 Be die nung
6
Grunde inste llung
4
2
0
AO FA AA AFP AFPW
Die Auswertung meines Fragebogens (Abb.7) ergab, die meisten kennen die Grundlagen und
das Prinzip des Jet-Ventilators. Da das Gerät neu ist, kommt es meistens in der Bedienung zu
Unsicherheiten. Deshalb ist es wichtig, mit einer verständlichen und gezielten Anleitung den
Bediener des Gerätes zu unterstützen. Anleitungen des Herstellers sind meist sehr ausführlich
und für den alltäglichen Gebrauch zu aufwendig geschrieben.
Durch den Fragebogen habe ich erfahren das es sich um kleine Details handelt, die zu den
bestehenden Anleitungen ergänzt werden können oder um komplett neue Anleitungen, die bis
dato noch gar nicht existierten (z.B. Befeuchtung).
Die wichtigsten Punkte werden hier erwähnt und in Form eines Standards behandelt. Es
werden Vorschläge gemacht, wie eine Verbesserung der vorhandenen Anleitungen aussehen
könnte oder was noch zusätzlich dazu kommen sollte.
Es gibt mehrere Instrumente, die zur Sicherheit im Umgang mit Geräten führen. Zum Beispiel
eine Arbeitsgruppe (gut geschultes Personal) die sich mit dem Thema beschäftigt und
jederzeit Ansprechpartner für alle Mitarbeiter sind. Es könnten auch regelmäßige
Fortbildungen stattfinden (Kostenaufwendig), welche nach Bedarf besucht werden können,
Lehrfilme die frei zugänglich sind und jederzeit angeschaut werden können (im klinischem
Alltag nicht umsetzbar).
Ich habe mich für den Standard entschieden, denn Standards sind weit verbreitete
Instrumente, es sind Normen, Richtmaße; sie dienen der Qualitätssicherung. Standards sind
Basisinstrumente zur Erfassung der Qualität, indem sie festgelegte bzw. formulierte und
allgemeingültige Maßstäbe für das Handeln setzen.
Er ist für jeden Mitarbeiter verbindlich und kann jederzeit aktualisiert werden.
1511. Der Standard
11.1. Der Jet-Ventilator: Monsoon von ACUTRONIC
Display
Bypassflow
Bypassflo
w
11.2. Grundeinstellung
Display: Hier im Display ist die Grundeinstellung zu sehen.
1611.3. Einwilligung: Die Einwilligung des Patienten ist
Grundvoraussetzung, dass der Eingriff mit dieser
Methode stattfinden kann.
11.4. MSS Es gelten die Minimal Safty Standards
(Anästhesie Homepage)
Kontrolle des notwendigen Materials anhand der
Checkliste sowie Reflexion des Team-verhaltens
im Briefing und Debriefing
11.5. Medikamente
Propofol 1% (10mg/ml) Perfusorspritze 50ml
Propofol 1% (10mg/ml) 20ml-Spritze
Lidocain 1% (10mg/ml) 5ml-Spritze
Atracurium (10mg/ml) 5ml-Spritze
Fentanyl (0.05mg/ml) 10ml-Spritze
Ephedrin ( 5mg/ml) 5ml-Spritze
Atropin (0.5mg/ml) 2ml-Spritze
Dicodid (15mg/ml) 1ml-Spritze
Dicodid ist ein synthetischer Morphinabkömmling, es zeigt eine starke Hemmwirkung auf das
Hustenzentrum. Dicodid wird kurz vor der Einleitung (7mg i.v.) gespritzt und kurz vor der
Ausleitung der Narkose (nochmals 7mg i.v.), um den Hustenreiz zu reduzieren.
1711.6. Standort Das Gerät befindet sich in der Nachbehandlung
Eins und Zwei und sollte immer am Strom
angeschlossen sein (wegen der Transkutanen
PaCO2Messung).
11.7. Inbetriebnahme Bevor das Gerät mit dem Netz verbunden wird,
muss der Netzausfall Alarm überbrüft werden,
indem das Gerät eingeschaltet wird (an der
Rückseite). Es muss ein akustischer Alarm ertönen.
Jetzt das Gerät an die Netzsteckdose anschließen.
Druckluft und Sauerstoff Versorgungsschläuche an
den Entsprechenden Wandanschlüssen anschließen.
11.8. Vorbereitung Material
Abb.8
In der Schublade(Abb.8) befinden sich die Testlunge
für den Dichtigkeitstest, Reserveschläuche, Verneb-
lerset mit Bypassschlauch, Trachealkanüle (Er-
wachsene) und Swivel-Jet mit Drehkonektor (Abb.9)
Dies gibt die Möglichkeit über den Trachealtubus zu
Jetten.
Auf der unteren Ablage des Wagens, befinden sich der
Jet-Katheter (zwei Stück) und die Befeuchtungseinheit
(De luxe). Ersatzmaterial befindet sich auf der Etage
01 im Materialraum, Oberschrank Nr. 13.
Der Transkutane Co2-Messer muss Betriebsbereit und Abb.9
geeicht sein (siehe HNO-Skript Seite 10)
1811.9. Der Jet-Katheter
Im USB verwenden wir den Doppellumen Jet-
Katheter Laser 40. Er ist hitzebeständig
(Lasertauglich) und hat eine Länge von 40
Zentimeter. Das blaue Lumen ist für das Jet-Gas und
das weisse für die Drucküber-wachung. Der
Führungsdraht wird nach Einlage des Katheters
entfernt. Der rote Ring dient zur Kontrolle der
Intubationstiefe, er wird in der Höhe des
Mundwinkels angebracht um Lageveränderungen zu
erkennen.
11.10. Anschlüsse Geräteseite
Patientenschlauch (blauer Schlauchansatz) an den
mit jetoutlet bezeichneten Ausgang auf der
Frontseite des Gerätes anschließen.
Druckmessleitung am entsprechenden Anschluss,
airway pressure, einstecken. Geräteseitig sind die
Anschlüsse mit einer Bayonetteverbindung versehen
( Katheter mit Luer-Lock-Verbindung).
11.11. Bypass
Der Bypass, dient in erster Linie zum
präoxyginieren und zum inhalieren von
Medikamenten mit dem Medikamenten-
vernebler. Außerdem kann im Notfall ein
Leradal-oder AMBU-Beutel angeschlossen
werden.
Inbetriebnahme:
Drücken des alpha-dial, dann auf
Bypass und durch drehen des alpha-
dial die Flussstärke, (Verneblerstärke)
maximal 70 LPM, einstellen. Der Verbindungsschlauch für
den Medikamentenvernebler.
LPM Liter pro Minute
19
11.12. Dichtigkeitstest11.12. Dichtigkeitstest
Der Dichtigkeitstest ist zur Sicherheit des Patienten durchzuführen, die Durchführung ist
in einem extra Anhang am Jet-Ventilator beschrieben.
2011.13. Befeuchtungseinheit
Die Befeuchtungspumpe befindet sich
Geräteseitig.
Zuerst muss die Pumpenabdeckung
entfernt werden.
Den Silikon Pumpenschlauch so
einlegen, dass die Luer-Lock-adapter in
die Führungsschächte eingeklemmt
werden können.
Der Anschluss zur Infusion wird im
unteren Führungsschacht eingeklemmt
und der Anschluss für das Gerät in den
Oberen.
Eingelegt sieht das Ganze so aus, die
Pumpe pumpt gegen den Uhrzeigersinn
in Pfeilrichtung.
Abdeckung wieder drauf und
verriegeln.
21Inbetriebnahme und Einstellung der Befeuchtung:
1. Drücken des alpha-
dial um ins Menü zu
gelangen
2. alpha-dial drehen bis
Befeuchtung schwarz
hinterlegt dargestellt
wird, zur Bestätigung
alpha-dial drücken.
3. Befeuchtung durch
drehen des alpha-dial
einstellen und durch
drücken übernehmen.
Erscheint eine Alarmmeldung „ Kein Wasser “ auf dem Display kann durch drücken der
Alarmtaste der akustische Alarm unterdrückt werden. Gleichzeitig wird die Wasserpumpe
mit erhöhter Geschwindigkeit betrieben, bis der Wasserdetektor Wasser erkennt.
Nach Gebrauch der Befeuchtung, sollte Wasseranschluss entfernt werden und die
Wasserpumpe mit eingespanntem Pumpenschlauch ca. 5 Minuten betrieben werden um alles
Wasser aus dem System zu entfernen.
2211.14. Abkürzungen und ihre Bedeutungen
PIP (mbar) Positiver inspiratorischer Druck oder Atemwegsdruck. PIP ist ein Grenzwert
der nur mit einer separaten Messleitung gemessen werden kann. Wird der durch den
Grenzwert definierte Druck überschritten gibt es einen akustischen und visuellen Alarm und
das Hauptventil schaltet sich automatisch ab.
PP (mbar) Pausendruck entspricht dem Druck in der Jetleitung und wird wenige
Millisekunden vor dem Einschalten des Hauptventils gemessen. Wird auch hier der
eingestellte Grenzwert überschritten, schaltet das Hauptventil ab.
PEEP (mbar) Positiver endexpiratorischer Druck, dieser Grenzwert verhält sich ähnlich
wie der PIP Grenzwert, sperrt jedoch das Hauptventil nur solange wie der Grenzwert
überschritten ist ohne einen Alarm auszulösen. Mit dieser Methode kann eine überlagerte
Jetventilation zu einem konventionellen Beatmungsgerät realisiert werden.
CAVE: die PEEP-limite muss unterhalb der PP-limite eingestellt werden, ansonsten wird die
Beatmung durch das Ansprechen der PP-limite unterbrochen.
PIP Zero Bei Verwendung von 2-lumen Katheter kann es, je nach Größe des Lumen, zu
einer Erhöhung des PIP-Nullpunktes kommen. Mit der Funktion PIP Zero kann dieser
Nullpunkt um max Acht mbar korrigiert werden.
Vor Verwendung eines neuen Katheters mit neuem Lumendurchmesser, unbedingt den PIP
Zero Korrekturwert überprüfen.
f (ZPM) dies bedeutet die Frequenz, angegeben in Zyklen pro Minute.
11.15. Beenden
Die Maschine wird jetzt am Hauptschalter ausgeschaltet und das Material wird entfernt.
Der Jet-Katheter ist Einmalmaterial und wird im normalen Abfall entsorgt. Die Jetschläuche
werden desinfiziert und eingeschweißt.
Wenn das Material der Befeuchtungseinheit in Gebrauch war, muss auch dieses komplett in
den normalen Abfall entsorgt werden.
2312. Ein Blick über die Grenzen
Während meiner Recherchen über den Jet-Ventilator, bin ich auf die verschiedensten
Techniken und Einsatzmöglichkeiten gestoßen. Dies war so interessant, dass ich mich mit
einigen Spitälern in Kontakt setzte um Informationen einzuholen. Ich wollte wissen wie sie
mit dem Jet-Ventilator arbeiten und wie oft er bei ihnen im Einsatz ist.
Also rief ich im Universitätsspital-Zürich (USZ) an, und sprach mit dem zuständigen
Anästhesiefachpfleger. Leider hat das USZ auch nicht mehr Einsätze mit Jet-Ventilator als
wir, auch keine bestimmten Techniken die sich von unseren unterscheiden.
Im Kantonsspital St.-Gallen ist die Technik eine völlig andere. Hier wird kein Jet-Katheter
wie wir ihn kennen verwendet, sondern eine Ravussin-Kanüle(Abb.10). Die Kanüle wird
transtracheal (durch die Membrana cricothyreoidea) zu den Luftwegen eingeführt. Das
Einführen erfolgt bei Wahleingriffen wenn immer möglich unter fiberoptischer Kontrolle. Ein
blindes Einführen kommt nur bei „cannot intubate-cannot ventilate“– Situationen oder bei
besonderen schwierigen Luftwegsverhältnissen in Frage.
Abb.10: Ravussin–Kanülen
Im Gegensatz zu unserem Spital und dem USZ, kommt man in St.-Gallen im Durchschnitt auf
5 bis 10 Einsätze pro Woche mit dem Jet-Ventilator, obwohl die Indikationen die gleichen
wie bei uns sind. Ich konnte nicht herausfinden weshalb es sich so unterscheidet.
In der Thoraxklinik von Heidelberg, setzten sie den Jet-Ventilator auch in der
Thoraxchirurgie ein. Die Bedeutung des Jet-Ventilators für die Lungenchirurgie liegt in der
Ruhigstellung des Operationsgebiets aufgrund der geringen Volumenschwankungen und
Ausdehnung der ventilierten Lunge. Auch bei karinanaher Trachearesektion und
Reanastomosierung der Trachea (Abb.11) kam der Jet-Ventilator zum Einsatz (Siehe
Beispiel).
24Abb.11
Beispiel:
a.) Initial konven-
tionelle
Tubusbeatmung;
b.) Trans-OP-Feld Jet-
Ventilation während
Naht der Trachea-
hinterwand
c.) Abschließend
transluminale Jet-
Ventilation während
Naht der Trachea-
vorderwand
13. Fazit
Die Jet-Ventilation unterscheidet sich scheinbar in beunruhigender Weise von herkömmlichen
Beatmungsverfahren. Durch die geringen Einsatzmöglichkeiten und die z. Z., bestehenden
Indikationen, ist es schwierig, das Gerät in den alltäglichen Ablauf zu integrieren. Der Einsatz
beschränkt sich hauptsächlich auf Eingriffe an den Atemwegen.
Werden alle Sicherheitsaspekte beachtet und die physikalischen Grundlagen mit Umsicht auf
die klinische Situation angewendet, können die Bestimmungsgrößen des Gaswechsels
zuverlässig gesteuert werden.
Nach Rücksprache mit den zuständigen Oberärzten der Anästhesie und der HNO, gibt es jetzt
klar definierte Indikationen und Kontraindikationen nach denen man sich richtet.
Die Befragung hat gezeigt, dass ein Interesse am Jet-Ventilator vorhanden ist und der Bedarf
eines Instrumentes zur Sicherheit im Umgang mit dem Gerät besteht.
Mit dem Standard erhoffe ich mir ein Instrument erarbeitet zu haben, mit dem die Mitarbeiter
sicher umgehen können. Er sollte beim Jet-Ventilator in der Schublade liegen und immer
griffbereit sein.
Interessant wäre es, nach einiger Zeit eine Evaluation des Standards durchzuführen, z.B. mit
einer weiteren Mitarbeiterbefragung.
Andere Spitäler zeigen uns auf, dass es noch weitere Arbeitstechniken gibt um den Patienten
mit dem Jet-Ventilator zu beatmen. Es ist bestimmt von Vorteil wenn man mehrere Techniken
beherrscht und sich den gegebenen Umständen des Patienten und den Operateuren anpassen
kann.
2514. Literatur
3. Aloy A, SchachnerM, Spiss C, Cancura W (1990)
Tubuslose translaryngeale superponierte Jet-Ventilation. Anästhesist 39:493-498
4. Aloy A, Schragl E (1995)
Jet-Ventilation. Technische Grundlagen und klinische Anwendungen.
Springer, Wien NewYork
5. Biro P, Pasch T (1995)
Die Schwierige Intubation: erschwert zugängliche Atemwege.
Huber, Bern Göttingen Toronto
6. Ihra G, Kepka A, Lanzenbereger E, Donner A, Scharbering C, Zimpfer M (1998)
SHFJV. Jet-Adapter zur Durchführung der Superponierten Hochfrequenz Jet-
Ventilation über Tubus in der Intensivmedizin: Eine technische Neuerung.
Anaesthesist 47:209-219
7. Biro P, Wiedemann K (1999)
Jet-Ventilation und Anästhesie für diagnostische und therapeutische Eingriffe an
den Atemwegen. Anaesthesist 48:669-685
8. ACUTRONIC Medical System AG
Video Assisted Intubation Jet-Beatmung.
www.acutronic-medical.ch
26Sie können auch lesen