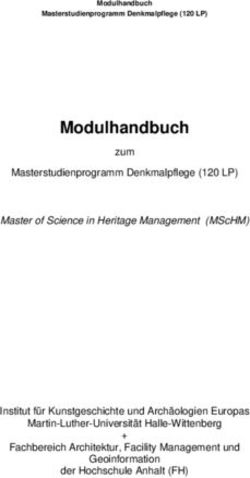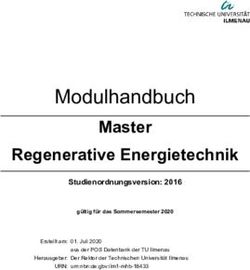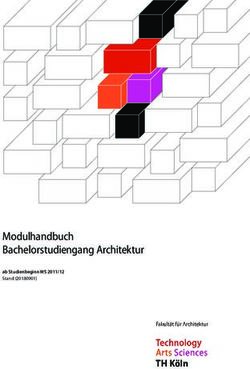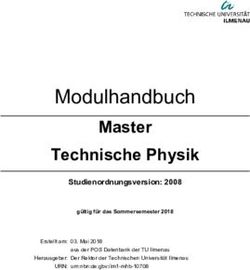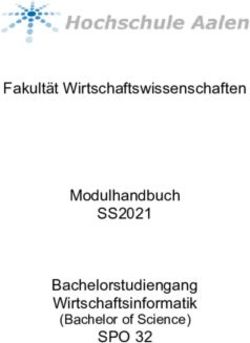Modulhandbuch Flug und Fahrzeuginformatik (Bachelor) - Fakultät Elektrotechnik und Informatik
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Modulhandbuch
Flug und Fahrzeuginformatik
(Bachelor)
Fakultät Elektrotechnik und Informatik
Stand: Sommersemester 2014Modulhandbuch Flug- und Fahrzeuginformatik (Bachelor) Sommersemester
2014
Inhaltsverzeichnis
1 STUDIENAUFBAU ______________________________________________________________ 1
2 MODULBESCHREIBUNGEN _______________________________________________________ 2
2.1 MODULE DES ERSTEN STUDIENABSCHNITTS ______________________________________________ 2
2.2 MODULE DES ZWEITEN STUDIENABSCHNITTES ___________________________________________ 19
2.2.1 MODULE BEIDER STUDIENRICHTUNGEN ______________________________________________ 19
2.2.2 MODULE DER STUDIENRICHTUNG AVIONIK____________________________________________ 48
2.2.3 MODULE DER STUDIENRICHTUNG AUTOMOTIVE ________________________________________ 58
2.2.4 FACHWISSENSCHAFTLICHE WAHLPFLICHTMODULE _______________________________________ 66
2.2.5 ABSCHLUSSARBEIT ____________________________________________________________ 67
iiModulhandbuch Flug- und Fahrzeuginformatik (Bachelor) Sommersemester
2014
1 Studienaufbau
Die Regelstudienzeit für die Bachelor-Studiengänge umfasst sieben Semester. Die Studiengänge glie-
dern sich in zwei Studienabschnitte. Der erste Studienabschnitt umfasst zwei theoretische Studien-
semester und schließt mit einer Grundlagen- und Orientierungsprüfung ab. Der zweite Studienab-
schnitt beinhaltet vier theoretische Semester und ein praktisches Semester, welches i.d.R. als 5. Stu-
diensemester geführt wird. Nach dem ersten Studienabschnitt belegen die Studierenden Fächer ei-
ner von ihnen gewählten Studienrichtung.
Bachelor Master
7.Semester Theorie
10.Semester Masterar-
beit
6.Semester Theorie
9.Semester Theorie
5.Semester Praxis 2.Studienabschnitt
8.Semester Theorie
4.Semester Theorie
3.Semester Theorie
2.Semester Theorie
1.Studienabschnitt
1.Semester Theorie
Bei Erfüllung bestimmter Zugangsvoraussetzungen besteht die Möglichkeit im Anschluss an das Ba-
chelor-Studium Informatik ein Master-Studium anzuschließen. Die Hochschule Ingolstadt bietet hier
zwei Master-Studiengänge an:
- Konsekutiver Master-Studiengang Informatik (M.Sc.)
- Nicht-konsekutiver Master-Studiengang International Automotive Engineering (M.Eng.)
1Modulhandbuch Flug- und Fahrzeuginformatik (Bachelor) Sommersemester
2014
2 Modulbeschreibungen
2.1 Module des ersten Studienabschnitts
2Modulhandbuch Flug- und Fahrzeuginformatik (Bachelor) Sommersemester
2014
Einführungsprojekt
Modulkürzel: FFI_EINF SPO-Nummer: 1
Zuordnung zum Curriculum: Studiengang u. –richtung Art des Moduls Studiensemester
Bachelor Flug- und Fahrzeu- Pflichtmodul 1
ginformatik
Modulverantwortliche(r): Prof. Dr. Ulrich Margull
Dozent(in): Prof. Dr. Ulrich Margull, Wolfgang Rößl, Antje Köhler
Sprache: Deutsch
Lehrformen/SWS: Lehrformen Gruppengrößen SWS
Praktikum 15-20 2
Arbeitsaufwand: Präsenzzeit (Praktikum): 31 h
Selbststudium (Vor- Nachbereitung der Lehrveranstal-
tung, Prüfungsvorbereitung): 29 h
Gesamt: 60 h
Leistungspunkte: 2
Empfohlene Voraussetzungen: - Fähigkeit, zu lesen und logisch systematisch zu denken
- Fähigkeit zu feinmotorischem Arbeiten und zur Zusammenarbeit in
einem Team
- Geduld und Ausdauer
Angestrebte Lernergebnisse: - Kenntnisse über grundlegende Bausteine eines Programms
- Verstehen des Zusammenspiels zwischen Software und Hardware
- Erkennen und Analysieren von Fehlern in technischen Systemen
- Fähigkeit, einfache Programme selbst zu erstellen
- Gegenseitiges Kennenlernen
Inhalt: - Aufbau eines mobilen Roboters im Team
- Einarbeitung in die Programmierumgebung
- Kennenlernen der Sensoren und Aktoren des Roboters
- Erstellen und Ablaufen lassen vorgegebener Programme zur
Nutzung dieser Sensoren und Aktoren
- Bibliotheksführung
- Erstellen eines selbst ausgedachten Programms
Studien-/ Prüfungsleistungen: - Funktionsprüfung des selbst gebauten Roboters
- Vorführung eines eigenen Roboter-Programms
Medienformen: Studierende: Skript, Übungsblätter, Aufgabenblätter, Arbeiten am Rech-
ner und an Modellen
Dozent: Tafel, Overhead- und Beamerprojektionen, Demonstrationen
am Rechner und an Modellen
Literatur: --
3Modulhandbuch Flug- und Fahrzeuginformatik (Bachelor) Sommersemester
2014
Grundlagen der Programmierung 1
Modulkürzel: FFI_GP1 SPO-Nummer: 2
Zuordnung zum Curriculum: Studiengang u. -richtung Art des Moduls Studiensemester
Bachelor Flug- und Fahrzeuginfor- Pflichtmodul 1
matik
Modulverantwortliche(r): Prof. Dr. Franz Regensburger
Dozent(in): Prof. Dr. Franz Regensburger
Sprache: Deutsch
Lehrformen/SWS: Lehrformen Gruppengrößen SWS
Seminaristischer Unterricht mit 15 (P), 20 (Ü), 6
Übung und Praktikum
40 (SU)
Arbeitsaufwand: Präsenzzeit (SU; Ü): 62 h
Präsenzzeit (Praktikum): 31 h
Selbststudium (Vor- und Nachbereitung der Vorlesung, Bearbei-
tung von Übungen, Prüfungsvorbereitung): 117 h
Gesamt: 210 h
Leistungspunkte: 7
Empfohlene Voraussetzun- --
gen:
Angestrebte Lernergebnisse: - Kenntnis allgemeiner Begriffe der Informatik;
- Kenntnis von Methoden zur systematischen Planung und Durchführung von
Software-Projekten;
- Fähigkeit, einfachere Probleme logisch zu erfassen und eine algorithmische
Lösung dafür zu erstellen;
- Kenntnis einer höheren Programmiersprache, insbesondere C
- Fähigkeit, vorgegebene und selbst entworfene Algorithmen in dieser Spra-
che zu formulieren
- Fähigkeit, die Funktionen von Betriebssystemen und Entwicklungsumge-
bungen zu nutzen
- Anwendung der Kenntnisse und Fähigkeiten, die in der zugehörigen Vorle-
sung vermittelt werden
Inhalt: - Allgemeines (Grundbegriffe der Informatik, Phasen und Werkzeuge der
Software-Entwicklung, Syntaxdiagramme, Struktogramme, Grundbegriffe
und Prinzipien der imperativen Programmierung)
- Programmiersprachen (allgemein und Sprache C: Ablaufsteuerung, Daten-
typen, Standard-Bibliothek, Unterprogrammtechnik, Parameterübergabe-
mechanismen, Lebensdauer und Gültigkeitsbereiche von Variablen)
- Standard-Algorithmen (Suchen und Zählen in Reihung; Reihung einlesen,
vorbesetzen, ausdrucken; Teilmengen einer Reihung bearbeiten; Element in
Reihung einfügen, Element aus Reihung löschen)
- Phasen der Software-Entwicklung
4Modulhandbuch Flug- und Fahrzeuginformatik (Bachelor) Sommersemester
2014
Studien-/ Prüfungsleistun- Prüfungsvorleistung: erfolgreiches Bestehen des integrierten Praktikums mit-
gen: tels praktischen Leistungsnachweises durch selbstständige Bearbeitung von
fünf Aufgaben pro Semester, die wesentliche Programmierthemen behandeln.
(Die fertigen Lösungen sind einzeln zu präsentieren, wobei auch Fragen zum
Lösungskonzept und zum erstellten Programm zu beantworten sind. Nur wenn
alle fünf Aufgaben rechtzeitig vorgeführt werden, gilt der Leistungsnachweis
als erbracht.);
Schriftliche Prüfung (90 Minuten)
Medienformen: Studierende: Skript, Übungsblätter, Aufgabenblätter, Arbeiten am Rechner und
an Modellen
Dozent: Tafel, Overhead- und Beamerprojektionen, Demonstrationen am
Rechner und an Modellen
Literatur: − H. Ernst: „Grundkurs Informatik. Grundlagen und Konzepte für die er-
folgreiche IT-Praxis“, 4. Auflage, Vieweg-Teubner (2008)
− D. Hillis: „Computerlogik. So einfach arbeiten Computer“, Bertelsmann
(2001); auch als Goldmann-TB (2002)
− Dausmann, Bröckl, Goll, Schoop: “C als erste Programmiersprache “,
7. Auflage, 2011, Vieweg-Teubner, ISBN: 978-3-8348-1221-6
− B. W. Kernighan, D. Ritchie.: “The C Programming Language”, 2nd edi-
tion, Prentice Hall (1988)
− S. Oualline: “Practical C Programming” 3rd edition, O`Reilly (1997)
5Modulhandbuch Flug- und Fahrzeuginformatik (Bachelor) Sommersemester
2014
Rechnerarchitektur
Modulkürzel: FFI_RA SPO-Nummer: 4
Zuordnung zum Curriculum: Studiengang u. –richtung Art des Moduls Studiensemester
Bachelor Flug- und Fahrzeuginfor- Pflichtmodul 1
matik
Modulverantwortliche(r): Prof. Dr. Andreas Hagerer
Dozent(in): Prof. Dr. Andreas Hagerer
Sprache: Deutsch
Lehrformen/SWS: Lehrformen Gruppengrößen SWS
Seminaristischer Unterricht und 15 (P), 40 (SU) 5
Praktikum
Arbeitsaufwand: Präsenzzeit (SU): 62 h
Präsenzzeit (Praktikum): 15,5 h
Selbststudium (Vor- und Nachbereitung der Lehrveranstaltung,
Prüfungsvorbereitung): 132,5 h
Gesamt: 210 h
Leistungspunkte: 7
Empfohlene Voraussetzun- --
gen:
Angestrebte Lernergebnisse: Diese Lehrveranstaltung vermittelt ein Verständnis der grundlegenden Funkti-
onsweise moderner digitaler Rechnersysteme.
Die Studierenden können Informationen für eine Verarbeitung durch digitale
Rechner darstellen. Sie lernen ausgehend von der datenverarbeitungsgerech-
ten Darstellung von Information und den Prinzipien der befehlsbasierten Aus-
führung von Verarbeitungsvorschriften die Elemente einer Befehlssatzarchitek-
tur und ihrer Realisierung durch Hardware-Komponenten.
Sie werden befähigt, das Zusammenspiel von Hardware und Software zu ver-
stehen. Sie können grundlegende Elemente prozeduraler Programme Pro-
grammierung in einer Maschinensprache formulieren.
Sie kennen die Konzepte zur Leistungssteigerung in modernen Prozessoren und
die damit verbundenen Problematiken. Sie können die Wirkung von Program-
mierungsalternativen auf die Ausführungsgeschwindigkeit beurteilen.
Im begleitenden Praktikum erlernen die Studierenden in konkreten Situationen
die Umsetzung der Konzepte maschinennaher Programmierung sowie die
Auswirkung verschiedener Rechnerstrukturen auf die Ausführung von Maschi-
nenprogrammen zu beurteilen.
Inhalt: Seminaristischer Unterricht:
- Grundlagen: Darstellung von Information in Rechnersystemen
- Grundbegriffe der Rechnerarchitektur, Grundstruktur von Universalrech-
nern, Grundprinzipien der Programmausführung
- Befehlssatzarchitektur: Befehlssatz, Adressierungsarten, Unterbrechungen
- Grundlagen der maschinennahen Programmierung: Speicherplanung, Kon-
trollstrukturen, Unterprogramme
6Modulhandbuch Flug- und Fahrzeuginformatik (Bachelor) Sommersemester
2014
- Konzepte moderner Rechnersysteme: Pipelining, Superskalarität, Speicher-
hierarchie, Cache-Speicher
Praktikum:
- Umgang mit Darstellungsformen für Information
- Einzelaktionen der Ausführung von Maschinenbefehlen
- Zusammenspiel der Rechnerkomponenten bei der Ausführung von Pro-
grammen
- Umsetzung von Konstrukten höherer Programmiersprachen in Maschinen-
sprache
- Realisierung von Unterprogrammmechanismen und dynamischer Speicher-
allokation
- Unterbrechungen und ihre Behandlung
- Funktionsweise Komponenten moderner Rechnersysteme: Pipelining und
Cache-Speicher
Studien-/ Prüfungsleistun- Prüfungsvorleistung: praktischer Leistungsnachweis nach erfolgreichem Beste-
gen: hen des integrierten Praktikums, welches aus der Bearbeitung von 7-10 Prakti-
kumsversuchen besteht
Schriftliche Prüfung (90 Minuten)
Medienformen: Studierende: Skript, Übungsblätter, AufgabenblätterDozent: Tafel, Overhead-
und Beamerprojektionen, Demonstrationen am Rechner und an Modellen
Praktikum: Arbeiten mit Rechnermodellen (Simulatoren)
Literatur: - A. S. Tanenbaum, J. Goodman: Computerarchitektur, Pearson (2004);
- D. A. Patterson, J. L. Hennessy: Computer Organization and Design: The
Hardware/Software Interface, Morgan Kaufmann (1998).
7Modulhandbuch Flug- und Fahrzeuginformatik (Bachelor) Sommersemester
2014
Mathematische Grundlagen 1
Modulkürzel: FFI_MG1 SPO-Nummer: 7
Zuordnung zum Curriculum: Studiengang u. -richtung Art des Moduls Studiensemester
Bachelor Flug-und Fahrzeuginfor- Pflichtmodul 1
matik
Modulverantwortliche(r): Wolfgang Rößl
Dozent(in): Wolfgang Rößl, Joanna Lorencka
Sprache: Deutsch
Lehrformen/SWS: Lehrformen Gruppengrößen SWS
Seminaristischer Unterricht mit 20 (Ü), 40 (SU) 5
Übung
Arbeitsaufwand: Präsenzzeit (SU): 62 h
Präsenzzeit (Ü): 15,5 h
Selbststudium (Vor- und Nachbereitung der Lehrveranstaltung,
Prüfungsvorbereitung): 102,5 h
Gesamt: 180 h
Leistungspunkte: 6
Empfohlene Voraussetzun- --
gen:
Angestrebte Lernergebnisse: Ziel ist es, die Studierenden an die mathematische Denk- und Arbeitsweise
heranzuführen, sowohl inhaltlich als auch vom unverzichtbaren Formalismus
her.
Dazu werden grundlegende mathematischen Begriffe und Verfahren vorge-
stellt, die der Informatiker benötigt, und auf die in höheren Semestern aufge-
baut werden kann.
Inhalt: - Abbildungen, Logische Schaltungen, Aussagenlogik, elementare Mengen-
lehre, Binärwörter, Binomialkoeffizienten, Boolesche Algebra, Quantoren-
logik
- Einführung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung
- Folgen und Reihen
- komplexe Zahlen
- Matrizenkalkül
- Lineare Gleichungssysteme
- Differential- und Integralrechnung
Studien-/ Prüfungsleistun- Schriftliche Prüfung (90 Minuten)
gen:
Medienformen: Als Download aus dem Intranet: Zusammenfassungen und Ergänzungen zur
Vorlesungsmitschrift, Aufgabenblätter (z.T. mit Lösungen)
Tafel, Overhead- und Beamerprojektionen
Literatur: J. Erven: „Taschenbuch der Ingenieurmathematik“, München (2011)
G. Teschl, S. Teschl: „Mathematik für Informatiker“, Bd. 1, Berlin (2008)
8Modulhandbuch Flug- und Fahrzeuginformatik (Bachelor) Sommersemester
2014
Physikalische und elektrotechnische Grundlagen
Modulkürzel: FFI_PEG SPO-Nummer: 9
Zuordnung zum Curriculum: Studiengang u. –richtung Art des Moduls Studiensemester
Bachelor Flug- und Fahrzeuginfor- Pflichtmodul 1
matik
Modulverantwortliche(r): Wolfgang Rößl
Dozent(in): Wolfgang Rößl
Sprache: Deutsch
Lehrformen/SWS: Lehrformen Gruppengrößen SWS
Seminaristischer Unterricht mit 20 (Ü), 40 (SU) 4
Übung
Arbeitsaufwand: Präsenzzeit (SU, Ü): 62 h
Selbststudium (Vor- Nachbereitung der Lehrveranstaltung, Prü-
fungsvorbereitung): 88 h
Gesamt: 150 h
Leistungspunkte: 5
Empfohlene Voraussetzun- --
gen:
Angestrebte Lernergebnisse: - Erlernen der wichtigsten Phänomene und Gesetzmäßigkeiten aus Mechanik
und Elektrodynamik;
- Fähigkeit technische Systeme auf physikalische Modelle abzubilden;
- Praktische Anwendung des gelernten anhand von Übungen;
Inhalt: - Mechanik
o Kinematik und Dynamik
o Arbeit, Energie, Impuls, Leistung
o Gravitation ( konservative Kraftfelder )
- Elektrizitätslehre
o Gleichstromlehre
o Elektrisches Feld
o Magnetisches Feld
o Maxwell Gleichungen ( Integralform )
Studien-/ Prüfungsleistun- Schriftliche Prüfung (90 Minuten)
gen:
Medienformen: Studierende: Mitschrift, Übungsblätter, Aufgabenblätter
Dozent: Tafel, Overhead- und Beamerprojektionen,
Literatur: - P. Dobrinski, G.Krakau, A.Vogel: „Physik für Ingenieure“,
Vieweg+Teubner
9Modulhandbuch Flug- und Fahrzeuginformatik (Bachelor) Sommersemester
2014
Betriebswirtschaftliche Grundlagen
Modulkürzel: FFI_BWG SPO-Nummer: 10
Zuordnung zum Curriculum: Studiengang u. –richtung Art des Moduls Studiensemester
Bachelor Flug-und Fahrzeuginfor- Pflichtmodul 1
matik
Modulverantwortliche(r): Studiengangleiter
Dozent(in): Andreas Krüger
Sprache: Deutsch
Lehrformen/SWS: Lehrformen Gruppengrößen SWS
Seminaristischer Unterricht mit 20 (Ü), 40 (SU) 4
Übung
Arbeitsaufwand: Präsenzzeit (SU, Ü): 62 h
Selbststudium (Vor- Nachbereitung der Lehrveranstaltung, Prü-
fungsvorbereitung): 88 h
Gesamt: 150 h
Leistungspunkte: 5
Empfohlene Voraussetzun- --
gen:
Angestrebte Lernergebnisse: Mit den Studierenden werden Kenntnisse der betrieblichen Funktionsbereiche
schwerpunktbezogen und anhand von Fallstudien aus der Praxis erarbeitet.
Methoden der Analyse (z. B. Netzplantechnik, mathematische Verfahren der
Optimierung sowie der Prognose) und Techniken moderner Präsentation sind
begleitend zu vermitteln.
Gründliche Klausurvorbereitung mittels Übungen, Wissenskontrollen und eines
Tests ist vorgesehen.
Inhalt: - Grundbegriffe ( Ziele, konstitutive Entscheidungen wie z. B. über Rechts-
form sowie Kooperationen, Entscheidungsregeln)
- Organisationsstrukturen und Führungsstile
- Materialwirtschaft (ABC-Analyse, Bedarfsermittlung) und Produktionswirt-
schaft (Kostentheorie, optimale Programm- und Prozessplanung)
- Instrumente der Absatzpolitik und das Marketing Mix
- Lösungsversuche zu personalwirtschaftlichen Problemen
- Grundkenntnisse der Finanzierung und der Investitionsrechnung
Studien-/ Prüfungsleistun- Schriftliche Prüfung (90 Minuten)
gen:
Medienformen: Studierende: Skript, Übungsblätter, Wissenskontrollen und Schlusstest
Dozent: Projektionen mit Beamer und Tafel
Literatur: Hans Jung: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre (Oldenburg 2010) mit Arbeits-
Übungsbuch (September 2012)
10Modulhandbuch Flug- und Fahrzeuginformatik (Bachelor) Sommersemester
2014
Grundlagen der Programmierung 2
Modulkürzel: FFI_GP2 SPO-Nummer: 3
Zuordnung zum Curriculum: Studiengang u. -richtung Art des Moduls Studiensemester
Bachelor Flug- und Fahrzeuginfor- Pflichtmodul 2
matik
Modulverantwortliche(r): Prof. Dr. Franz Regensburger
Dozent(in): Prof. Dr. Franz Regensburger (SU, Ü), Wolfgang Rößl (P)
Sprache: Deutsch
Lehrformen/SWS: Lehrformen Gruppengrößen SWS
Seminaristischer Unterricht mit 15 (P), 20 (Ü), 6
Übung und Praktikum
40 (SU)
Arbeitsaufwand: Präsenzzeit (SU, Ü): 62 h
Präsenzzeit (Praktikum): 31 h
Selbststudium (Vor- und Nachbereitung der Vorlesung, Bearbei-
tung von Übungen, Prüfungsvorbereitung): 117 h
Gesamt: 210 h
Leistungspunkte: 7
Empfohlene Voraussetzun- --
gen:
Angestrebte Lernergebnisse: − Verständnis der Grundzüge objektorientierter Programmierung
- Grundkenntnisse in der Programmiersprache Java
- Kenntnis der grundlegenden Eigenschaften und des Nutzens einer abstrak-
ten Datenstruktur
- Fähigkeit, mittelschwere Probleme logisch zu erfassen und eine algorithmi-
sche Lösung dafür zu erstellen
- Fähigkeit, vorgegebene und selbst entworfene Datenstrukturen und Algo-
rithmen in Java zu formulieren
- Fähigkeit, die Funktionen von Betriebssystemen und Entwicklungsumge-
bungen zu nutzen
Inhalt: - Java-Laufzeitumgebung
- Einführung in die objektorientierte Programmierung: Klassen, Vererbung,
Polymorphie
- Vererbung, Polymorphie
- Dynamische Datenstrukturen: verkettete Listen, Bäume
- Fortgeschrittene Sprachkonzepte: Schnittstellendefinitionen über Inter-
faces, Ausnahmenbehandlung, parametrisierte Klassen (Generics), Packa-
ges
- Bibliotheken: Ein-/Ausgabe, Collections, Threads
- Graphische Benutzeroberflächen, Umgang mit asynchronen Ereignissen
Studien-/ Prüfungsleistun- Prüfungsvorleistung: erfolgreiches Bestehen des integrierten Praktikums mit-
gen: tels Leistungsnachweis durch selbstständige Bearbeitung in Java. Die fertigen
11Modulhandbuch Flug- und Fahrzeuginformatik (Bachelor) Sommersemester
2014
Lösungen sind eizeln zur Online-Abnahme zu präsentieren, wobei auf Rückfra-
ge ggf. auch Fragen zum Lösungskonzept und zum erstellten Programm zu be-
antworten sind. Nur wenn alle fünf Aufgaben rechtzeitig vorgeführt werden,
gilt der Leistungsnachweis als erbracht;
Schriftliche Prüfung (90 Minuten)
Medienformen: Dozent: Tafel, Overhead- und Beamerprojektionen, Demonstrationen am
Rechner und an Modellen
Studierende: Skript, Übungsblätter, Aufgabenblätter, Arbeiten am Rechner und
an Modellen
Online-Auswertung, Details siehe https://intranet3.fh-
ingolstadt.de/fhi/ei/dozenten/prof-dr-thomasgrauschopf/apa
Literatur: - D. Abts: „Grundkurs JAVA“, 6. Auflage, 2010, Vieweg-Teubner, ISBN: 978-3-
8348-1277-3
- G. Krüger: „Handbuch der Java-Programmierung“, Addison-Wesley, 4. Auf-
lage (2006), http://www.javabuch.de
- B. Eckel: „Thinking in Java”, Prentice-Hall, 4. Auflage (2006),
http://www.mindview.net/Books/TIJ
- R. Schiedermeier: „Programmieren mit Java. Eine methodische Einführung“,
Pearson Studium (2005)
C. Ullenboom: „Java ist auch eine Insel", Galileo Computing, 6. Auflage
(2006), http://www.galileocomputing.de/openbook/javainsel4
12Modulhandbuch Flug- und Fahrzeuginformatik (Bachelor) Sommersemester
2014
Mathematische Grundlagen 2
Modulkürzel: FFI_MG2 SPO-Nummer: 8
Zuordnung zum Curriculum: Studiengang u. -richtung Art des Moduls Studiensemester
Bachelor Flug-und Fahrzeuginfor- Pflichtmodul 2
matik
Modulverantwortliche(r): Wolfgang Rößl
Dozent(in): Wolfgang Rößl
Sprache: Deutsch
Lehrformen/SWS: Lehrformen Gruppengrößen SWS
Seminaristischer Unterricht mit 20 (Ü), 40 (SU) 5
Übung
Arbeitsaufwand: Präsenzzeit (SU): 62 h
Präsenzzeit (Ü): 15,5 h
Selbststudium (Vor- und Nachbereitung der Lehrveranstaltung, Prü-
fungsvorbereitung): 102,5 h
Gesamt: 180 h
Leistungspunkte: 6
Empfohlene Voraussetzun- --
gen:
Angestrebte Lernergebnisse: Ziel ist es, dass die Studierenden eine gute mathematische Basis haben, damit sie
sowohl bei IT-Anwendungen (Diskrete Mathematik) als auch bei technischen An-
wendungen (Ingenieurmathematik) Probleme lösen können.
Für den Ausbau der Differential- und Integralrechnung und weitergehende nume-
rische Methoden ist dann noch Raum in der Vorlesung „Angewandte Mathema-
tik“. Dafür sollen hier (am Ende des 2. Semesters) die Grundlagen aus der Linearen
Algebra und Analysis in ausreichendem Umfang bereitstehen.
Inhalt: - Determinanten
- Eigenwerte und Eigenvektoren
- Injektive, surjektive und bijektive Abbildungen
- Ausbau der Kombinatorik
- Modulare Arithmetik mit Anwendungen
- Ausbau der Integralrechnung
- Spezielle Reihenentwicklungen
- Einführung in die Numerische Mathematik
Studien-/ Prüfungsleistun- Schriftliche Prüfung (90 Minuten)
gen:
Medienformen: Als Download aus dem Intranet: Zusammenfassungen und Ergänzungen zur Vorle-
sungsmitschrift, Aufgabenblätter (z.T. mit Lösungen)
Tafel, Overhead- und Beamerprojektionen
Literatur: - J. Erven: „Taschenbuch der Ingenieurmathematik“, München (2011)
- G. Teschl, S. Teschl: „Mathematik für Informatiker“, Bd. 1, Berlin (2008)
13Modulhandbuch Flug- und Fahrzeuginformatik (Bachelor) Sommersemester
2014
- E. Kreyszig: “Advanced Engineering Mathematics”, New York (1993)
- R. Matthes: „Algebra, Kryptologie und Kodierungstheorie“, München (2003)
14Modulhandbuch Flug- und Fahrzeuginformatik (Bachelor) Sommersemester
2014
Betriebssysteme
Modulkürzel: FFI_BS SPO-Nummer: 6
Zuordnung zum Curriculum: Studiengang u. –richtung Art des Moduls Studiensemester
Bachelor Flug-und Fahrzeuginfor- Pflichtmodul 2
matik
Modulverantwortliche(r): Prof. Dr. Ulrich Margull
Dozent(in): Prof. Dr. Ulrich Margull
Sprache: Deutsch
Lehrformen/SWS: Lehrformen Gruppengrößen SWS
Seminaristischer Unterricht mit 20 (Ü), 40 (SU) 4
Übung
Arbeitsaufwand: Präsenzzeit (SU, Ü): 62 h
Selbststudium (Vor- Nachbereitung der Lehrveranstaltung, Prü-
fungsvorbereitung): 88 h
Gesamt: 150 h
Leistungspunkte: 5
Empfohlene Voraussetzun- Grundlagen des prozeduralen Programmierens sowie der Rechnerarchitektur
gen:
Angestrebte Lernergebnisse: - Grundlegendes Verständnis der Architektur, der Konzepte und der Funkti-
onsweise moderner Betriebssysteme sowie des Zusammenspiels von Hard-
und Software bei der Ausführung von Programmen
- Entwicklung eines Verständnis für Leistungsaspekte eines Rechensystems
- Erkennen spezieller Aufgaben- und Problemsituationen
- Beschreibung der Wirkungsweise einzelner, grundlegender Rechensystem-
komponenten und zugrundeliegender Mechanismen und Strategien zur Be-
handlung der Probleme
- Anwendung der von einem Betriebssystem bereitgestellten Konzepte bei
der Lösung von Aufgaben der Prozesskooperation
Inhalt: - Einführung: Grundlegende Begriffe, Aufgaben und Strukturen von Betriebs-
systemen
- Konzepte hardwarenaher Systemprogrammierung: Unterbrechungsbehand-
lung, Kommunikation mit Geräten, Startvorgang
- Prozess- und Prozessorverwaltung: Prozess- und Thread-Konzept, Daten-
strukturen für die Verwaltung, Verwaltungsstrategien
- Prozesskooperation: Wechselseitiger Ausschluss, Synchronisation, Ver-
klemmungen (deadlocks), einfache Konzepte der Prozesskommunikation
(Shared-Memory, Signale, Sockets)
- Speicherverwaltung: Konzept des virtuellen Speichers und seine Realisie-
rung
- E/A-System: Anforderungen, Steuerung von E/A-Vorgängen, Funktion und
Aufbau von Gerätetreibern
- Dateisystem: Konzept der persistenten Datenhaltung, physikalische Organi-
sation, logische Organisation, Zugriffsverfahren, Fehlertoleranz
15Modulhandbuch Flug- und Fahrzeuginformatik (Bachelor) Sommersemester
2014
- Schutzsystem: Zugangs- und Zugriffskontrolle, Virtualisierung
Studien-/ Prüfungsleistun- Schriftliche Prüfung (90 Minuten)
gen:
Medienformen: Studierende: Skript, Übungsblätter,
Dozent: Tafelanschrieb/Foliensätze, Vorlesungsskriptum und Übungsblätter als
Download aus dem Intranet
Literatur: - S. Tanenbaum: “Modern Operating Systems”, Prentice Hall (2001);
- S. Tanenbaum; A. S. Woodhull: Operating Systems - Design and Implemen-
tation, Prentice Hall;
- W. Stallings: Operating Systems - Internals and Design Principles, Prentice
Hall.
16Modulhandbuch Flug- und Fahrzeuginformatik (Bachelor) Sommersemester
2014
Entwurf digitaler Systeme
Modulkürzel: FFI_EDS SPO-Nummern: 5
Zuordnung zum Curriculum: Studiengang u. –richtung Art des Moduls Studiensemester
Bachelor Flug-und Fahrzeuginfor- Pflichtmodul 2
matik
Modulverantwortliche(r): Prof. Dr. Andreas Hagerer
Dozent(in): Prof. Dr. Andreas Hagerer
Sprache: Deutsch
Lehrformen/SWS: Lehrformen Gruppengrößen SWS
Seminaristischer Unterricht mit 20 (Ü), 40 (SU) 4
Übung
Arbeitsaufwand: Präsenzzeit (SU, Ü): 62 h
Selbststudium (Vor- Nachbereitung der Vorlesung, Bearbeitung
von Übungen, Prüfungsvorbereitung): 88 h
Gesamt: 150 h
Leistungspunkte: 5
Empfohlene Voraussetzun- --
gen:
Angestrebte Lernergebnisse: Die Studierenden erwerben Grundkenntnisse über Aufbau, Struktur und Ar-
beitsweise kombinatorischer und sequentieller Schaltungen.
Sie können digitale Schaltungen mittels klassischer Entwurfsschritte entwerfen
und Entwürfe in der Hardwarebeschreibungssprache VHDL notieren. Sie sind
befähigt, einfache Algorithmen gemäß des FSMD-Konzepts durch digitale
Komponenten zu realisieren.
Inhalt: - Kombinatorische und sequentielle Logik
- Formulierung digitaler Schaltungen in die Hardwarebeschreibungssprache
VHDL
- Automatenmodelle
- Zeitverhalten logischer Schaltungen
- HW-Entwurf von Algorithmen mittels FSMD
Studien-/ Prüfungsleistun- Schriftliche Prüfung (90 Minuten)
gen:
Medienformen: Studierende: Skript, Übungsblätter,
Dozent: Tafelanschrieb/Foliensätze, Vorlesungsskriptum und Übungsblätter als
Download aus dem Intranet
Literatur: - K. Fricke: Lehr- und Übungsbuch für Elektrotechniker und Informatiker,
Viewegs Fachbücher der Technik, 2007.
- Thomas L. Floyd: Digital fundamentals with VHDL, Prentice Hall, 2003.
17Modulhandbuch Flug- und Fahrzeuginformatik (Bachelor) Sommersemester
2014
Englisch
Modulkürzel: FFI_ENG SPO-Nummer: 11
Zuordnung zum Curriculum: Studiengang u. –richtung Art des Moduls Studiensemester
Bachelor Flug- und Fahrzeuginfor- Pflichtmodul 2
matik
Modulverantwortliche(r): James McDonald
Dozent(in): James McDonald
Sprache: Englisch/ Deutsch
Lehrformen/SWS: Lehrformen Gruppengrößen SWS
Seminaristischer Unterricht mit 20 (Ü), 40 (SU) 4
Übung
Arbeitsaufwand: Präsenzzeit (SU, Ü): 62 h
Selbststudium (Vor- Nachbereitung der Lehrveranstaltung, Prü-
fungsvorbereitung): 88 h
Gesamt: 150 h
Leistungspunkte: 5
Empfohlene Voraussetzun- --
gen:
Angestrebte Lernergebnisse: Das Ziel dieses Kurses ist die Erweiterung des Wortschatzes insbesondere im
Bereich IT, die Verbesserung der Schreib- und Sprechfertigkeiten durch geeig-
nete Simulation und die situationsbezogene Anwendung der englischen Spra-
che. Ausgewählte grammatische Themen werden behandelt. Sicherheit in der
Sprache wird durch passive und aktive Teilnahme gefördert. Durch Diskussion
ausgewählter Fachthemen werden die Kommunikationsfähigkeit und das
Sprachgefühl verbessert
Inhalt: - Ausgewählte IT-Themen wie z.B. computer users, computer architecture,
computer applications, Operating Systems, Multimedia, networks, the
World Wide Web, webpage creator, communication systems, computing
support, data security, software engineering, people in computing, the fu-
ture of IT, electronic publishing
- Referatsthemen aus der aktuellen englischsprachigen Presse
- Übungen zu Grammatik, Semantik, Hörverstehen, Präsentation von Texten,
Einführung in die geschäftliche Korrespondenz.
Studien-/ Prüfungsleistun- Schriftliche Prüfung (90 Minuten)
gen:
Medienformen: Studierende: Handzettel
Dozent: Tafel, Overhead- und Beamerprojektionen, englischsprachige Presse
Literatur: Eric H. Glendinning, John McEwan: Oxford English for Information Technology,
2nd edition, Oxford University Press
18Modulhandbuch Flug- und Fahrzeuginformatik (Bachelor) Sommersemester
2014
2.2 Module des zweiten Studienabschnittes
2.2.1 Module beider Studienrichtungen
19Modulhandbuch Flug- und Fahrzeuginformatik (Bachelor) Sommersemester
2014
Software-Engineering
Modulkürzel: FFI_SE SPO-Nummer: 12
Zuordnung zum Curriculum: Studiengang u. –richtung Art des Moduls Studiensemester
Bachelor Flug-und Fahrzeuginfor- Pflichtmodul 3
matik
Modulverantwortliche(r): Prof. Dr. Daniel Jobst, Prof. Dr. Bernd Hafenrichter
Dozent(in): Prof. Dr. Daniel Jobst, Prof. Dr. Bernd Hafenrichter
Sprache: Deutsch
Lehrformen/SWS: Lehrformen Gruppengrößen SWS
Seminaristischer Unterricht mit 15 (P), 20 (Ü), 6
Übung und Praktikum
40 (SU)
Arbeitsaufwand: Präsenzzeit (SU, Ü): 62 h
Präsenzzeit (Praktikum): 31 h
Selbststudium (Vor- Nachbereitung der Lehrveranstaltung, Prü-
fungsvorbereitung): 117 h
Gesamt: 210 h
Leistungspunkte: 7
Empfohlene Voraussetzun- Gute Kenntnisse in Software-Entwicklung, insbesondere Java-Programmierung
gen:
Angestrebte Lernergebnisse: Die Studierenden erlernen die prinzipielle Vorgehensweise und die gegenwär-
tig eingesetzten Methoden zur Entwicklung von Software-Systemen. Der
Schwerpunkt liegt dabei auf der Entwicklung objektorientierter Software-
Systeme mit den entsprechenden Techniken für die Entwicklungsphasen Spezi-
fikation, Entwurf und Implementierung und Test.
Erworbene Kompetenzen:
- Kenntnis wesentlicher Grundbegriffe des Software Engineerings, der wich-
tigsten Vorgehensmodelle und Software-Entwicklungsprozesse sowie der
Diagrammtypen und des Aufbaus der Unified Modeling Language (UML)
- Verständnis der Motivation für die systematische Vorgehensweise bei der
Erstellung von Software sowie die Erkenntnis, warum Software-Entwicklung
schwierig ist.
- Anwendung der gelernten Methoden auf konkrete Aufgabenstellungen aus
der Praxis. Dazu gehört i.w. das Erstellen von UML-Diagrammen in der Ana-
lyse- sowie Designphase im Rahmen der Spezifikation und des Designs von
Software-Systemen.
- Analyse informeller Anforderungen für Software-Systeme und Herausarbei-
ten der für die Erstellung einer Spezifikation wesentlichen Inhalte
- Entwerfen komplexer Software-Systeme als Synthese aus der Spezifikation
und der technischen Randbedingungen (Programmiersprache, Datenbank,
technische Infrastruktur, Software-Architektur)
- Beurteilung der Qualität von Software-Systemen anhand von Software-
Qualitätsmerkmalen
- Vertiefende Anwendung der in der Vorlesung behandelten Methoden zur
20Modulhandbuch Flug- und Fahrzeuginformatik (Bachelor) Sommersemester
2014
Entwicklung eines Software-Systems gemäß dem Wasserfall-Modell
- Anhand informell vorgegebener Anforderungen ist ein für die Studierenden
bis dato fachlich unbekannte Anwendung zur Einschreibung für Wahl-
pflichtfächer zu entwickeln. Die in der Vorlesung lediglich theoretisch be-
handelten Phasen Spezifikation, Design, Implementierung und Test werden
dabei durchlaufen und führen jeweils zu entsprechenden Ergebnisdoku-
menten
Inhalt: - Grundlagen: Begriffe, UML, Konzepte der Objektorientierung
- Phasen der Software-Entwicklung, iterative und inkrementelle Entwicklung,
Software-Entwicklungsprozesse
- Konzeptionsphase: Grobkonzept, Geschäftsprozessmodellierung, Fachfein-
konzept (Use Case-Spezifikation)
- Design und Implementierung
- Qualitätssicherung und Test
Realisierung eines „Mini“-Projekts:
- Erstellung einer Use Case-Spezifikation
- Entwicklung und Beschreibung der Architektur
- Realisierung der wesentlichen Use Cases (Anwendungsfälle)
- Spezifikation und Durchführung von Testfällen
Studien-/ Prüfungsleistun- Prüfungsvorleistung: erfolgreiches Bestehen des integrierten Praktikums mit-
gen: tels praktischem Leistungsnachweis mit Übungstestaten;
Schriftliche Prüfung (90 Minuten)
Medienformen: Studierende: Skript, Arbeiten am Rechner
Dozent: Tafel, Beamerprojektionen, Demonstrationen am Rechner
Literatur: - H. Balzert: „Lehrbuch der Software-Technik“ (Band 1 und 2), Spektrum Ver-
lag (2000)
- Heide Balzert; Lehrbuch der Objektmodellierung. Analyse und Entwurf,
Spektrum Akademischer Verlag, 1999
- Objektorientierte Softwaretechnik; Bernd Brügge, Allen Dutoit; Prentice
Hall; Pearson Studium; 2004
- UML 2 für Studenten; Harald Störrle; Pearson Studium; 2005
21Modulhandbuch Flug- und Fahrzeuginformatik (Bachelor) Sommersemester
2014
Microcomputertechnik
Modulkürzel: FFI_MC SPO-Nummern: 14
Zuordnung zum Curriculum: Studiengang u. –richtung Art des Moduls Studiensemester
Bachelor Flug-und Fahrzeuginfor- Pflichtmodul 3
matik
Modulverantwortliche(r): Prof. Dr. Ulrich Margull
Dozent(in): Prof. Dr. Ulrich Margull
Sprache: Deutsch
Lehrformen/SWS: Lehrformen Gruppengrößen SWS
Seminaristischer Unterricht mit 15 (P), 20 (Ü), 40 6
Übung und Praktikum (SU)
Arbeitsaufwand: Präsenzzeit (SU, Ü): 62 h
Präsenzzeit (P): 31 h
Selbststudium (Vor- und Nachbereitung der Lehrveranstaltung,
Prüfungsvorbereitung): 117 h
Gesamt: 210 h
Leistungspunkte: 7
Empfohlene Voraussetzun- Vorlesung und Praktikum Grundlagen der Programmierung
gen:
Vorlesung Rechnerarchitektur
Vorlesung und Praktikum Digitaltechnik
Vorlesung Physikalische und elektrotechnische Grundlagen
Angestrebte Lernergebnisse: Die Studierenden besitzen fundierte Kenntnis über Aufbau und Leistungsfähig-
keit von Mikrocomputersystemen und und ihre Programmierung. Sie verste-
hen das Zusammenwirken von Hardware und Software. Sie verfügen über die
Fähigkeit, auf Basis von Standardschaltungen anwendungsspezifische Mikro-
computer zu entwerfen und hardwarenah zu programmieren.
Inhalt: Der seminaristische Unterricht behandelt:
- Architektur von Mikrocomputersystemen
- Aufbau von Mikroprozessoren und Mikrocontrollern
- Architektur von Steuergeräteprogrammen (Hauptschleife, Unterbre-
chungsmodus)
- Peripheriemodule von Mikrocontrollern (Ports, Timer, serielle Kommunika-
tionsmodule, Analog-Digital Wandler)
- Busse und Systemstrukturen, Anbindung von Speicherbausteinen an Mikro-
controller
- Programmierung von Mikrocontrollern, hardwarenahes C, effiziente Pro-
grammstrukturen, Besonderheiten im Maschinenbefehlssatz und in der Be-
fehlsabarbeitung von Mikrocontrollern
Im Praktikum wird mit Hilfe einer integrierten Entwicklungsumgebung ein Pro-
gramm für ein Mikrocontrollersystem entwickeln und getestet, so dass sich
22Modulhandbuch Flug- und Fahrzeuginformatik (Bachelor) Sommersemester
2014
folgender Funktionsumfang ergibt:
- Portansteuerung zum Einlesen einer Matrixtastatur
- Interrupt- und Timerprogrammierung für Frequenz- und Zeitmessung
- Treiberprogrammierung für ein Display und Ausgabe von Statusmeldungen
- Treiberprogrammierung für serielle Kommunikation über LIN- und CAN-Bus
mit einem Master
- Treiberprogrammierung für serielle Kommunikation über Ethernet
- Analog-Digitalwandlung und Pulsweitenmodulation zum Steuern und Re-
geln eines elektromechanischen Aktuators.
Studien-/ Prüfungsleistun- Prüfungsvorleistung: Erfolgreiches Bestehen des integrierten Praktikums mit-
gen: tels praktischen Leistungsnachweises, welcher aus der Bearbeitung von 7-10
Praktikumsversuchen besteht
Schriftliche Prüfung (120 Minuten)
Medienformen: Studierende: Skript, Übungs- und Aufgabenblätter, Simulationen am Rechner,
Versuchsanleitung, Arbeiten am Rechner mit Versuchsaufbau, Programmieren
und Testen mit Simulator und In-Circuit Emulator, Messen mit Oszilloskop und
Logikanalysator
Dozent: Tafel, Overhead- und Beamerprojektionen, Demonstrationen bzw. Si-
mulationen am Rechner
Literatur: - Flik, Thomas:Mikroprozessortechnik und Rechnerstrukturen, Rechnerarchi-
tekturen; Springer Verlag
- Bähring, Helmut: Mikrorechnertechnik I+II; Springer Verlag
- Gaul, L.: Einführung zum Mikrocomputertechnik-Praktikum, Versuchsauf-
bau und Projektbeschreibung
- Datenblätter zum Mikrocontroller des Versuchsaufbaus
23Modulhandbuch Flug- und Fahrzeuginformatik (Bachelor) Sommersemester
2014
Angewandte Mathematik
Modulkürzel: FFI_AM SPO-Nummer: 20
Zuordnung zum Curriculum: Studiengang u. -richtung Art des Moduls Studiensemester
Bachelor Flug- und Fahrzeuginfor- Pflichtmodul 3
matik
Modulverantwortliche(r): Prof. Dr. Hans von Koch
Dozent(in): Prof. Dr. Hans von Koch
Sprache: Deutsch
Lehrformen/SWS: Lehrformen Gruppengrößen SWS
Seminaristischer Unterricht mit 20 (Ü), 40 (SU) 4
Übung
Arbeitsaufwand: Präsenzzeit (SU, Ü): 62 h
Selbststudium (Vor- und Nachbereitung der Lehrveranstaltung,
Prüfungsvorbereitung): 88 h
Gesamt: 150 h
Leistungspunkte: 5
Empfohlene Voraussetzun- --
gen:
Angestrebte Lernergebnisse: - Gründliche Kenntnis und vertieftes Verständnis einiger für die numerische
Mathematik relevanter Verfahren
- Fähigkeit, sie auf konkrete Probleme anzuwenden
Inhalt: - Einführung in die Graphentheorie
- Quellcodierung, Einführung in die Informationstheorie
- Banachscher Fixpunktsatz mit Anwendungen
- Interpolation
- Ausgleichsrechnung
- Gewöhnliche Differentialgleichungen, Runge-Kutta-Verfahren
Studien-/ Prüfungsleistun- Schriftliche Prüfung (90 Minuten)
gen:
Medienformen: Als Download aus dem Intranet: Zusammenfassungen und Ergänzungen zur
Vorlesungsmitschrift, Aufgabenblätter (z.T. mit Lösungen)
Tafel, Overhead- und Beamerprojektionen
Literatur: - R. Matthes: „Algebra, Kryptologie und Kodierungstheorie“, München, Wien
(2003)
- T. Ihringer: „Diskrete Mathematik“, Stuttgart (1994)
- E. Kreyszig: “Advanced Engineering Mathematics”, New York (1993)
24Modulhandbuch Flug- und Fahrzeuginformatik (Bachelor) Sommersemester
2014
Rechnernetze
Modulkürzel: FFI_RN SPO-Nummer: 15
Zuordnung zum Curriculum: Studiengang u. -richtung Art des Moduls Studiensemester
Bachelor Flug-und Fahrzeuginfor- Pflichtmodul 3
matik
Modulverantwortliche(r): Prof. Dr. Ulrich Margull
Dozent(in): Prof. Dr. Ulrich Margull, Prof. Dr. Ernst-Heinrich Göldner, Prof. Dr. Inge Weigel
Sprache: Deutsch
Lehrformen/SWS: Lehrformen Gruppengrößen SWS
Seminaristischer Unterricht mit 15 (P), 20 (Ü), 6
Übung und Praktikum
40 (SU)
Arbeitsaufwand: Präsenzzeit (SU, Ü): 62 h
Präsenzzeit (Praktikum): 31 h
Selbststudium (Vor- und Nachbereitung der Lehrveranstaltung,
Prüfungsvorbereitung): 117 h
Gesamt: 210 h
Leistungspunkte: 7
Empfohlene Voraussetzun- Rechnerarchitektur, Entwurf digitaler Systeme
gen:
Angestrebte Lernergebnisse: - Die Studierenden kennen die einschlägige Begriffswelt der Rechnernetze.
- Sie kennen die grundlegenden Konzepte der Rechnerkommunikation und
verstehen die gängigen Kommunikationsprotokolle des Internets.
- Sie können typische Sicherungsverfahren und Routingalgorithmen anwen-
den und IP-Adressräume nach Vorgabe berechnen bzw. vergeben.
- Sie verstehen das Funktionsprinzip von Client/Server-Protokollen und kön-
nen einfache TCP/IP-Anwendungsprotokolle selbst konzipieren.
- Mit dem erworbenen Verständnis der grundlegenden Konzepte von Rech-
nernetzen sind die Studierenden sowohl befähigt, sich selbständig vertie-
fende Spezialkenntnisse anzueignen, als auch vorbereitet, aufbauende
Lehrveranstaltungen aus dem fachwissenschaftlichen Wahlpflichtfachkata-
log zu besuchen.
- Durch eigene praktische Anwendung haben die Studierenden gelernt, mit-
hilfe eines verbreiteten Werkzeugs zur Protokollanalyse Kommunikations-
vorgänge und typische Problemstellungen beim Aufbau von Netzwerken zu
analysieren und Methoden zur Fehlerdiagnose anzuwenden.
- Sie können gebräuchliche Netzwerkkomponenten konfigurieren und über
unterschiedliche Medien zusammenschließen sowie geeignete Netzwerk-
konfigurationen und -strukturen abhängig von spezifischen Anforderungen
auswählen.
Inhalt: Seminaristischer Unterricht
- Geschichte, Klassifikation, Schichtenmodell
- Bitübertragungsschicht, Leitungscodierung, Übertragungsmedien
25Modulhandbuch Flug- und Fahrzeuginformatik (Bachelor) Sommersemester
2014
- Sicherungsschicht, CRC, ARQ, Sliding Window, PPP, CSMA/CD, Ethernet,
WLAN
- Vermittlungsschicht, Shortest Path Algorithmus, Distance Vector Routing,
Link State Routing, IP-Adressen, CIDR, ARP, IP, ICMP, Multicasting, IGMP
- Transportschicht, TCP, UDP
- Anwendungsschicht, DHCP, DNS, FTP, SMTP, HTTP und andere
Praktikum
- Programmieraufgaben im Protokollstapel eines simulierten Rechner-
netzwerks (z. B. Bitstuffing, CRC-Prüfsummenbildung, Ethernet Kollisions-
behandlung, kürzeste Wegesuche, Link State Routing, Multicasting, Senden
von Transportsegmenten, Email-Verteiler u. a.)
- Übungen im Labor zum Aufbau eines lokalen Netzwerks und zum Konfigu-
rieren verschiedener Netzkomponenten, VLANs, Routing-Algorithmen (STP,
RIP)
- Untersuchung grundlegender Eigenschaften und Konfigurationsparameter
von Kommunikationsprotokollen und Verifikation mittels Protokollanalyse
Studien-/ Prüfungsleistun- Prüfungsvorleistung: erfolgreiches Bestehen des integrierten Praktikums durch
gen: Bearbeitung von 6-10 praktischen Versuchen;
Schriftliche Prüfung (120 Minuten)
Medienformen: Studierende: Vorlesungsskriptum, Aufgabenblätter
Dozent: hauptsächlich Tafel, gelegentlich Overhead- und Beamerprojektionen
Literatur: - A. S. Tanenbaum: “Computer Networks”, 4th Edition, Pearson Education
(2003)
- G. Krüger, D. Reschke (Hrsg.): Lehr- und Übungsbuch Telematik – Netze,
Dienste, Protokolle, 3. Auflage, Hanser (2004)
- http://www.ietf.org/rfc.html
- J. M. Pullen: “Understanding Internet Protocols Through Hands-On Pro-
gramming”, Wiley (2000)
26Modulhandbuch Flug- und Fahrzeuginformatik (Bachelor) Sommersemester
2014
Modellierung und Simulation dynamischer Systeme
Modulkürzel: FFI_MSDS SPO-Nummern: 13
Zuordnung zum Curriculum: Studiengang u. -richtung Art des Moduls Studiensemester
Bachelor Flug-und Fahrzeuginfor- Pflichtmodul 4
matik
Modulverantwortliche(r): Prof. Dr. Thomas Schiele
Dozent(in): Prof. Dr. Thomas Schiele
Sprache: Deutsch
Lehrformen/SWS: Lehrformen Gruppengrößen SWS
Seminaristischer Unterricht mit 20 (Ü), 40 (SU) 4
Übung
Arbeitsaufwand: Präsenzzeit (SU, Ü): 62 h
Selbststudium (Vor- und Nachbereitung der Lehrveranstaltung,
Prüfungsvorbereitung): 88 h
Gesamt: 150 h
Leistungspunkte: 5
Empfohlene Voraussetzun- Die Teilnahme am Praktikum „Modellierung und Simulation dynamischer Sys-
gen: teme“
Angestrebte Lernergebnisse: - Kenntnis von Matlab/ Simulink/ Stateflow
- Verständnis numerischer Lösungsverfahren und der damit verbundenen
Einstellmöglichkeiten (Schrittweite, Genauigkeit, Integrationsverfahren)
- Verständnis der Grenzen numerischer Lösungsverfahren
- Befähigung, geeignete Einstellungen für ein entworfenes Simulationsmo-
dell zu wählen und Steuerung via Skripten
- sinnvolles Strukturieren von Simulationsmodellen
- Modell-Verifikation und Validation
- Formulieren von Differentialgleichungssystemen in Simulationsmodellen
- Verständnis der Grenzen einer Modellierung
Inhalt: - Matlab/ Simulink/ Stateflow
- Lineare Gleichungssysteme
- Nichtlineare Probleme
- Dynamische Probleme
- Numerische Verfahren (Runge-Kutta, Euler etc.)
- Möglichkeiten der Validierung und Verifizierung
- Anwenden/ Umsetzen der verschiedenen Inhalte und (Modellierungs-
)Verfahren der Vorlesung in Matlab/ Simulink
- Typische Fehler und zugehörige Fehlermeldungen
Studien-/ Prüfungsleistun- Schriftliche Prüfung (90 Minuten)
gen:
Medienformen: Studierende: Skript, Übungsblätter, Aufgabenblätter, Arbeiten am Rechner und
27Modulhandbuch Flug- und Fahrzeuginformatik (Bachelor) Sommersemester
2014
an Modellen
Dozent: Tafel, Overhead- und Beamerprojektionen, Demonstrationen am
Rechner und an Modellen (Beamer)
Literatur: - MATLAB Simulink-Stateflow, ISBN 978-3-486-58985-6;
- MATLAB Kompakt, ISBN 978-3-486-59193-4
28Modulhandbuch Flug- und Fahrzeuginformatik (Bachelor) Sommersemester
2014
Eingebettete Systeme und Echtzeitsysteme
Modulkürzel: FFI_ES SPO-Nummer: 16
Zuordnung zum Curriculum: Studiengang u. –richtung Art des Moduls Studiensemester
Bachelor Flug- und Fahrzeuginfor- Pflichtmoduls 4
matik
Modulverantwortliche(r): Prof. Dr. Ulrich Margull
Dozent(in): Prof. Dr. Ulrich Margull
Sprache: Deutsch
Lehrformen/SWS: Lehrformen Gruppengrößen SWS
Seminaristischer Unterricht mit 20 (Ü), 40 (SU) 4
Übung
Arbeitsaufwand: Präsenzzeit (SU, Ü): 62 h
Selbststudium (Vor- Nachbereitung der Lehrveranstaltung, Prü-
fungsvorbereitung): 88 h
Gesamt: 150 h
Leistungspunkte: 5
Empfohlene Voraussetzun- --
gen:
Angestrebte Lernergebnisse: Die Studierenden sollen die grundlegenden Eigenschaften eingebetteter Sys-
teme mit Echtzeitanforderungen kennenlernen. Kenntnis der Methoden, um
zeitlich deterministische Systeme zu planen, deren Verhalten nachzuweisen
und zu implementieren.
Die Studierenden beherrschen ein methodisches Handeln zur Planung, Imple-
mentierung und Verifikation von eingebetteten Systemen mit Echtzeitanforde-
rungen. Die Kenntnis der wichtigen Voraussetzungen und Verfahren, um zeit-
lich deterministische Systeme zu realisieren versetzen die Studierenden in die
Lage, bei Anwendungsproblemen adäquate Hardware und Betriebs- und Bus-
systeme einzusetzen.
Inhalt: - Einführung: Grundbegriffe, Merkmale eingebetteter Systeme und Echtzeit-
systeme, Entwurfsprozess für eingebettete Systeme
- Scheduling: Grundbegriffe, Schedulingalgorithmen, Ressourcenzugriffe,
Echtzeitbetriebssysteme
- Hardware eingebetteter Systeme: Mikrocontroller, Speicher und Periphe-
rie, Kommunikation
- Spezifikationssprachen für eingebettete Systeme: Überblick, allgemeine
Spracheigenschaften und Anforderungen, Zustandsdiagramme, Petri-Netze,
Taskgraphen
- Programmierung eingebetteter Systeme: Programmiersprachen, synchro-
ner Ansatz und Esterel
Studien-/ Prüfungsleistun- Schriftliche Prüfung (90 Minuten)
gen:
Medienformen: Studierende: Skript, Aufgabenblätter, Arbeiten am Rechner
Dozent: Tafel, Overhead- und Beamerprojektionen, Demonstrationen am
Rechner
29Modulhandbuch Flug- und Fahrzeuginformatik (Bachelor) Sommersemester
2014
Literatur: - Baumgarten, B. 1996. Petri-Netze: Grundlagen und Anwendungen. Spekt-
rum Akademischer Verlag, 2. Aufl.
- Kopetz, H. 1997. 2011. Real-time systems: Design principles for distributed
embedded applications. Springer, 2. Aufl.
- Mandl, P. 2010. Grundkurs Betriebssysteme: Architekturen, Betriebsmittel-
verwaltung, Synchronisation, Prozesskommunikation. Vieweg+Teubner, 2.
Aufl.
- Marwedel, P. 2008. Eingebettete Systeme. Springer.
- Scholz, P. 2005. Software-Entwicklung eingebetteter Systeme: Grundlagen,
Modellierung, Qualitätssicherung. Springer.
- Wörn, H. und U. Brinkschulte. 2005. Echtzeitsysteme: Grundlagen, Funkti-
onsweisen, Anwendungen. Springer.
30Modulhandbuch Flug- und Fahrzeuginformatik (Bachelor) Sommersemester
2014
Regelungstechnik
Modulkürzel: FFI_RT SPO-Nummern: 21
Zuordnung zum Curriculum: Studiengang u. –richtung Art des Moduls Studiensemester
Bachelor Flug- und Fahrzeuginfor- Pflichtmodul 4
matik
Modulverantwortliche(r): Prof. Dr. Rudolf Gregor
Dozent(in): Prof. Dr. Rudolf Gregor
Sprache: Deutsch
Lehrformen/SWS: Lehrformen Gruppengrößen SWS
Seminaristischer Unterricht mit 15 (P), 20 (Ü), 6
Übung und Praktikum
40 (SU)
Arbeitsaufwand: Präsenzzeit (SU, Ü): 62 h
Präsenzzeit (Praktikum): 31 h
Selbststudium (Vor- Nachbereitung der Lehrveranstaltung, Prü-
fungsvorbereitung): 87 h
Gesamt: 180 h
Leistungspunkte: 6
Empfohlene Voraussetzun- Mathematische Grundlagen, Physikalische und elektrotechnische
gen:
Grundlagen, Grundlagen der Programmierung
Angestrebte Lernergebnisse: - Kenntnis und Verständnis von Beschreibungs- und Entwurfsmethoden
technischer Regelungs- und Automatisierungssysteme.
- Anwendung dieser Kenntnisse zum Aufbau von Automatisierungssystemen
und zum Entwurf von Regeleinrichtungen.
- Beurteilung von Regelkreisen hinsichtlich Stabilität und Dynamik.
Inhalt: - Modellbildung
- Systembeschreibung und –darstellung im Zeit- und Frequenzbereich
- elementare Regelkreisglieder
- Regelkreise: Anforderungen, Verhalten, Auslegung
- Reglersynthese: Wurzelortskurve / Bode-Diagramm / empirisch
- Mehrgrößenregelung, Reglerauslegung im Zustandsraum
- digitale Realisierung von Regelalgorithmen
- Prozesssteuerung und –regelung
- Programmierung von mobilen und stationären Robotern
- Temperaturregelung (PID)
- Modellierung einer E-Gas-Drosselklappe
- Positionsregelung einer E-Gas-Drosselklappe mit Hilfe eines Mikrocontrol-
lers
Studien-/ Prüfungsleistun- Prüfungsvorleistung: erfolgreiches Bestehen des integrierten Praktikums mit-
gen: tels erfolgreicher Durchführung und Protokollierung der Versuche;
31Modulhandbuch Flug- und Fahrzeuginformatik (Bachelor) Sommersemester
2014
Schriftliche Prüfung (90 Minuten)
Medienformen: Studierende: Hilfsblätter zur Vorlesung, Arbeiten am Rechner im PC-Labor,
Versuchsbeschreibungen
Dozent: Tafel, Overhead- und Beamerprojektionen, Demonstrationen am
Rechner und anhand von Anschauungsobjekten bzw. Versuchsaufbauten
Literatur: - O. Föllinger: Regelungstechnik. Hüthig Verlag, Heidelberg, 1994,
ISBN 3-7785-2336-8
- H. Unbehauen: Regelungstechnik I. Vieweg Verlag, Braunschweig,
1997, ISBN 3-528-83332-7
- Mann, Schiffelgen, Froriep: Einführung in die Regelungstechnik.
Hanser Verlag, München, 2000, ISBN 3-446-21516-6
- G. Schulz: Regelungstechnik 1. Oldenbourg Verlag München,
2007.ISBN 978-3-486-58317-5
- G. Schulz: Regelungstechnik 2. Oldenbourg Verlag München, 2008.
ISBN 978-3-486-58318-2
- H.-J. Gevatter: Handbuch der Meß- und Automatisierungstechnik.
Springer-Verlag, Berlin, 1999, ISBN 3-540-59135-4
- J. Bergmann: Automatisierungs- und Prozeßleittechnik. Fachbuch-
verlag Leipzig, 1999, ISBN 3-446-19569-6
32Modulhandbuch Flug- und Fahrzeuginformatik (Bachelor) Sommersemester
2014
Fachwissenschaftliches Seminar
Modulkürzel: FFI_SEM SPO-Nummern: 29
Zuordnung zum Curriculum: Studiengang u. –richtung Art des Moduls Studiensemester
Bachelor Flug- und Fahrzeuginfor- Pflichtmodul 4
matik
Modulverantwortliche(r): Studiengangleiter
Dozent(in): Wechselnde Dozenten
Sprache: Deutsch
Lehrformen/SWS: Lehrformen Gruppengrößen SWS
Seminar 12 2
Arbeitsaufwand: Präsenzzeit (S): 31 h
Selbststudium (Vor- Nachbereitung der Lehrveranstaltung, Prü-
fungsvorbereitung): 59 h
Gesamt: 90 h
Leistungspunkte: 3
Empfohlene Voraussetzun- --
gen:
Angestrebte Lernergebnisse: Die Studierenden besitzen die Fähigkeit, sich selbständig spezielle fachliche
Kenntnisse zu erarbeiten (Literaturarbeit, Analyse, Schlussfolgerungen) und
diese mithilfe des Einsatzes geeigneter Medien nachvollziehbar zu präsentie-
ren. Sie sind gleichermaßen in der Lage, einer fachlichen Präsentation kritisch
zu folgen und die Inhalte mit dem Vortragenden fachlich zu diskutieren (Stär-
kung der kommunikativen Kompetenz).
Inhalt: Das fachliche Thema des Seminars wechselt von Kurs zu Kurs. Gegenstand ist
zumeist ein studiengangspezifisches Gebiet, zu dem es geeignete Fachliteratur
gibt, die zugleich die Basisliteratur für die Vorträge darstellt.
Studien-/ Prüfungsleistun- Seminararbeit mit Präsentation
gen:
Medienformen: Studierende: Seminararbeit, Tafel, Overhead- und Beamerprojektionen
Dozent: Tafel, Overhead- und Beamerprojektionen
Literatur: --
33Modulhandbuch Flug- und Fahrzeuginformatik (Bachelor) Sommersemester
2014
Vorbereitendes Praxisseminar
Modulkürzel: FFI_PLV1 SPO-Nummern: 33
Zuordnung zum Curriculum: Studiengang u. -richtung Art des Moduls Studiensemester
Bachelor Flug- und Fahrzeuginfor-
matik Pflichtmodul 4
Modulverantwortliche(r): Prof. Dr. Ernst-Heinrich Göldner
Dozent(in): Prof. Dr. Ernst-Heinrich Göldner
Sprache: Deutsch
Lehrformen/SWS: Lehrformen Gruppengrößen SWS
Seminar 10-15 1
Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 15,5 h
Selbststudium (Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung): 44,5 h
Gesamt: 60 h
Leistungspunkte: 2
Empfohlene Voraussetzun- --
gen:
Angestrebte Lernergebnisse: Die Studierenden sind auf typische Situationen des beruflichen Miteinanders
vorbereitet (soziale Kompetenz). Ihre Kommunikations- und Teamfähigkeit sind
verbessert und sie haben grundlegende Erfahrungen im Umgang mit kritischen
Situationen und Konflikten.
Inhalt: - Einschätzung von Persönlichkeitsprofilen
- Umgang mit verschiedenen (Konflikt-) Situationen des beruflichen Mitei-
nanders im Rahmen von Gruppenübungen und Rollenspielen
Studien-/ Prüfungsleistun- Aktive Teilnahme an Diskussionen, Gruppenübungen, Rollenspielen
gen:
Medienformen: Studierende: Handzettel
Dozent: Beamerprojektionen, Tafel, Flipchart
Literatur: --
34Sie können auch lesen