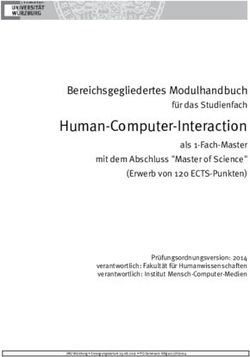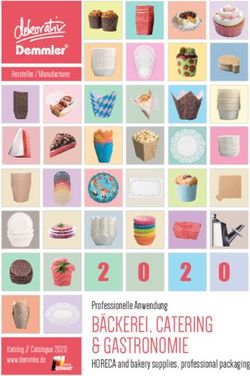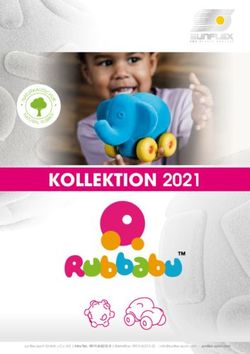Bebauungsplan Nr. 71.47 "Franklin Mitte" der Stadt Mannheim - Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Bebauungsplan Nr. 71.47 "Franklin Mitte" der Stadt Mannheim Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Mannheim, den 07.12.2015, fortgeschrieben am 30.06.2017 und am 19.03.2020 Aktenzeichen: 14036-10
Allgemeine Projektangaben
Auftraggeber: MWS Projektentwicklungsgesell- Leoniweg 2
schaft mbH 68167 Mannheim
Auftragnehmer: Baader Konzept GmbH N7, 5-6
www.baaderkonzept.de 68161 Mannheim
Projektleitung: Dipl. Geogr. Dr. M. Gonser
Projektbearbeitung: M. Sc. Landschaftsökol. Jan Distel
Dipl.-Biol. Franziska Grischkat
Dipl. Biol. Klaus Herden
M.Sc Biol. Sabrina Hoffmann
Dipl. Landschaftsökol. C. Holzmann
Dipl. Geoökol. Christian Jones
Dipl.-Ing. Landschafts- und Freiraumplanung A. König
M.Sc. Geographie J. Wittemaier
M.Sc. Biologie A. Krommrei
M.Sc. Umweltplanung und Ingenieurökologie Laura Matthäus
Dipl. Biol. R. Nagel
Dipl. Min. Dr. S. Panienka
GIS: Dipl.-Geoökologe C. Jones
Datei: 200319_B-Plan_ 71.47_saP
Datum: Mannheim, den 07. Dezember 2015, fortgeschrieben am 18. Juli 2017 und
am 19.03.2020
Aktenzeichen: 14036-10Inhaltsverzeichnis
1 Anlass und Aufgabenstellung ........................................................................ 1
2 Methodisches Vorgehen ................................................................................ 2
2.1 Gesetzliche Vorgaben 2
2.2 Datengrundlage 3
2.3 Abschichtung relevanter Arten 3
3 Vorhabenbeschreibung und Projektwirkungen ............................................... 4
3.1 Vorhabenbeschreibung 4
3.2 Projektwirkungen 5
3.2.1 Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 5
3.2.2 Anlagenbedingte Wirkprozesse 5
3.2.3 Betriebsbedingte Wirkprozesse 6
4 Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten ..................................... 7
4.1 Fledermäuse 7
4.1.1 Nachweismethode 7
4.1.2 Ergebnisse 8
4.1.2.1 Detektorkartierung 8
4.1.2.2 Stationäre Rufdatenlogger 9
4.1.2.3 Baumhöhlen 10
4.1.2.4 Kontrolle der Gebäude auf Winterquartiereignung 10
4.1.3 Nachgewiesene Arten 11
4.1.4 Betroffenheit 11
4.2 Säugetiere ohne Fledermäuse 18
4.2.1 Vorkommen 18
4.2.2 Betroffenheit 19
4.3 Reptilien 19
4.3.1 Vorkommen 20
4.3.2 Betroffenheit 22
4.4 Amphibien 25
4.4.1 Vorkommen 25
4.4.2 Betroffenheit 25
4.5 Brutvögel 25
4.5.1 Betroffenheit 28
4.6 Tagfalter 45
4.6.1 Vorkommen 45
4.7 Erweiterter Geltungsbereich 3. Offenlage 485 Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der
kontinuierlichen ökologischen Funktionalität ................................................ 49
5.1 Maßnahmen zur Vermeidung 49
5.2 Vorgezogene Maßnahmen zur Sicherung der
kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-
Maßnahmen) 50
5.2.1 Fledermäuse und gehölzbrütende Vogelarten 50
5.2.2 Gebäudebrütende Vogelarten 51
5.3 Monitoring und Risikomanagement 52
6 Gutachterliches Fazit .................................................................................. 53
Literaturverzeichnis .......................................................................................... 54
Anlagenverzeichnis
Anlage 1: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag - Bestandskarte Fauna
Anlage 2: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag - CEF - Maßnahmen
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Während der Detektorkartierungen erfassten Arten
und Anzahl an erfassten Rufsequenzen. 8
Tabelle 2: Während des 14-tägigen Aufnahmeblocks erfasste
Rufsequenzen. 9
Tabelle 3: Schutz- und Gefährdungsstatus der nachgewiesenen
Fledermausarten 11
Tabelle 4: Schutz- und Gefährdungsstatus der vorkommenden
Reptilienart. 20
Tabelle 5: Nachgewiesene Vogelarten Teilbereich 3 26
Tabelle 6: Mehlschwalbennester im Teilbereich 3 27
Tabelle 7: Kartiertermine und Kartierbedingungen Tagfalter 46
Tabelle 8: Im Untersuchungsgebiet vorkommende Tagfalter
mit Häufigkeiten 47Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Verortung der Zauneidechsennachweise im
Teilgebiet 3. 21
Abbildung 2: Hütten als Unterschlupfmöglichkeit für
hinterlassene Katzen. 22
Abbildung 3: Paarung des Hauhechelbläulings im
Untersuchungsgebiet 3 48BEBAUUNGSPLAN NR. 71.47 „FRANKLIN MITTE“
1 Anlass und Aufgabenstellung
Bei dem Areal Benjamin Franklin Village handelt es sich um die größte ehemalige Wohnsied-
lung der U.S. Streitkräfte im Bundesgebiet mit ehemals 8.000 Einwohnern und einer Fläche
von insgesamt rd. 144 ha. Geplant ist die Überführung der Siedlung in eine zivile Nachnut-
zung.
Im Rahmen des umweltfachlichen Genehmigungsverfahrens hat die MWS Projektentwick-
lungsgesellschaft mbH die Baader Konzept GmbH beauftragt, eine flächendeckende Kartierung
Fauna/Flora inkl. eines entsprechenden Artenschutzfachbeitrages für die Konversionsliegen-
schaften Benjamin-Franklin-Village (BFV), Funari- und Sullivan-Barracks vorzunehmen.
Für das Areal BFV ist im Zusammenhang mit dem anstehenden B-Planverfahren aus terminli-
chen Gründen ein gesonderter und vorgezogener Fachbeitrag zu erstellen. Der vorliegende
Artenschutzfachbeitrag bezieht sich ausschließlich auf den Teilbereich 3 (Benjamin-Franklin-
Village).
Im Rahmen der dritten Offenlage wurde der Geltungsbereich des Bebauungsplans im Südwes-
ten um den Verkehrsknoten Wasserwerkstraße/ Waldstraße sowie geringfügig im Süden im
Bereich der Birkenauer Straße erweitert. Die hinzugekommenen Flächen werden im vorlie-
genden Fachbeitrag ebenfalls einer artenschutzrechtlichen Prüfung unterzogen.
Zudem wird das Quartierszentrum im zentralen Bereich des Plangebiets ausgespart, da eine
konkrete Planung erst im späteren Verlauf des Verfahrens vorgesehen ist. Der vorliegende Ar-
tenschutzfachbeitrag schließt diesen Bereich dennoch mit ein.
Im Fachbeitrag Artenschutz wird geprüft, ob für die in der speziellen artenschutzrechtlichen
Prüfung nach § 44 BNatSchG relevanten Arten artenschutzrechtliche Verbote zutreffen, d.h.
vom Vorhaben ausgelöst werden.
Die grundsätzliche Vorgehensweise für die Erstellung eines artenschutzrechtlichen Fachbei-
trages setzt sich aus folgenden Arbeitsschritten zusammen:
a) Erstbegehung des Untersuchungsraumes inkl. naturschutzfachlicher Potentialabschät-
zung, Zusammentragen artenschutzrelevanter Bestandsdaten, Datengewinnung vor
Ort,
b) Beurteilung der zu erwartenden Auswirkungen des Vorhabens auf artenschutz-
rechtlich relevante Arten gem. § 44 BNatSchG,
c) Ableitung geeigneter Maßnahmen zur Konfliktvermeidung oder zur Wahrung der kon-
tinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen).
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 1BEBAUUNGSPLAN NR. 71.47 „FRANKLIN MITTE“ 2 Methodisches Vorgehen 2.1 Gesetzliche Vorgaben Bei Vorhaben, die der Eingriffsregelung unterliegen, sind gemäß § 44 (5) BNatSchG nur die Europäische Vogelarten gem. Art. 1 Richtlinie 79/409/EWG („Vogelschutzrichtlinie“) und Arten des Anhangs IV der RL 92/43 EWG („FFH-Richtlinie“) relevant. Andere, nur nationalgeschützte, Arten sind ggf. im Rahmen der Eingriffsregelung zu berücksichtigen. Die Rechtsverordnung nach § 54 BNatSchG, die weitere, in der speziellen Artenschutzprüfung nach § 44 BNatSchG artenschutzrechtlich zu prüfenden Arten auflistet, liegt z. Zt. noch nicht vor. Für die relevanten Arten ergeben sich aus § 44 (1) Nr. 1 bis 3 in Verbindung mit (5) BNatSchG (2010) für nach § 15 BNatSchG (2010) zulässige Eingriffe folgende Verbotstatbestände: Tötungsverbot: Nach § 44 (1) Nr.1 BNatSchG ist es verboten, wildlebenden Tieren der beson- ders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Ent- wicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Störungsverbot: Nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG ist es verboten, wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Stö- rung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Pop ulation ei- ner Art verschlechtert. Schädigungsverbot: Nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG ist es verboten, Fortpflanzungs- und Ruhe- stätten der wildlebenden Tiere der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsfor- men aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Bezüglich der Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-RL ergibt sich aus § 44 (1) Nr. 4 i. V. m. (5) BNatSchG (2010) für nach § 15 BNatSchG (2010) zulässige Eingriffe folgendes Verbot: Schädigungsverbot: Nach § 44 (1) Nr. 4 BNatSchG ist es verboten, wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen oder sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 2
BEBAUUNGSPLAN NR. 71.47 „FRANKLIN MITTE“
2.2 Datengrundlage
Für den vorliegenden Fachbeitrag wurden die nachfolgend genannten Datenquellen verwen-
det.
- Erfassung der Amphibienfauna im Rahmen der Naturschutzfachlichen Ersteinschät-
zung
- Kartierung der Avifauna
- Kartierung von Reptilien durch Transektbegehung
- Erfassung der Fledermausfauna
- Kartierung der Tagfalter
- Kartierung geschützter Pflanzenarten
- Befragung zum Vorkommen weiterer Säugetierarten neben den Fledermäusen bei Be-
hörden
2.3 Abschichtung relevanter Arten
Bestimmte Arten bzw. Artengruppen können nach dem Vorliegen bestimmter Bedingungen
(z.B. kein geeigneter Lebensraum im Bereich des Vorhabens, keine Empfindlichkeit gegenüber
den Projektwirkungen) von der artenschutzrechtlichen Betrachtung ausgeschieden werden.
Im Rahmen der 2015 durchgeführten Biotoptypenkartierung wurden keine artenschutzrecht-
lich geschützten Pflanzenarten innerhalb des Teilgebietes 3 erfasst. Daher können arten-
schutzrechtliche Verbotstatbestände für Pflanzenarten ausgeschlossen werden.
Die Artengruppe der Heuschrecken wird nicht weiter betrachtet, da in Deutschland keine Vor-
kommen von streng geschützten Arten existieren. Nur national geschützte Heuschrecken-Ar-
ten werden im Umweltbericht behandelt.
Es kommt durch das Vorhaben zu keinen Eingriffen in Gewässerlebensräume, deshalb wurden
keine gewässerspezifischen Untersuchungen durchgeführt. Krebse, Libellen, Muscheln und Fi-
sche wurden entsprechend nicht betrachtet.
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 3BEBAUUNGSPLAN NR. 71.47 „FRANKLIN MITTE“
3 Vorhabenbeschreibung und Projektwirkungen
3.1 Vorhabenbeschreibung
Gemäß dem vorgelegten Bebauungsplanentwurf Nr. 71.47 „Franklin Mitte“ ist für den Bereich
Benjamin-Franklin-Mitte (ca. 68 ha) überwiegend die Errichtung von Wohngebieten in 2- bis
4-geschossiger Bauweise mit Gebäudehöhen von 18 m vorgesehen. Der zentrale Bereich ist
als Wohngebiet (ca. 30% der Gesamtnutzung) mit einem kleinen Anteil an teilgewerblicher
Nutzung ausgewiesen. Am südlichen Ende der Abraham-Lincoln Allee ist eine kleinere Teilflä-
che als Gewerbegebiet geplant (ca. 1,5% der Gesamtfläche). Die Planung beinhaltet sowohl
Erhalt und Sanierung als auch Erneuerung der Gebäudestruktur im Bestand.
Um den zentralen Anger ist zudem die Errichtung von drei Hochhäusern geplant, ein weiteres
viertes Hochhaus ist im Südosten an der Birkenauer Straße vorgesehen. Die Hochhäuser sol-
len mit bis zu 14 Geschossen und Gebäudehöhen von maximal 48 m angelegt werden.
Für die Baufelder werden folgende bauplanungsrechtlichen Festsetzungen getroffen:
- Allgemeines Wohngebiet gem. § 8 BauNVO, GRZ: 0,4 bzw. GRZ: 0,6
- Mischgebiet gem. § 8 BauNVO, GRZ: 0,6
- Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO, GRZ: 0,8
- Sondergebiet gem. § 8 BauNVO, GRZ: 1
Die 3 großen, parallel verlaufenden Straßenzüge Andrew-Jackson-Straße, Thomas-Jefferson-
Straße und George-Washington-Straße durchqueren Benjamin-Franklin-Mitte von Südwest
nach Nordost. Zu den nord-südlich ausgerichteten Hauptverkehrsachsen gehören die Wasser-
werkstraße entlang der Nordwestgrenze sowie die Abraham-Lincoln-Allee im östlichen Areal
des Planungsraumes. Ein streng nord-süd verlaufender Gehweg durchschneidet zentral das
Wohngebiet Mitte. An der südlich verlaufenden Birkenauer Straße bildet ein Band mit Gewer-
benutzungen den Übergang zur angrenzenden geplanten gewerblichen Nutzung im Columbus
Quartier.
Die verbleibenden Flächen sind dem Gemeinbedarf (Sport) und Grünflächen zugewiesen (ca.
9 % der Gesamtfläche). Der Freiraum soll durch Quartiersgrün und öffentliche Grünflächen
insgesamt aufgewertet werden. Die Integration der vorhandenen Sportanlagen im südlichen
Freiraumbereich ist ebenfalls Bestandteil der Planung.
Die Planung sieht ein insgesamt U-förmiges Grünflächenverbundsystem vor, welches alle Teil-
flächen über den zentral gelegenen Campus miteinander verbindet. Um dieses Verbundsystem
im geplanten Ausmaß zu realisieren, ist der Abriss mehrerer Gebäude aus den verschiedenen
Quartieren notwendig. Der zwischen Sullivan Areal und Benjamin Franklin Village befindliche
Sullivan Park bildet eine Grünverbindung zur offenen Feldflur sowie zum Käfertaler Wald. Der
Funari Park mit seinen Spielplätzen und Sportanlagen schließt im Westen an das Bebauungs-
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 4BEBAUUNGSPLAN NR. 71.47 „FRANKLIN MITTE“
gebiet Nr. 71.47 an. Auch dieser bildet einen Korridor mit Anschluss an die offenen Land-
schaftsräume nordwestlich des Geltungsbereichs. Der südliche Abschnitt von Teilgebiet 3 geht
in den Campus über. Als durchgrünte Bewegungslandschaft fungiert dieser als klimaökolo-
gisch relevantes Bindeglied zwischen Funari und Sullivan Park.
Eine detaillierte Beschreibung des Bauvorhabens mit Baustelleneinrichtung/ Lagerflächen
wird nach Vorlage des Städtebaulichen Konzepts separat abgehandelt und gutachterlich be-
gleitet. Grundsätzlich werden zur Baustelleneinrichtung möglichst bereits teilversiegelte oder
bereits beeinträchtigte Flächen genutzt.
Im Rahmen der 3. Offenlage hat sich der Geltungsbereich im südwestlichen sowie geringfügig
im südöstlichen Bereich erweitert. Vor allem im südwestlichen Bereich sind Gehölzbestände
entlang der Kreuzung Waldstraße/Wasserwerkstraße hinzugekommen. Zudem wird das Quar-
tierszentrum im zentralen Bereich des Plangebiets ausgespart, da eine konkrete Planung erst
im späteren Verlauf des Verfahrens vorgesehen ist. Der vorliegende Artenschutzfachbeitrag
schließt diese Bereiche mit ein.
Auf der Grundlage des Bebauungsplanentwurfs wurden die Wirkfaktoren und Wirkprozesse
des Vorhabens, die artenschutzrechtliche Relevanz haben, identifiziert. Bei den Wirkfaktoren
wird zwischen bau-, anlagen- und betriebsbedingten Faktoren unterschieden.
3.2 Projektwirkungen
3.2.1 Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse
Während der Bauphase sind folgende vom Projekt ausgehende Wirkungen zu erwarten:
- Emissionen von Schall, Erschütterungen, Staub oder Abgasen durch die Bautätigkeit,
durch Baustellenverkehr und Massentransport
- Sanierung und Abriss bestehender Gebäude
- Rodung von Gehölzbeständen im Zuge der Baufeldfreimachung
- Temporäre Flächeninanspruchnahme für Baustelleneinrichtungsflächen (BE-Flächen)
- Bodenbewegungen durch Umlagerung von Boden und Gesteinen während der Bau-
phase
3.2.2 Anlagenbedingte Wirkprozesse
Allgemeine anlagenbedingte Wirkfaktoren sind durch bauliche Anlagen (Gebäude und Neben-
anlagen, Straßen, Wege und Plätze) bedingt. Die Intensität und die Reichweite der Wirkungen
sind wesentlich von der Bauart und der Abmessungen der baulichen Anlagen abhängig:
- Flächeninanspruchnahme und Versiegelung im Bereich der Baufelder und der zu er-
richtenden Straßenverkehrsflächen
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 5BEBAUUNGSPLAN NR. 71.47 „FRANKLIN MITTE“
- Veränderung von Lebensräumen durch neu geplante Nutzungen (z.B. Anlage von
Scherrasen, Extensivwiesen und Obstwiesen)
3.2.3 Betriebsbedingte Wirkprozesse
Als allgemein betriebsbedingt werden jene Wirkfaktoren bezeichnet, die mit dem Betrieb und
der Unterhaltung eines Siedlungsgebietes einhergehen. Im vorliegenden Fall sind dies:
- Störungen von Tieren durch menschliche Nutzung des Quartiers (Bewegungsunruhe,
Schallemissionen durch erhöhtes Verkehrsaufkommen, gewerbliche Betriebe und den
Sportplatz)
- Der Untersuchungsraum ist durch die bisherige Kasernennutzung und bereits beste-
hende Schallemissionen (B 38, Sportplatz, geringe gewerbliche Nutzung) erheblich
vorbelastet. Qualitativ neue erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht absehbar.
In den Artblättern der einzelnen Arten werden die Auswirkungen des Vorhabens getrennt
nach bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen betrachtet.
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 6BEBAUUNGSPLAN NR. 71.47 „FRANKLIN MITTE“ 4 Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten In Anlage 1 „Bestandskarte Fauna“ sind die Vorkommen aller planungsrelevanten Tierarten innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans in der Übersicht dargestellt. 4.1 Fledermäuse 4.1.1 Nachweismethode Zur Erfassung der Fledermäuse wurden insgesamt sieben Detektorbegehungen , je ca. 1,25 Stunden (07.04.2015, 13.04.2015, 23.04.2015, 05.05.2015, 18.05.2015, 29.05.2015, 09.06.2015), durchgeführt. Diese fanden bei geeigneten Witterungsbedingungen (relativ laue, windstille Nächte ohne Niederschlag) statt. Die ersten fünf Begehungen erfolgten in den Abendstunden, die restlichen zwei Erfassungen wurden als Schwärmkontrollen in den Morgenstunden vorge- nommen. Mittels eines Pettersson Ultrasound Detektor D240x wurden die Rufe detektiert und mit einem Aufnahmegerät archiviert. Während der Erfassungsnächte wurden regelmäßig Wet- termessungen (mittels Wetterstation SkyMate Pro ) durchgeführt. Zusätzlich wurde im Zeitraum vom 26.05.2015 bis 09.06.2015 ein automatischer Rufdatenlog- ger (batcorder 3.0 der Firma ecoObs GmbH) installiert. Hierdurch lassen sich Angaben zur Ak- tivitätsdichte an einem Standort machen. Die Laufzeit des batcorders ging über die gesamte Nacht. Die aufgenommenen Fledermaussequenzen (Sequenz = eine akustische Aufnahme ei- ner Art bzw. Artengruppe mit mindestens einem Ruf) werden manuell mit den Rufanalyse - Programmen BatSound 4.0 bzw. bc Analyze 2.0 analysiert. Die Ortungsrufe von Fledermäusen passen sich der jeweiligen Flugsituation an. Dabei können manche Fledermausarten anhand ihrer Ortungsrufe sicher unterschieden werden, bei vielen anderen Arten gibt es allerdings große Überlappungsbereiche der Rufe, so dass die Fledermausart nicht exakt bestimmt wer- den kann. Ist es nicht möglich, die Art- bzw. das Gattungsniveau zu bestimmen, wird der Ruf einer Rufklasse (z. B. Ruftyp „Nyctaloid“) zugeordnet. Zu dem Ruftyp Nyctaloid können di e Rufe der Nordfledermaus ( Eptesicus nilssonii ), der Breitflügelfledermaus ( Eptesicus seroti- nus), der Zweifarbfledermaus ( Vespertilio murinus ) sowie des Großen und des Kleinen Abendseglers (Nyctalus noctula / Nyctalus leisleri ) zählen. Fledermäuse der Gattung Myotis können anhand ihrer Rufe häufig nicht voneinander unterschieden werden, so dass ein Ruf oft nur der Gattung Myotis zugeordnet werden kann. Rufanalytisch keinesfalls zu unterscheiden sind die beiden Bartfledermausarten (Kleine und Große Bartfledermaus; Myotis mystacinus , Myotis brandtii ), daher können diese nur der Artengruppe „Bartfledermaus“ zugeordnet wer- den. Gleiches gilt für die Gattung Plecotus: Graues und Braunes Langohr ( Plecotus austriacus , Plecotus auritus ) können anhand der Rufbilder ihrer Suchrufe nicht voneinander getrennt werden. Bei den akustischen Erfassungsmethoden ist zudem zu beachten, dass leise rufende Arten (z. B. die der Gattung Plecotus und die Bechsteinfledermaus, Myotis bechsteinii ) selte- ner erfasst werden. Zudem kann durch die Anzahl an Rufsequenzen nicht auf die Anzahl an Individuen geschlossen werden. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 7
BEBAUUNGSPLAN NR. 71.47 „FRANKLIN MITTE“ Zur Erfassung des Quartierpotentials wurden im Zuge der Biotoptypenkartierung bzw. Einzel- baumerfassung innerhalb des TG 3, Bäume, die Höhlen oder andere quartiertaugliche Struk- turen aufweisen, erfasst. Zudem wurden am 18.02.2015 stichprobenartig die Keller einiger Gebäude auf das Vorhan- densein von und die Eignung als Winterquartier begutachtet. Hierbei wurde darauf geachtet, dass alle vorhandenen Gebäudetypen mehrfach begangen wurden. Die Häuser, die zum Zeit- punkt der Begehung beheizt waren, wurden von der Untersuchung ausgeschlossen, da dies eine Eignung als Winterquartier ausschließen lässt. 4.1.2 Ergebnisse 4.1.2.1 Detektorkartierung Während der Detektorkartierungen wurde mit 29 Rufsequenzen die Zwergfledermaus inner- halb des Untersuchungsraumes am häufigsten nachgewiesen. Diese Art nutzt das Untersu- chungsgebiet nur sporadisch, ein Erfassungsschwerpunkt ist im nördlichen Bereich des TG 3 erkennbar. Die Tiere wurden hier teils bei der Jagd, teils beim Durchflug gesichtet. Weiterhin wurden während zwei Nächten (05.05.2015, 18.05.2015) zwei Rufe von Rauhautfledermäusen aufgezeichnet. Diese Aufzeichnungen waren ebenfalls im nördlichen Bereich des Geländes lo- kalisiert. Zudem konnten zwei Rufe eindeutig dem Großen Abendsegler zugeordnet werden. Ebenfalls je ein Ruf wurde der Gattung Myotis und dem Ruftyp Nyctaloid zugeordnet. Der Nachweis des nyctaloiden Rufes erfolgte im südlichen Teil des Untersuchungsraumes, im nordwestlichen Bereich des TG 3 wurde der Ruf aus der Gattung Myotis erfasst. Während der Detektorkartierungen wurde explizit auf das Schwärmen von Fledermäusen vor möglichen Quartieren geachtet. Ein solches Verhalten konnte innerhalb des Untersuchungsge- bietes nicht beobachtet werden. Allerdings kann aufgrund dieser Tatsache nicht davon ausge- gangen werden, dass sich keine Quartiere von Fledermäusen auf dem Gelände des TG 3 befin- den. Tabelle 1: Während der Detektorkartierungen erfassten Arten und Anzahl an erfassten Rufse- quenzen. Art Wiss. Bezeichnung Anzahl der Rufsequenzen Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 29 Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii 2 Großer Abendsegler Nyctalus noctula 2 Gattung Myotis - 1 Ruftyp Nyctaloid - 1 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 8
BEBAUUNGSPLAN NR. 71.47 „FRANKLIN MITTE“
4.1.2.2 Stationäre Rufdatenlogger
Tabelle 2 zeigt die durch den batcorder erfassten Rufsequenzen des 14-tägigen Aufnahme-
blocks. In nahezu allen Nächten wurden Rufe von Zwergfledermäusen aufgezeichnet. Wäh-
rend zwei Erfassungsnächten wurden Rufe der Rauhautfledermaus ( Pipistrellus nathusii ) auf-
gezeichnet. Weiterhin gab es regelmäßige Erfassungen der Gattung Nyctalus oder des Ruftyps
Nyctaloid. An sechs Nächten wurden auch Rufe aus der Gattung Plecotus aufgezeichnet. An-
hand des Rufbildes kann nicht unterschieden werden, ob es sich um das Braune oder das
Graue Langohr handelt. Das Große Mausohr und andere Arten der Gattung Myotis wurden le-
diglich in einer Nacht erfasst. Der batcorder zeichnete in dieser Nacht nur jeweils eine Rufse-
quenz eines Großen Mausohrs und eine Rufsequenz der Gattung Myotis auf, was auf eine sehr
geringe Nutzung des TG 3 schließen lässt.
Tabelle 2: Während des 14-tägigen Aufnahmeblocks erfasste Rufsequenzen.
Aufnahmedatum Art Wiss. Bezeichnung Anzahl der
Rufsequenzen
26./27.05.2015 Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 2
Nyctalus - 1
27./28.05.2015 Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 1
Nyctalus - 1
28./29.05.2015 Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 4
Großer Nyctalus noctula 1
Abendsegler
Nyctalus - 1
Nyctaloid - 1
Großes Mausohr Myotis myotis 1
Myotis - 1
Plecotus - 2
29./30.05.2015 Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 8
Nyctaloid - 1
30./31.05.2015 Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 1
31.05./01.06.2015 Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 11
Großer Nyctalus noctula 2
Abendsegler
Nyctalus - 12
Nyctaloid - 2
Plecotus - 1
01./02.06.2015 Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 8
Nyctalus - 1
Nyctaloid - 3
02./03.06.2015 Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 3
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 9BEBAUUNGSPLAN NR. 71.47 „FRANKLIN MITTE“
Aufnahmedatum Art Wiss. Bezeichnung Anzahl der
Rufsequenzen
Nyctaloid - 6
Plecotus - 2
03./04.06.2015 Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 6
Großer Nyctalus noctula 13
Abendsegler
Nyctalus - 1
Nyctaloid - 18
Plecotus - 1
04./05.06.2015 Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 11
Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii 2
Großer Nyctalus noctula 12
Abendsegler
Nyctalus - 2
Nyctaloid - 6
Plecotus - 1
05./06.06.2015 Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 6
Nyctalus - 14
Nyctaloid - 9
06./07.06.2015 Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 6
Nyctalus - 3
Nyctaloid - 1
07./08.06.2015 Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 6
Nyctalus - 1
Nyctaloid - 2
Plecotus - 1
08./09.06.2015 - - 0
4.1.2.3 Baumhöhlen
Insgesamt wurden 116 Bäume innerhalb des Untersuchungsraumes erfasst, die Höhlen oder
höhlenartige Strukturen aufweisen und von Fledermäusen potentiell als Quartiere genutzt
werden können.
4.1.2.4 Kontrolle der Gebäude auf Winterquartiereignung
Während der Kontrollbegehung wurden keine Winterquartiere von Fledermäusen nachgewie-
sen. Die Eignung der untersuchten Gebäude lässt sich außerdem als nahezu ungeeignet für
Winterquartiere beschreiben. Die Gebäude sind stark ausgebaut, aus diesem Grund sind sie
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 10BEBAUUNGSPLAN NR. 71.47 „FRANKLIN MITTE“ zwar gut kontrollierbar, bieten den Fledermäusen jedoch wenig Versteck- und Unter- schlupfmöglichkeiten. 4.1.3 Nachgewiesene Arten Tabelle 3: Schutz- und Gefährdungsstatus der nachgewiesenen Fledermausarten Deutscher Name Wissenschaftlicher Name RL BW RL D EHZ BW/D Großer Abendsegler Nyctalus noctula i V u/u Großes Mausohr Myotis myotis 2 V g/g Braunes Langohr/ Plecotus auritus/ 3 V g/g Graues Langohr Plecotus austriacus 1 2 u/u Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii i * g/u Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 3 * g/g Tabellenerläuterung: RL BW = Rote Liste Baden-Württemberg; RL D = Rote Liste Deutschland, EHZ = Erhaltungszustand 0 ausgestorben/verschollen i gefährdete wandernde Art g Erhaltungszustand günstig 1 vom Aussterben bedroht V Arten der Vorwarnliste u Erhaltungszustand unzureichend 2 stark gefährdet D Daten defizitär 3 gefährdet * ungefährdet G Gefährdung anzunehmen n.a. nicht angegeben 4.1.4 Betroffenheit Bezüglich der rückzubauenden Gebäude müssen ebenfalls Maßnahmen getroffen werden. Trotz der Begehungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich dort Einzelquartiere be- finden. So bieten z.B. Rollladenkästen, Fassadenverkleidungen oder Dachstühle gute Möglich- keiten, einzelnen Fledermäusen (insbesondere den relativ häufig erfassten Zwergfledermäu- sen) als Quartier zu dienen. Das Vorhandensein von großen Wochenstubenkolonien wäre hin- gegen durch die Kartierungen mit großer Wahrscheinlichkeit bemerkt worden. Nichtsdestot- rotz müssen sie, falls der Rückbau innerhalb der Sommermonate stattfindet, vorher auf das Vorhandensein von Fledermäusen überprüft werden, um artenschutzrechtliche Verbotstatbe- stände ausschließen zu können. Lichtemissionen an den Baustellen können sich nachteilig auswirken, da manche Arten ausge- leuchtete Bereiche weniger häufig als üblich frequentieren oder ganz meiden. Denkbar ist so- mit, dass ausgeleuchtete Bauabschnitte eine Barriere darstellen und Fledermä use in der Folge auf andere Jagdrouten ausweichen müssen. Dieser Effekt ist vor allem für Arten der Gat- tung Myotis und der Gattung Plecotus nachgewiesen. Arten wie die Zwerg- Rauhautfleder- maus oder der Große Abendsegler sind während Jagd- oder Transferflügen weitgehend un- empfindlich gegenüber Lichtemissionen. Im direkten Umfeld zu Quartieren zeigen jedoch alle Arten eine erhöhte Empfindlichkeit. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 11
BEBAUUNGSPLAN NR. 71.47 „FRANKLIN MITTE“ Da die Bautätigkeiten außerhalb der Nachtstunden stattfinden werden und keine Quartiere nachgewiesen wurden, ist nicht mit Beeinträchtigungen zu rechnen. Emissionen von Staub oder Abgasen während der Bautätigkeit spielen für Fledermäuse keine bedeutende Rolle. Lärmemissionen können allenfalls dann für Fledermäuse erheblich werden, wenn sie den Jagderfolg negativ beeinflussen. Dies kann eintreten, wenn der Lärm dazu führt, dass Arten Probleme haben, Beute vor einer Lärmkulisse zu orten („Maskierung“ der Beute). Im vorliegenden Fall ist jedoch davon auszugehen, dass die Bautätigkeit außerhalb der Nacht- stunden stattfinden wird und deshalb nicht zu Beeinträchtigungen führt. In den folgenden Artenblättern ist die Betroffenheit der jeweiligen nachgewiesenen Fleder- mausarten zusammengestellt. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 12
BEBAUUNGSPLAN NR. 71.47 „FRANKLIN MITTE“
Betroffene Arten: Großer Abendsegler ( Nyctalus noctula )
1. Schutz- und Gefährdungsstatus
Rote Liste Status Biogeographische Region
FFH-Anhang-IV-Art Bundesland: s. Tabelle 3 (in der sich das Vorhaben auswirkt):
Europäische Vogelart Deutschland: s. Tabelle 3 Atlantische Region
Kontinentale Region
Alpine Region
Erhaltungszustand Deutschland Erhaltungszustand Bundesland Erhaltungszustand lokale Population
s. Tabelle 3 s. Tabelle 3
im UG nachgewiesen im UG unterstellt
Der Große Abendsegler konnte anhand von zwei Rufaufnahmen nachgewiesen werden. Als
Sommerquartier wählt der Große Abendsegler hauptsächlich Baumhöhlen. Wochenstuben-
quartiere wurden auf dem Gelände nicht nachgewiesen, finden sich jedoch häufig in/ an Ge-
bäuden.
2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikomanagements
Erforderliche CEF Maßnahmen:
Anbringung von geeigneten Ersatzquartieren (Kapitel 5.2)
Erforderliche artenschutzspezifische Maßnahmen:
Auflage zur Rodung von Gehölzen (Kapitel 5.1)
Auflage zum Abriss von Gebäuden (Kapitel 5.1)
Sonstige erforderliche Vorgaben:
keine
Verbleibende Beeinträchtigungen unter Berücksichtigung der dargestellten Maßnahmen:
keine
3. Verbotsverletzungen
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt: ja nein
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt: ja nein
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: ja nein
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: ja nein
4. Auswirkungen auf den Erhaltungszustand
Bei Durchführung der vorgeschlagenen Maßnahmen ergeben sich für den Großen Abendseg-
ler, aufgrund des Vorhabens, keine artenschutzrechtlichen Konflikte und folglich keine Be-
einträchtigungen des Erhaltungszustands der Art.
Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswirkun-
gen auf den Erhaltungszustand:
Der Erhaltungszustand der Population der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner V erschlechte-
rung
Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist ungünstig.
Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des Erhaltungszustandes
der Population und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes.
Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist ungünstig.
Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Popu-
lationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes
Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Populationen
der Art.
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 13BEBAUUNGSPLAN NR. 71.47 „FRANKLIN MITTE“
Betroffene Arten: Rauhautfledermaus ( Pipistrellus nathusii )
1. Schutz- und Gefährdungsstatus
Rote Liste Status Biogeographische Region
FFH-Anhang-IV-Art Bundesland: s. Tabelle 3 (in der sich das Vorhaben auswirkt):
Europäische Vogelart Deutschland: s. Tabelle 3 Atlantische Region
Kontinentale Region
Alpine Region
Erhaltungszustand Deutschland Erhaltungszustand Bundesland Erhaltungszustand lokale Population
s. Tabelle 3 s. Tabelle 3
im UG nachgewiesen im UG unterstellt
Die Rauhautfledermaus konnte anhand von zwei Rufaufnahmen im nördlichen Bereich des TG
3 nachgewiesen werden. Die Wochenstubenquartiere dieser Art liegen überwiegend in
Baumhöhlen, hinter abstehender Rinde und in Fledermauskästen. Einzelne Quartiere liegen
auch an Häusern. Es wurden keine Quartiere nachgewiesen, einzelne Tagesverstecke in und
an Gehölzen oder in Gebäuden sind jedoch nicht auszuschließen.
2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikomanagements
Erforderliche CEF Maßnahmen:
Anbringung von geeigneten Ersatzquartieren (Kapitel 5.2)
Erforderliche artenschutzspezifische Maßnahmen:
Auflage zur Rodung von Gehölzen (Kapitel 5.1)
Auflage zum Abriss von Gebäuden (Kapitel 5.1)
Sonstige erforderliche Vorgaben:
keine
Verbleibende Beeinträchtigungen unter Berücksichtigung der dargestellten Maßnahmen:
keine
3. Verbotsverletzungen
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt: ja nein
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt: ja nein
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: ja nein
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: ja nein
4. Auswirkungen auf den Erhaltungszustand
Bei Durchführung der vorgeschlagenen Maßnahmen ergeben sich für die Rauhautfleder-
maus, aufgrund des Vorhabens, keine artenschutzrechtlichen Konflikte und folglich keine Be-
einträchtigungen des Erhaltungszustands der Art.
Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahm en zu folgenden Auswirkun-
gen auf den Erhaltungszustand:
Der Erhaltungszustand der Population der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner Verschlechte-
rung
Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist ungünstig.
Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des E rhaltungszustandes
der Population und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes.
Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist ungünstig.
Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Popu-
lationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes
Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Populationen
der Art.
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 14BEBAUUNGSPLAN NR. 71.47 „FRANKLIN MITTE“
Betroffene Arten: Zwergfledermaus ( Pipistrellus pipistrellus )
1. Schutz- und Gefährdungsstatus
Rote Liste Status Biogeographische Region
FFH-Anhang-IV-Art Bundesland: s. Tabelle 3 (in der sich das Vorhaben auswirkt):
Europäische Vogelart Deutschland: s. Tabelle 3 Atlantische Region
Kontinentale Region
Alpine Region
Erhaltungszustand Deutschland Erhaltungszustand Bundesland Erhaltungszustand lokale Population
s. Tabelle 3 s. Tabelle 3
im UG nachgewiesen im UG unterstellt
Die Zwergfledermaus war erwartungsgemäß die häufigste Art im Untersuchungsgebiet, nutzt
aber den Planungsraum relativ sporadisch. Zu den Quartieren zählen Häuser, Felsritzen,
Baumlöcher und jegliche geschützte und trockene Stellen.
2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikomanagements
Erforderliche CEF Maßnahmen:
Anbringung von geeigneten Ersatzquartieren (Kapitel 5.2)
Erforderliche artenschutzspezifische Maßnahmen:
Auflage zur Rodung von Gehölzen (Kapitel 5.1 )
Auflage zum Abriss von Gebäuden (Kapitel 5.1)
Sonstige erforderliche Vorgaben:
keine
Verbleibende Beeinträchtigungen unter Berücksichtigung der dargestellten Maßnahmen:
keine
3. Verbotsverletzungen
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt: ja nein
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt: ja nein
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: ja nein
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: ja nein
4. Auswirkungen auf den Erhaltungszustand
Bei Durchführung der vorgeschlagenen Maßnahmen ergeben sich für die Zwergfledermaus,
aufgrund des Vorhabens, keine artenschutzrechtlichen Konflikte und folglich keine Beein-
trächtigungen des Erhaltungszustands der Art.
Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswirkun-
gen auf den Erhaltungszustand:
Der Erhaltungszustand der Population der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner Verschlechte-
rung
Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist ungünstig.
Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des Erhaltungszustandes
der Population und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes.
Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist ungünstig.
Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Popu-
lationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes
Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Populationen
der Art.
Betroffene Arten: Großes Mausohr ( Myotis Myotis )
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 15BEBAUUNGSPLAN NR. 71.47 „FRANKLIN MITTE“
1. Schutz- und Gefährdungsstatus
Rote Liste Status Biogeographische Region
FFH-Anhang-IV-Art Bundesland: s. Tabelle 3 (in der sich das Vorhaben auswirkt):
Europäische Vogelart Deutschland: s. Tabelle 3 Atlantische Region
Kontinentale Region
Alpine Region
Erhaltungszustand Deutschland Erhaltungszustand Bundesland Erhaltungszustand lokale Population
s. Tabelle 3 s. Tabelle 3
im UG nachgewiesen im UG unterstellt
Das Große Mausohr wurde anhand einer batcorder- Aufnahme nachgewiesen. Die Winter-
quartiere von Großen Mausohren befinden sich in Höhlen, Stollen oder Kellern.
Wochenstubenquartiere dieser Art befinden sich überwiegend auf geräumigen Dachböden
oder in Hohlräumen von großen Brücken oder Kellern.
2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikomanagements
Erforderliche CEF Maßnahmen:
Anbringung von geeigneten Ersatzquartieren (Kapitel 5.2)
Erforderliche artenschutzspezifische Maßnahmen:
Auflage zur Rodung von Gehölzen (Kapitel 5.1)
Auflage zum Abriss von Gebäuden (Kapitel 5.1)
Sonstige erforderliche Vorgaben:
keine
Verbleibende Beeinträchtigungen unter Berücksichtigung der dargestellten Maßnahmen:
keine
3. Verbotsverletzungen
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt: ja nein
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt: ja nein
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: ja nein
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: ja nein
4. Auswirkungen auf den Erhaltungszustand
Bei Durchführung der vorgeschlagenen Maßnahmen ergeben sich für den Großen Abendseg-
ler, aufgrund des Vorhabens, keine artenschutzrechtlichen Konflikte und folglich keine Be-
einträchtigungen des Erhaltungszustands der Art.
Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswirkun-
gen auf den Erhaltungszustand:
Der Erhaltungszustand der Population der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner Verschlechte-
rung
Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist ungünstig.
Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des Erhaltungszustandes
der Population und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes.
Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist ungünstig.
Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Popu-
lationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes
Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Populationen
der Art.
Betroffene Arten: Graues Langohr (Plecotus austricus )/ Braunes Langohr ( Plecotus auritus )
1. Schutz- und Gefährdungsstatus
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 16BEBAUUNGSPLAN NR. 71.47 „FRANKLIN MITTE“
Rote Liste Status Biogeographische Region
FFH-Anhang-IV-Art Bundesland: s. Tabelle 3 (in der sich das Vorhaben auswirkt):
Europäische Vogelart Deutschland: s. Tabelle 3 Atlantische Region
Kontinentale Region
Alpine Region
Erhaltungszustand Deutschland Erhaltungszustand Bundesland Erhaltungszustand lokale Population
s. Tabelle 3 s. Tabelle 3
im UG nachgewiesen im UG unterstellt
Rufe von Langohren wurden durch den batcorder in sechs Nächten insgesamt 8-mal erfasst.
Ob es sich bei den erfassten Rufen um Graue oder Braune Langohren handelt , kann anhand
der Rufanalyse nicht eindeutig festgestellt werden. Aus diesem Grund wird das Vorkommen
beider Arten im Untersuchungsgebiet unterstellt. Von dem Vorhandensein von Wochenstu-
benquartieren wird jedoch nicht ausgegangen, da nur sehr vereinzelt Rufe aufgezeichnet
wurden. Auch scheinen die Tiere das Gebiet nicht regelmäßig und häufig als Nahrungsraum
zu nutzen.
Das Graue Langohr gilt als typische Dorffledermaus; die Sommerquartiere und Wochenstuben
liegen in Dachstühlen und Kirchtürmen; die Winterquartiere meist unterirdisch in Höhlen,
Stollen oder Kellern, aber auch in Dachböden.
Das Braune Langohr hingegen kommt häufig in Wäldern, Parks und in besiedelten Räumen
vor. Sommerquartiere und Wochenstuben liegen in Baumhöhlen, aber auch Dachstühlen und
Fledermauskästen.
Winterquartiere sind vorwiegend unterirdisch in Kellern, Stollen oder Höhlen zu suchen, sel-
ten auch oberirdisch an möglichst frostgeschützten Orten.
2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikomanagements
Erforderliche CEF Maßnahmen:
Anbringung von geeigneten Ersatzquartieren (Kapitel 5.2)
Erforderliche artenschutzspezifische Maßnahmen:
Auflage zur Rodung von Gehölzen (Kapitel 5.1 )
Auflage zum Abriss von Gebäuden (Kapitel 5.1)
Sonstige erforderliche Vorgaben:
keine
Verbleibende Beeinträchtigungen unter Berücksichtigung der dargestellten Maßnahmen:
keine
3. Verbotsverletzungen
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt: ja nein
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt: ja nein
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: ja nein
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: ja nein
4. Auswirkungen auf den Erhaltungszustand
Bei Durchführung der vorgeschlagenen Maßnahmen ergeben sich für die das Braune/ Graue
Langohr, aufgrund des Vorhabens, keine artenschutzrechtlichen Konflikte und folglich keine
Beeinträchtigungen des Erhaltungszustands der Arten.
Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswirkun-
gen auf den Erhaltungszustand:
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 17BEBAUUNGSPLAN NR. 71.47 „FRANKLIN MITTE“
Der Erhaltungszustand der Population der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner Verschlechte-
rung
Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist ungünstig.
Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des Erhaltungszustandes
der Population und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes.
Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist ungünstig.
Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Popu-
lationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes
Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Populationen
der Art.
4.2 Säugetiere ohne Fledermäuse
4.2.1 Vorkommen
Anhand der „Liste der in Baden-Württemberg vorkommenden besonders und streng ge-
schützte Arten“ (LUBW 2010) kommen in Baden-Württemberg folgende nach Anhang IV FFH-RL
streng geschützten Säugetierarten (ohne Fledermäuse) vor: Wolf, Biber, Feldhamster, Wild-
katze, Fischotter, Luchs, Haselmaus und Braunbär.
Der Braunbär ist in Baden-Württemberg ausgestorben. Für den Wolf sind in Baden-Württem-
berg keine aktuellen Vorkommen belegt. Der Feldhamster kommt in der offenen Agrarland-
schaft vor und benötigt bindige Böden von mindestens 1m Mächtigkeit. Aufgrund dieser Le-
bensraumansprüche kann ein Feldhamstervorkommen im Bereich des Siedlungsgebietes Ben-
jamin-Franklin Village ausgeschlossen werden.
Biber und Fischotter sind Bewohner naturnaher Auenlandschaften bzw. naturnaher Bäche. Da
diese Habitatstrukturen im Plangebiet nicht vorhanden sind, kann ein Vorkommen von Biber
und Fischotter sicher ausgeschlossen werden.
Luchs und Wildkatze kommen in großen Waldgebieten mit geeigneten Habitatstrukturen vor.
In Baden-Württemberg sind die nächstgelegenen Wildkatzenvorkommen nördlich von Karls-
ruhe und für den Kraichgau belegt. Im Raum Mannheim dagegen bestehen keine Hinweise
auf Luchs- oder Wildkatzenvorkommen. Da durch den Bebauungsplan kein Eingriff in Waldge-
biete erfolgt, kann eine Betroffenheit von Luchs und Wildkatze ausgeschlossen werden.
Nach Auskunft der Unteren Naturschutzbehörde liegen für den Raum Mannheim keine aktuel-
len Nachweise von Haselmausvorkommen vor. Im Grundlagewerk „Die Säugetiere Baden-
Württembergs“, Bd. 2 (BRAUN/ DIETERLEN 2005) ist im Quadranten der Topografischen Karte
1:25.000 Nr. 6317, in welchem sich der Bebauungsplan befindet, ein Fundort der Haselmaus
verzeichnet. Der Quadrant deckt eine Flächengröße von ca. 2.500 ha ab und ist damit wesent-
lich größer als der Geltungsbereich des Bebauungsplans mit ca. 74 ha. Das Plangebiet stellt
somit nur ca. 3% der Fläche des TK-Quadranten dar. Da die Habitatstrukturen innerhalb des
Geltungsbereichs als ungeeignet für die Haselmaus beurteilt werden, ist davon auszugehen,
dass der Fundort der Haselmaus außerhalb des Plangebietes liegt.
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 18BEBAUUNGSPLAN NR. 71.47 „FRANKLIN MITTE“ „Die Haselmaus lebt bevorzugt in Laub- und Laubmischwäldern, an gut strukturierten Wald- rändern sowie auf gebüschreichen Lichtungen und Kahlschlägen. Außerhalb geschlossener Waldgebiete werden in Parklandschaften auch Gebüsche, Feldgehölze und Hecken sowie gele- gentlich in Siedlungsnähe auch Obstgärten und Parks besiedelt. Tagsüber schlafen die däm- merungs- und nachtaktiven Haselmäuse in faustgroßen Kugelnestern in der Vegetation oder in Baumhöhlen. Ein Tier legt pro Sommer 3-5 Nester an. Sie können auch in Nistkästen gefun- den werden. Ab Ende Oktober bis Ende April/Anfang Mai verfallen die Tiere in den Winter- schlaf, den sie in Nestern am Boden unter der Laubschicht, zwischen Baumwurzeln oder in frostfreien Spalten verbringen (LANUV 2015). Im Geltungsbereich bestehen neben mehreren Ziergehölzen nur vereinzelte unterholzreiche Hecken sowie alter Baumbestand. Insgesamt werden die Habitatstrukturen als ungeeignet für die Haselmaus bewertet, da das Teilgebiet 3 bereits innerhalb der Siedlungslage liegt, wo Ha- selmäuse nicht vorkommen. Potenzielle Habitatelemente, wie gut strukturierte Hecken, liegen zu isoliert voneinander. Aufgrund der insgesamt ungeeigneten Habitatstrukturen kann somit ein Vorkommen der Haselmaus im Geltungsbereich ausgeschlossen werden. 4.2.2 Betroffenheit Baubedingt: Baubedingt werden keine Beeinträchtigungen für die Artengruppe der Säugetiere ohne Fle- dermäuse erwartet, da die artenschutzrechtlich relevanten Arten im Geltungsbereich des Be- bauungsplans nicht vorkommen. Anlagebedingt: Anlagebedingt werden keine Beeinträchtigungen für die Artengruppe der Säugetiere ohne Fledermäuse erwartet, da die artenschutzrechtlich relevanten Arten im Geltungsbereich des Bebauungsplans nicht vorkommen. Betriebsbedingt: Betriebsbedingt werden keine Beeinträchtigungen für die Artengruppe der Säugetiere ohne Fledermäuse erwartet, da die artenschutzrechtlich relevanten Arten im Geltungsbereich des Bebauungsplans nicht vorkommen. 4.3 Reptilien Im Zuge der Reptilienerfassungen im Teilbereich 3 wurden fünf Begehungen zwischen Sep- tember 2014 und Juni 2015 durchgeführt. Zur Erfassung von Reptilien hat sich die Sichtbe- obachtung als gängige Methode durchgesetzt. Dabei wird die zu untersuchende Fläche in Transekten langsam begangen, wodurch Doppelzählungen vermieden werden. Potenzielle Versteckmöglichkeiten, wie beispielsweise herumliegende Bretter oder Steine, wurden eben- falls gewendet um darunter befindliche Tiere zu erfassen. Die Geländebegehungen wurden Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 19
BEBAUUNGSPLAN NR. 71.47 „FRANKLIN MITTE“ ausschließlich bei Witterungsbedingungen durchgeführt, die für Reptilien geeignet sind, d.h. es war warm und sonnig bis leicht bewölkt. Beobachtete Reptilien wurden mittels GPS einge- messen und ihr Geschlecht (männlich, weiblich) sowie ihre Altersklasse (adult, subadult, juve- nil) dokumentiert. Ergab sich die Möglichkeit, so wurden die gefundenen Tiere auch fotogra- fisch festgehalten. Im Teilgebiet 3 des Benjamin Franklin Village wurden im Zuge der Begehungen einzelne Zau- neidechsen erfasst. Weitere Reptilienarten wurden in diesem Teilgebiet nicht nachge wiesen. Tabelle 4: Schutz- und Gefährdungsstatus der vorkommenden Reptilienart. Deutscher Name Wissenschaftlicher Name RL BW RL D EHZ BW/D Zauneidechse Lacerta agilis V V u/u Tabellenerläuterung: RL BW = Rote Liste Baden-Württemberg; RL D = Rote Liste Deutschland, EHZ = Erhaltungszustand 0 ausgestorben/verschollen R extrem seltene g Erhaltungszustand günstig 1 vom Aussterben bedroht V Arten der Vorwarnliste u Erhaltungszustand ungünstig 2 stark gefährdet D Daten defizitär 3 gefährdet * ungefährdet G Gefährdung anzunehmen n.a. nicht angegeben 4.3.1 Vorkommen Die Zauneidechse kommt im Teilbereich 3 v.a. in den Randbereichen vor. Nachweise gelangen sowohl im Süden des Untersuchungsgebiets als auch im nördlichen Abschnitt (Abbildung 1). Das Zauneidechsenmännchen, das 2014 im südlichen Bereich erfasst wurde, konnte im Folge- jahr nicht mehr nachgewiesen werden. Auch weitere Tiere konnten in diesem Bereich nicht beobachtet werden. Aus diesem Grund wird vermutet, dass es sich bei dem einzelnen Männ- chen um ein wanderndes Tier handelt und weitere Tiere im Umfeld nicht vorhanden sind. Die beiden subadulten Zauneidechsen wurden im Randbereich der Teilfläche 3 im Anschluss an die angrenzenden Kleingärten der Teilfläche 2 gefunden. Kleingartenanlagen weisen aufgrund ihrer kleinräumigen Strukturvielfalt ein hohes Potenzial für Zauneidechsen auf. Aus diesem Grund ist der nordöstliche Grenzbereich der Teilfläche 3 besonders gut für die Zauneidechse geeignet. Da der Bewuchs in dem Bereich, in dem die Tiere im Frühjahr nachgewiesen wur- den im Laufe der Saison stark zugenommen hat und die beiden Tiere bei den folgenden Bege- hungen nicht mehr erfasst werden konnten, wird davon ausgegangen, dass diese aufgrund der veränderten Lebensraumbedingungen vermutlich in die Kleingartenanlagen abgewandert sind. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 20
BEBAUUNGSPLAN NR. 71.47 „FRANKLIN MITTE“ Abbildung 1: Verortung der Zauneidechsennachweise im Teilgebiet 3. Im Grenzbereich von Teilfläche 3 zu Teilfläche 6, östlich der Nachweise der subadulten Zau- neidechsen, sind ebenfalls geeignete Habitatstrukturen für die Zauneidechse vorhanden. Hier konnten allerdings keine Tiere nachgewiesen werden. Dies lässt sich gegebenenfalls auf die in diesem Bereich vorkommenden Katzen zurückführen (Abbildung 2), die Prädatoren der Zauneidechse darstellen. Die Katzen wurden von den Amerikanern auf dem Gelände zurück- gelassen und werden nun vom Tierheim durch aufgestellte Hütten bzw. Transportboxen no t- versorgt. Sollten in diesem Bereich Reptilien vorgekommen sein, so ist es möglich, dass diese nach dem Freilassen der Hauskatzen auf dem Gelände nun nicht mehr vorhanden sind. Das gleiche gilt für die Sportanlagen sowie das Umfeld der Sportanlagen. Hier i st von einem mitt- leren Habitatpotenzial für Zauneidechsen auszugehen. Nordöstlich der Sportanlagen im Teil- bereich 3 wurden ebenfalls Hütten bzw. Transportboxen für Katzen vorgefunden und es gelang kein Nachweis einer Zauneidechse. Es wird angenommen, dass sich die Habitatbedingungen für Reptilien nach Umsetzung des Bebauungsplans verbessern, wenn die Gebäude wieder be- wohnt sind und sich die Anwohner um die Hauskatzen kümmern. Der Ausläufer des Teilbereichs 3 in Richtung Osten weist im Umfeld des Gleisbereichs und an der Böschung zur Straße ebenfalls Potenzial als Lebensraum für die Zauneidechse auf. Hier wurden mehrere Mäuselöcher im Boden gefunden, die von Zauneidechsen als Rückzugsort genutzt werden könnten. Nachweise von Zauneidechsen gelangen allerdings keine. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 21
Sie können auch lesen