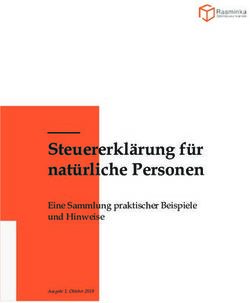BETRIEBS- UND INVESTITIONSKOSTEN-VERGLEICH DER ROLA, STAND 2007
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Betriebs- und Investitionskosten-
vergleich der RoLa, Stand 2007
Aktualisierung der Ecoplan-Studie „Betriebs-/Investitionskostenvergleich
zweier RoLa-Systeme“ aus dem Jahre 2003
im Auftrag des Bundesamts für Verkehr
Schlussbericht
9. März 2007
ECOPLAN
Forschung und Beratung CH - 3005 Bern, Thunstrasse 22 www.ecoplan.ch
in Wirtschaft und Politik CH - 6460 Altdorf, Postfach info@ecoplan.chImpressum
Empfohlene Zitierweise
Autor: Ecoplan
Titel: Betriebs- und Investitionskostenvergleich der RoLa, Stand 2007
Untertitel: Aktualisierung der Ecoplan-Studie „Betriebs-/Investitionskostenvergleich zweier RoLa-Systeme“
aus dem Jahre 2003
Auftraggeber: Bundesamt für Verkehr
Ort: Bern
Jahr: 2007
Bezug: Bundesamt für Verkehr
Begleitung seitens des Auftraggebers
Arnold Berndt (Leitung)
Christoph Schiess
Projektteam Ecoplan
André Müller (Projektleitung)
René Neuenschwander
Christoph Lieb
Der Bericht gibt die Auffassung der Autoren wieder, die nicht notwendigerweise mit derjenigen des Auftraggebers
oder der Begleitorgane übereinstimmen muss.
Ecoplan
Forschung und Beratung
in Wirtschaft und Politik
www.ecoplan.ch
Thunstrasse 22
CH - 3005 Bern
Tel +41 31 356 61 61
Fax +41 31 356 61 60
bern@ecoplan.ch
Postfach
CH - 6460 Altdorf
Tel +41 41 870 90 60
Fax +41 41 872 10 63
altdorf@ecoplan.chBetriebs- und Investitionskostenvergleich der RoLa, Stand 2007 ECOPLAN
Inhaltsverzeichnis
Management Summary............................................................................................................3
Abkürzungsverzeichnis...........................................................................................................6
1 Auftrag, Abgrenzung ...............................................................................................................7
2 Vorgehen und Methodik ..........................................................................................................9
2.1 Vorgehen....................................................................................................................................9
2.2 Methodik...................................................................................................................................11
3 Die vier RoLa-Hauptvarianten...............................................................................................13
3.1 Die vier untersuchten RoLa-Varianten im Überblick ................................................................13
3.2 Traktionskonzepte....................................................................................................................16
3.3 Fahr- und Terminalzeiten .........................................................................................................17
4 Annahmen zu den RoLa-Kosten...........................................................................................21
4.1 Trassenpreise...........................................................................................................................21
4.2 Rollmaterial: NT-Wagen und Begleitwagen .............................................................................23
4.3 Traktion ....................................................................................................................................25
4.3.1 Eigentraktion ............................................................................................................................25
4.3.2 Sensitivität: Fremdtraktion........................................................................................................27
4.4 Terminal ...................................................................................................................................28
4.5 Overhead..................................................................................................................................29
4.6 Infrastruktur ..............................................................................................................................30
5 Annahmen zu den RoLa-Erträgen ........................................................................................31
5.1 Nachfrage.................................................................................................................................31
5.2 RoLa-Preis ...............................................................................................................................34
5.3 Auslastung................................................................................................................................38
6 Resultate für die 4 RoLa-Hauptvarianten ............................................................................39
6.1 Prämissen ................................................................................................................................39
6.2 Wirtschaftlichkeitskennzahlen ..................................................................................................40
6.3 Erfolgsrechnung für ein typisches Jahr....................................................................................43
6.4 Planerfolgs- und Mittelflussrechnung über den gesamten Zeithorizont...................................46
6.5 Einfluss der Preise/Auslastung und Betriebstage auf Wirtschaftlichkeit..................................50
1Betriebs- und Investitionskostenvergleich der RoLa, Stand 2007 ECOPLAN
6.6 Zusammenfassende Einschätzung der Wirtschaftlichkeit .......................................................54
7 Sensitivitäten ..........................................................................................................................55
7.1 Lötschberg: mit/ohne Schiebedienst?......................................................................................55
7.2 Grösseres Stellplatzangebot bei ATB ......................................................................................56
7.3 Sensitivitäten weiterer Parameter ............................................................................................58
8 Vergleich mit Ecoplan-Studie 2003 ......................................................................................61
8.1 Änderungen bei den Annahmen: Kostenseite .........................................................................61
8.2 Änderungen bei den Annahmen: Ertragsseite .........................................................................62
8.3 Unterschiede zwischen Studien 2003 und 2007: Fazit............................................................63
9 Anhang A: Weitere zu beachtende Punkte..........................................................................64
10 Anhang B: Detailresultate und Berechnungen ...................................................................65
Literaturverzeichnis ...............................................................................................................78
2Management Summary ECOPLAN
Management Summary
Ausgangslage und Auftrag
Im Jahr 2003 hat Ecoplan für das Bundesamt für Verkehr (BAV) eine Studie zu einem Sys-
temvergleich zweier Systeme für die Rollende Landstrasse (RoLa) erstellt. Das Hauptergeb-
nis der Studie 2003 war, dass die Systemwahl – Bombardier oder Modalohr – bei einer
Grenze-zu-Grenze-RoLa bezüglich Rentabilität zweitrangig ist. Weiter wurde dargelegt, dass
unter den in der Studie 2003 vom BAV vorgegebenen Rahmenbedingungen eine RoLa von
Grenze zu Grenze wirtschaftlich ist, also ohne Subventionen betrieben werden kann.
Die Rahmenbedingungen haben sich seit 2003 geändert bzw. wurden in der Zwischenzeit
konkretisiert. Weiter wurden einige Annahmen der Studie 2003 kritisiert bzw. als nicht realis-
tisch eingestuft. Das Bundesamt für Verkehr hat Ecoplan beauftragt, die Studie 2003 für das
System Niesky (ehemals Bombardier) für ein Grenze-zu-Grenze-Angebot von 400'000 Stell-
plätzen zu aktualisieren. Dabei sind die in der Zwischenzeit geänderten Rahmenbedingungen
zu erheben und im Speziellen die kritisierten Annahmen mit Hilfe von Interviews mit Experten
(von SBB, BLS Cargo, Ralpin und Hupac) zu hinterfragen und allenfalls anzupassen. Das
aktualisierte Annahmenset, das dieser Studie zugrunde liegt, wurde vom BAV geprüft und
verabschiedet.
Ziel und Prämissen
Ziel dieser Aktualisierung ist es, die Wirtschaftlichkeit einer Grenze-zu-Grenze-RoLa von
400'000 Stellplätzen via Gotthard und via Lötschberg mit dem System Niesky (ehemals
Bombardier) zu untersuchen. Es ist uns und den Interviewpartnern ein grosses Anliegen,
dass klar und prominent dargelegt wird, welches die unterstellten Prämissen sind, die dieser
Studie zugrunde liegen. Die dargelegten Schlussfolgerungen gelten nur, wenn die nach-
folgend erwähnten Prämissen erfüllt sind.
• Terminalstandorte: Für die Wirtschaftlichkeitsberechnungen wurde unterstellt, dass sich
Terminals in Basel/Weil und in Domo II bzw. in Chiasso Smistamento bis zum Jahr 2013
realisieren lassen. Klar ist, dass die Standorte politisch sehr umstritten sind. Eine weitere
Studie hat sich der Standortfrage angenommen.
• Schiebedienst Domo–Brig: Der Schiebedienst Domo-Brig ist heute nicht zugelassen.
Versuche sind im Gange. Die Zulassung dieses Schiebediensts ist noch fraglich. In den
Berechnungen wird unterstellt, dass dieser Schiebedienst ab 2013 bewilligt ist.
• Zollvereinbarung: Es wird unterstellt, dass der RoLa-Verkehr im Rahmen einer Zollver-
einbarung als transitierender Verkehr anerkannt wird (auch für Chiasso Smistamento).
• Eckhöhe: Es ist unsicher, welcher Anteil der Lastwagen mit einem Ultra-Low-Floor-
Wagen aufgrund der Eckhöhenbeschränkung durch den Lötschberg und den Gotthard
transportiert werden kann. Es wird unterstellt, dass durch den Lötschberg beinahe alle
Lastwagen, aber durch den Gotthard nur rund 75% aller Lastwagen transportiert werden
können.
• Änderung Netzzugangsverordnung: Damit in den Jahren bis 2020 die schnellen Tras-
sen für die RoLa realisiert werden können und diese fahrplanmässig gesichert sind, muss
die Netzzugangsverordnung geändert werden. Der Infrastrukturbetreiber muss ermächtigt
3Management Summary ECOPLAN
werden, systematische Vorgaben zu den Betriebskonzepten im alpenquerenden Schie-
nengüterverkehr zu machen.
Folgerungen
Wir gehen davon aus, dass aus unternehmerischer Sicht die Eigenwirtschaftlichkeit gegeben
ist, wenn Rückzahlfristen von unter 15 Jahren und ein interner realer Zinssatz von 8% er-
reichbar sind. Die Eigenwirtschaftlichkeit einer RoLa von Grenze zu Grenze hängt von zu-
sätzlichen strassenseitigen Massnahmen ab. Wir unterscheiden zwei Situationen:
1) RoLa OHNE Alpentransitbörse (ATB) beim alpenquerenden Strassengüterverkehr
Eine Grenze-zu-Grenze-RoLa mit 320‘000 (Gotthard) bzw. 430‘000 (Lötschberg) Stellplätzen
kann ohne ATB aus unternehmerischer Sicht nicht eigenwirtschaftlich (aus Sicht einer
RoLa-Unternehmung, die das Risiko der Auslastung tragen muss) betrieben werden (Grenz-
fall: RoLa auf der Gotthardachse ab 2020, nach Inbetriebnahme Ceneri-Tunnel).
Die RoLa-Kosten belaufen sich bspw. beim Lötschberg mit den unterstellten Umlaufzeiten
(Fahrzeit von 4 h und Terminalzeit von 2 h) auf 425 bis maximal 485 CHF/Sendung. Ertrags-
seitig gehen wir davon aus, dass ohne Alpentransitbörse auf der Lötschbergstrecke ein Preis
von 450 CHF (inkl. MWST) ansetzbar ist und damit beim unterstellten Angebot eine Auslas-
tung von 75% erreicht werden kann. Ohne ATB wäre eine Subventionierung auf der Lötsch-
berg-RoLa von 35 CHF/Sendung nötig (unter ungünstigen Annahmen steigt die Subvention
bis auf 95 CHF/Sendung), diese ist deutlich tiefer als die heutige direkte Subventionierung
der bestehenden RoLa von Freiburg nach Novara mit 378 CHF/Sendung und der zusätzli-
chen indirekten Subventionierung über die Trassenpreise von rund 70 CHF/Sendung (gilt für
das Jahr 2006).
2) RoLa MIT Alpentransitbörse (ATB) beim alpenquerenden Strassengüterverkehr
Wie stark eine Alpentransitbörse den alpenquerenden Strassenverkehr verteuert, hängt von
vielen Faktoren ab. Eine RoLa mit einem Angebot von 400'000 Stellplätzen hätte selbstver-
ständlich auch einen Einfluss auf den Preis, den man für eine alpenquerende LKW-Fahrt an
der Alpentransitbörse bezahlen müsste. Es kann heute noch nicht abgeschätzt werden, wie
stark sich der alpenquerende Strassengütertransit verteuern wird. Wir gehen von einer – aus
heutiger Sicht – sehr vorsichtigen Schätzung von 100 CHF/Fahrt aus. Mit einer solchen ATB
kann eine Grenze-zu-Grenze-RoLa mit 320‘000 (Gotthard) bzw. 430‘000 Stellplätzen
(Lötschberg) eigenwirtschaftlich und ohne Subventionen betrieben werden.
Vergleich mit Studie 2003
Kostenseite: Die vorliegende Studie berechnet Kosten für eine RoLa am Lötschberg von
425 CHF/Sendung, was rund 50 CHF/Sendung höher liegt als in der Studie 2003 (375
CHF/Sendung). Diese Differenz ist auf folgende Punkte zurückzuführen:
• Die Rundlaufzeiten (Hin- und Herfahrt inkl. Terminalzeit) liegen um 2 bis 3 Stunden über
denjenigen der Studie 2003, die damals vom BAV vorgegeben wurden. Neben den höhe-
ren Fahrzeiten (insbesondere am Gotthard) wurden aber auch die Terminalstandzeiten
deutlich angehoben (in der Regel auf 2 Stunden).
4Management Summary ECOPLAN
• Die Traktionskonzepte sind deutlich teurer. So sind bei gleicher Traktion am Gotthard 20%
weniger Stellplätze möglich und am Lötschberg entfällt der Betriebswechselpunkt in der
Nähe Thun, was eine durchgängige Doppeltraktion von Basel nach Domo erfordert.
• Weiter wurden in der Studie 2003 die Terminalbetriebskosten zu optimistisch einge-
schätzt. Auch bei den Traktionskostenberechnungen werden heute leicht höhere Kosten
berechnet.
Ertragsseite: Die Studie 2003 rechnet mit einem erzielbaren RoLa-Preis von 530
CHF/Sendung am Gotthard und am Lötschberg. In der vorliegenden Studie gehen wir von
einem ansetzbaren RoLa-Preis von 450 am Lötschberg und 500 CHF/Sendung (inkl. MWST)
am Gotthard aus. Der tiefere Preis ist u.a. auf den durch die längeren Rundlaufzeiten resul-
tierenden 24h-Betrieb der RoLa (keine „Nachtabsenkung“) und auf die längeren Be- und Ent-
ladezeiten zurückzuführen.
Was die Studie nicht untersucht hat:
• Allfällige Kapazitätsengpässe im alpenquerenden Schienengüterverkehr bzw. allfällige Verdrängung
von Zügen für den unbegleiteten kombinierten Verkehr oder den Wagenladungsverkehr durch eine
ausgebaute RoLa wurden im Rahmen dieser Studie nicht untersucht. Zu beachten ist, dass bei
430‘000 Stellplätzen am Lötschberg alle insgesamt 48 SIM-Trassen (grossprofilige Trassen) durch
die RoLa besetzt werden, andere grossprofilige Güterverkehre werden verdrängt.
• Auch die Einbettung einer RoLa in ein Gesamtkonzept für den alpenquerenden Strassen- und
Schienengüterverkehr wurde nicht thematisiert (Stichworte dazu: Förderung des unbegleiteten kom-
binierten Verkehrs, Alpentransitbörse, usw.).
Was aus Sicht der Studienautoren näher zu prüfen wäre:
• RoLa nördlich Basel: Auftragsgemäss haben wir uns auf eine RoLa Grenze zu Grenze beschränkt.
Es wäre zu prüfen, ob ein Angebot Basel – Grenze Süd ergänzt mit einem Angebot nördlich Basel –
Grenze Süd rentabel betrieben werden könnte (Deutsche Seite ist u.U. auch wirtschaftlich interes-
sant). Vorteil: Verschiedene Märkte können erschlossen werden, mit längerer RoLa kann Ruhezeit
von 8h erreicht werden.
• Gigaliner: Gigaliner (lange, schwere Lastenzüge) können mit dem Niesky-Wagen nicht transportiert
werden. Es wäre zu prüfen, wie schnell und in welchem Ausmass sich Gigaliner im Nord-Süd-
Strassenverkehr durchsetzen und welche Folgen dies für die Wahl eines RoLa-Systems hätte.
• Eckhöhe: Welcher Anteil der künftig verkehrenden Lastwagen aufgrund der Eckhöhen durch Gott-
hard und Lötschberg transportiert werden kann, hängt von der Entwicklung des Lastwagenparks ab.
Entsprechend schwierig ist die Einschätzung. Eine vertiefte Analyse wäre zu empfehlen.
• Lange Züge: Lange Züge (>750m) können die Wirtschaftlichkeit einer RoLa verbessern. Ob sich
die Netzinfrastrukturinvestitionen zur Führung langer Züge von Basel nach Chiasso (500 Mio. CHF)
und von Basel nach Domo (850 Mio. CHF) rentieren, ist offen.
• Schnelle Trassen: Bis zum ZEB-Fahrplan (2020, nach Eröffnung Ceneri) wird mit schnellen Tras-
sen für die RoLa gerechnet. Ab 2020 werden „normale“ Gütertrassen für die RoLa unterstellt. Eine
Geschwindigkeitsoptimierung wurde für die Periode nach 2020 (ZEB-Fahrplan) nicht vorgenommen.
Schnellere Trassen nach 2020 verbessern die Wirtschaftlichkeit der RoLa. Dabei ist aber zu beach-
ten, dass schnelle RoLa-Trassen die Durchschnittsgeschwindigkeit des übrigen Schienengüterver-
kehrs vermindern. Ob und Inwieweit die Vorteile schneller Trassen bei der RoLa die Nachteile für
den übrigen Schienengüterverkehr überwiegen, wäre genauer zu prüfen.
5Abkürzungsverzeichnis ECOPLAN
Abkürzungsverzeichnis
ARE Bundesamt für Raumentwicklung
ATB Alpentransitbörse
BAV Bundesamt für Verkehr
BLS BLS Lötschbergbahn AG
Brtkm Bruttotonnenkilometer
CHF Schweizer Franken
Cm Zentimeter
EUR Euro
G Gotthard
H Stunde
Hupac Betreiber von UKV-Shuttlezügen der RoLa auf der Gotthardachse von Basel nach
Lugano und Singen nach Milano
Km/h Kilometer pro Stunde
L Lötschberg
Lkw Lastkraftwagen
LSVA Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe
M Meter
Mio. Million(en)
Mm Millimeter
Niesky WBN Waggonbau Niesky GmbH
Ntkm Nettotonnenkilometer
NT-Wagen Niederflur-Tragwagen
OSS OneStopShop, Trassenverkaufsstelle von SBB und BLS
Ralpin Betreiber der RoLa auf der Lötschbergachse von Freiburg im Breisgau nach Novara
RoLa Rollende Landstrasse
Rp. Rappen
SBB Schweizerische Bundesbahnen
SNCF Société Nationale des Chemins de fer Français
T Tonnen
UKV Unbegleiteter kombinierter Verkehr
WACC Weighted Average Cost of Capital
Wkm Wagenkilometer
ZEB Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur
61. Auftrag, Abgrenzung ECOPLAN
1 Auftrag, Abgrenzung
Ausgangslage und Auftrag
Im Jahr 2003 hat Ecoplan für das Bundesamt für Verkehr (BAV) eine Studie zu einem Sys-
temvergleich zweier Systeme für die Rollende Landstrasse (RoLa) erstellt.1 Das Hauptergeb-
nis der Studie 2003 war, dass die Systemwahl – Bombardier oder Modalohr – bei einer
Grenze-zu-Grenze-RoLa bezüglich Rentabilität zweitrangig ist. Weiter wurde dargelegt, dass
unter den in der Studie 2003 vom BAV vorgegebenen Rahmenbedingungen eine RoLa von
Grenze zu Grenze wirtschaftlich ist, also ohne Subventionen betrieben werden kann.
Die Rahmenbedingungen haben sich seit 2003 geändert bzw. wurden in der Zwischenzeit
konkretisiert. Weiter wurden einige Annahmen der Studie 2003 kritisiert bzw. als nicht realis-
tisch eingestuft. Das Bundesamt für Verkehr hat Ecoplan beauftragt, die Studie 2003 für das
System Niesky (ehemals Bombardier) für ein Grenze-zu-Grenze-Angebot von 400'000 Stell-
plätzen zu aktualisieren. Dabei sind die in der Zwischenzeit geänderten Rahmenbedingungen
zu erheben und im Speziellen die kritisierten Annahmen mit Hilfe von Interviews mit Experten
(von SBB, BLS Cargo, Ralpin und Hupac) zu hinterfragen und allenfalls anzupassen. Das
aktualisierte Annahmenset, das dieser Studie zugrunde liegt, wurde vom BAV geprüft und
verabschiedet.
Ziel der vorliegenden Studie
Ziel dieser Aktualisierung ist es, die Wirtschaftlichkeit einer Grenze-zu-Grenze-RoLa von
400'000 Stellplätzen via Gotthard und via Lötschberg mit dem System Niesky (ehemals
Bombardier) zu untersuchen.
Abgrenzung der vorliegenden Studie
Die vorliegende Studie macht Aussagen zur Eigenwirtschaftlichkeit einer nicht subventionier-
ten Grenze-zu-Grenze-RoLa. Die Studie äussert sich nicht zu folgenden zentralen Punkte:
• Eine Grenze-zu-Grenze-RoLa mit einem Stellplatzangebot von rund 400'000 Stellplätzen
benötigt ungefähr doppelt so viele Trassen wie die bestehenden RoLa-Verkehre von Ral-
pin und Hupac. Im Rahmen dieser Studie wurde nicht untersucht, ob sich dadurch Kapazi-
tätsengpässe im alpenquerenden Güterverkehr bzw. Verdrängungseffekte von WLV- oder
UKV-Zügen ergeben. Eine umfassende Beurteilung einer Grenze-zu-Grenze-RoLa muss
solche allfälligen Kapazitätsengpässe berücksichtigen.
• Die Feststellung, dass eine Grenze-zu-Grenze-RoLa eigenwirtschaftlich betrieben werden
kann, bedeutet nicht, dass eine solche RoLa in einem Gesamtkonzept für den alpenque-
renden Güterverkehr eine sinnvolle Lösung ist. Eine Einbettung einer RoLa in ein Ge-
samtkonzept für den alpenquerenden Güterverkehr (UKV-Förderung, LSVA, ATB, usw.)
wird in der vorliegenden Studie nicht vorgenommen.
1
Ecoplan (2003), Betriebs- und Investitionskostenvergleich zweier RoLa-Systeme.
71. Auftrag, Abgrenzung ECOPLAN
Vorliegende Studienresultate nur gültig unter bestimmten Prämissen
Es ist den Autoren dieser Studie und den Interviewpartnern ein grosses Anliegen, dass die
nachfolgend hergeleiteten Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen nur unter ganz bestimmten Prä-
missen gelten. Inwieweit diese Prämissen (Terminalstandorte müssen umsetzbar sein,
Schiebedienst muss zugelassen werden, usw.) auch tatsächlich umgesetzt werden können,
ist umstritten. Insbesondere bei den Terminalstandorten (v.a. bei Domodossola) gibt es gros-
se Vorbehalte.
Es war nicht Auftrag von Ecoplan, diese Prämissen auf ihre Umsetzbarkeit hin zu überprüfen.
Im Sinne einer möglichst transparenten Darstellung haben wir die – aus unserer Sicht –
wichtigsten Prämissen zu Beginn der Besprechung der Resultate (Kapitel 6) prominent aus-
gebreitet.
Ergänzende Analysen und Studien: Terminals und Fahrzeiten
Neben der vorliegenden Wirtschaftlichkeitsstudie wurde vom BAV eine Machbarkeitsstudie
zu den Terminals bei Rapp Infra in Auftrag gegeben.2 Weiter wurden die SBB beauftragt3, auf
Basis des Fahrplan 2008, eine Beschleunigung ausgewählter Gütertrassen zu prüfen und
mögliche erreichbare Fahrzeiten für einen Zeithorizont ab 2013 herzuleiten. Weiter wurden
von den SBB auch die Fahrzeiten für den Zeithorizont nach der Eröffnung von Gotthard- und
Ceneri-Basistunnel berechnet (basierend auf dem ZEB-Fahrplan, ZEB = Zukünftige Entwick-
lung der Bahninfrastruktur).
Aufbau der Studie
Das Vorgehen und die Methodik lehnen sich an die Ecoplan-Studie 2003 an. Das nachfol-
gende Kapitel 2 gibt einen kurzen Überblick. Für Details zur Methodik sei auf die Ecoplan-
Studie 2003 verwiesen. Das Kapitel 3 zeigt die vier untersuchten Hauptvarianten einer Gren-
ze-zu-Grenze-RoLa. Die für die Berechnung der RoLa-Wirtschaftlichkeit unterstellten An-
nahmen werden in Kapitel 4 (Annahmen zur Kostenseite) und 5 (Annahmen zur Ertragsseite)
erläutert. Die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit für die vier Hauptvarianten einer Grenze-zu-
Grenze-RoLa ist in Kapitel 6 zu finden. Inwieweit die Resultate der vier Hauptvarianten unter
anderen Annahmen immer noch gültig sind, zeigt Kapitel 7 (Sensitivitäten). Kapitel 8 bietet
einen Vergleich der vorliegenden Studie mit der Studie 2003 und führt die Unterschiede in
den Kosten und Erträgen auf die geänderten Annahmen bzw. auf die seit 2003 geänderten
Rahmenbedingungen zurück. In den Gesprächen mit den Interviewpartnern sind weitere
Punkte aufgetaucht, welche die Wirtschaftlichkeit einer RoLa beeinflussen können. Diese
weiteren Punkte werden im Kapitel 9 kurz diskutiert.
2
Rapp Infra (2007), Raumplanerische und verkehrstechnische Machbarkeit von leistungsfähigen RoLa – Termi-
nals im Raum Basel und Domodossola/Chiasso. Folienpräsentation, 26.1.2007.
3
SBB (2007), Ausbau Rollende Landstrasse, Studie SBB. Folienpräsentation, 26.1.2007.
82. Vorgehen und Methodik ECOPLAN
2 Vorgehen und Methodik
2.1 Vorgehen
Ziel der hier vorliegenden Studie ist die Aktualisierung der Ecoplan-Studie „Betriebs- und
Investitionskostenanalyse zweier RoLa-Systeme“ aus dem Jahre 2003 für ein Angebot in der
Grössenordnung von 400'000 Stellplätzen pro Jahr von Grenze zu Grenze. Auf den in der
Ecoplan-Studie 2003 enthaltenen Vergleich der beiden Systeme Modalohr und Bombardier
wird verzichtet und beispielhaft das System mit dem Niederflurwagen Bombardier/Niesky
berechnet. Die Kernpunkte der Aktualisierung orientieren sich an den Hauptkritikpunkten zur
Ecoplan-Studie 2003 und sind:
• Trassenbelegung/Umläufe/Fahrzeiten: Wird als Input von BAV bzw. SBB/SMA zur Verfü-
gung gestellt. Zwei Varianten stehen im Vordergrund: Trassenbelegung auf Basis des
heutigen Fahrplans und ein auf die RoLa optimierter Fahrplan
• Kosten für Rollmaterialunterhalt
• Anforderungen an Pünktlichkeit und daraus abgeleitete einkalkulierte Reserve-Stand-
zeiten (Be- und Entladezeiten mit Reserven)
• Reservehaltung (Niederflurwagen, Loks und Begleitwagen)
• Berechnung der Terminal- und Traktionskosten
Neben diesen Kernpunkten wurden alle wesentlichen Annahmen überprüft. Wertvolle Infor-
mationen haben uns die folgenden Interviewpartner bereit gestellt:
• Ralpin4 René Dancet, Geschäftsführer Ralpin
• Hupac5 Simone Croci-Torti, Business Manager Rollende Autobahn, Hupac
• SBB Martin Simioni, Projektleiter ZEB
Christoph Frei, CRM-G SBB
Joachim Joos, Strategische Planung SBBC
Vertreter der Firma SMA6 (Herren Rey und Frei) im Auftrag der SBB
• BLS Cargo Joachim Schöpfer, Produktion, Einkauf
Christina Spenninger, Produktmanagerin Kombinierter Verkehr
• OSS7 Jürg Fankhauser, Trassenverkauf SBB I
Marco Faita, Trassenverkauf SBB/BLS
• Niesky 8
Bertram Wieloch, Leiter Vertrieb (schriftliche Rückmeldung)
4
Siehe nachfolgender Exkurs
5
Siehe nachfolgender Exkurs
6
SMA und Partner AG, Unternehmens-, Verkehrs- und Betriebsplaner, Zürich.
7
OSS – OneStopShop, Trassenverkaufsstelle der SBB und BLS
92. Vorgehen und Methodik ECOPLAN
Die konstruktive Mitarbeit sei an dieser Stelle herzlich verdankt.
Die basierend auf den Interviews aktualisierten Annahmen wurden dem BAV vorgelegt. Die
Annahmen sowie die unterstellten Prämissen wurden vom BAV verabschiedet. Basierend auf
den nachfolgend ausgeführten Annahmen und Prämissen wurde eine Wirtschaftlichkeits-
rechnung durchgeführt.
Exkurs: Firmenkurzportrait Ralpin und Hupac9
Ralpin
Betreiber der RoLa auf der Lötschbergachse von Freiburg im Breisgau nach Novara
Gegründet 2001
Aktienkapital CHF 300’000
Aktionäre: BLS Lötschbergbahn AG, Hupac AG, SBB AG, Trenitalia SpA
Rollmaterial: Die Ralpin besitzt kein eigenes Rollmaterial. Wagen gemietet von HUPAC, Traktion einge-
kauft.
Mitarbeiter: Organisation erst im Aufbau (Sitzverlegung nach Olten)
Verkehr 2005: 20 Züge pro Tag (Lötschbergstrecke), 79’248 Strassensendungen, 1,5 Mio. Nettotonnen
Hupac
Betreiber von UKV-Shuttlezügen der RoLa auf der Gotthardachse von Basel nach Lugano und von
Singen nach Milano.
Gegründet 1967
Aktienkapital: CHF 20 Mio., aufgeteilt auf 98 Aktionäre
Kapitalstruktur: 72% Logistik- und Transportunternehmen, 28% Bahnen
Rollmaterial: 4’425 Bahnwaggons, 13 Strecken- bzw. Manöverlokomotiven
Mitarbeiter: 359, davon 130 in der Schweiz
Verkehr
- Shuttle Net (UKV): 97 Shuttlezüge pro Tag, 591’169 Strassensendungen, 10,4 Mio. Nettotonnen
- RoLa (Gotthardstrecke): 6 Züge pro Tag, 21’319 Strassensendungen, 0,4 Mio. Nettotonnen
8
WBN Waggonbau Niesky GmbH in Sachsen (D). Herstellter des in dieser Studie exemplarisch unterstellten
RoLa-Wagens (8achs. Niederflurwagen – Typ Saadkms "Rollende Landstrasse").
9
Quelle: www.ralpin.ch, www.hupac.ch
102. Vorgehen und Methodik ECOPLAN
2.2 Methodik
Für die Berechnung der Wirtschaftlichkeit einer Grenze-zu-Grenze-RoLa wenden wir diesel-
be Methodik an, wie sie schon in der Ecoplan-Studie 2003 unterstellt wurde. Die Kritik an der
Ecoplan-Studie 2003 bezog sich alleine auf die Annahmen bzw. die unterstellten Prämissen
und nicht auf die Methodik.
Grundannahmen
Die zentralen Grundannahmen können wie folgt zusammengefasst werden:
• Unternehmerische Sicht (ganze RoLa aus einer Hand): Es wird eine unternehmerische
und keine volkswirtschaftliche Sicht unterstellt. Es wird die Wirtschaftlichkeit einer RoLa
von Grenze zu Grenze aus Sicht eines RoLa-Unternehmens, das das gesamte Angebot
aus einer Hand anbietet, untersucht.
Allfällige Ausfälle bei den LSVA-Einnahmen werden hier nicht berücksichtigt. Auch die
Veränderungen in den externen Kosten (bspw. Luftbelastung im alpenquerenden Korri-
dor) werden nicht ins Wirtschaftlichkeitskalkül miteinbezogen.
• Früheste Inbetriebnahme der Grenze-zu-Grenze-RoLa im Jahre 2013: Aufgrund der rela-
tiv langen Realisierungszeit der Terminals wird davon ausgegangen, dass eine Grenze-
zu-Grenze-RoLa frühestens im Jahre 2013 starten könnte.
• Für die Wirtschaftlichkeitsberechnung wird ein Zeithorizont von 25 Jahren (2013 bis 2038)
unterstellt. Dabei wird berücksichtigt, dass der Gotthard Basistunnel per 2017 und der
Ceneri-Tunnel per 2020 voll operativ sein werden.
• Weiter wird unterstellt, dass für die RoLa-Züge ab 2013 keine Trassenpreissubventionen
(sowohl auf dem Mindestpreis wie auf dem Deckungsbeitrag) mehr gewährt werden.
Dynamische Investitionsrechnung
Die Bestimmung der Eigenwirtschaftlichkeit der RoLa erfolgt mittels einer dynamischen In-
vestitionsrechnung. Diese erlaubt einen Vergleich von Kosten und Erträgen, die zu verschie-
denen Zeitpunkten in der Zukunft anfallen. Es werden folgende Wirtschaftlichkeitskennzah-
len ausgewiesen:
• Nettobarwert
• Nutzen-Kosten-Verhältnis
• Interner Zinssatz
• Eigenkapitalrendite
• Rückzahlfrist
Zur Berechnung der Wirtschaftlichkeitskennzahlen müssen zusätzliche Annahmen zu Eigen-
und Fremdkapitalanteil sowie zum Eigen- und Fremdkapitalzins getroffen werden. Wir gehen
davon aus, dass die Investitionen in Rollmaterial und Terminals von privaten Betreibern getä-
112. Vorgehen und Methodik ECOPLAN
tigt werden. Deren Kapitalkosten veranschlagen wir auf nominal 6 Prozent für das Fremdka-
pital und nominal 9 Prozent für das Eigenkapital.10 Bei einer Eigenkapitalquote von 30 Pro-
zent und einer durchschnittlichen Inflationsrate von 2 Prozent ergibt sich so ein durchschnitt-
licher Realzinssatz von 4.9 Prozent.11
Erfolgsrechnung für ein typisches Betriebsjahr
Die dargestellten Wirtschaftlichkeitskennzahlen basieren auf einer detaillierten Erfassung
aller Kosten und Erträge über die Jahre 2013 bis 2038, unter Beachtung eines allfälligen
Restwerts im Jahre 2038 und einer Einführungsphase mit geringeren Erträgen in den ersten
Jahren. Anhand eines typischen Betriebsjahrs (nach der Einführungsphase, vor den ersten
Ersatzinvestitionen) werden die Erträge und die Kosten dargestellt. Interessant sind hier die
einzelnen Kostenblöcke und der Vergleich von ausgewählten Kostenkennzahlen mit Kenn-
zahlen von anderen Bahnunternehmungen (bspw. bei der Traktion bzw. bei den Terminalkos-
ten).
Planerfolgsrechnung
Im Rahmen einer Planerfolgsrechnung wird die Entwicklung der Gewinne unter vorgegebe-
nen Finanzierungsrestriktionen (Rückzahlung der Darlehen innerhalb 15 Jahre) dargestellt.
Mit Hilfe dieser einfachen, hypothetischen Berechnung kann dargestellt werden, ab wann
Gewinne anfallen, die für Reinvestitionen bzw. Gewinnausschüttungen an die Aktionäre zur
Verfügung stehen.
Mittelflussrechnung
Mit Hilfe einer einfachen Mittelflussrechnung wird aufgezeigt, welchen Netto-Cashflow das
RoLa-Unternehmen unter bestimmten Finanzierungsrestriktionen hat. Zusätzlich wird auch
die Verschuldungssituation dargestellt.
Sensitivitäten
Die Berechnungen werden anhand von vier Hauptvarianten (vgl. nachfolgendes Kapitel)
durchgeführt. Die „Stabilität“ der Ergebnisse und die daraus zu ziehenden Schlussfolgerun-
gen werden im Rahmen einer Sensitivitätsbetrachtung (vgl. Kapitel 6.5 und 7) behandelt.
Weitere, detailliertere Erläuterungen zur Methodik sind bei der Darstellung der Resultate im
Kapitel 6 zu finden.
10
Der angenommene Zinssatz für Fremdkapital ist gemäss Auskunft von Bankenvertretern realistisch für grosse
Investitionsprojekte in der Schweiz.
11
Entspricht dem WACC –Weighted Average Cost of Capital
123. Die vier RoLa-Hauptvarianten ECOPLAN
3 Die vier RoLa-Hauptvarianten
3.1 Die vier untersuchten RoLa-Varianten im Überblick
Auftragsgemäss soll eine RoLa von Grenze zu Grenze mit einer Kapazität von rund 400'000
Stellplätzen untersucht werden. Eine RoLa Grenze zu Grenze kann auf der Lötschberg- und /
oder der Gotthardachse geführt werden. Es werden vier RoLa-Hauptvarianten untersucht, die
ein attraktives stündliches Angebot Grenze zu Grenze zur Verfügung stellen sollen:
• L1: RoLa auf Lötschbergachse (Basel-Domo) ab 2013 mit 430‘000 Stellplätzen mit durch-
gängiger Doppeltraktion und Schiebedienst zwischen Domo und Brig (Schiebedienst für
solche Züge heute noch nicht zugelassen)
• G2: RoLa auf Gotthardachse (Basel-Chiasso) ab 2013 mit 310‘000 Stellplätzen mit durch-
gängiger Doppeltraktion ohne Schiebedienst, ab 2020 mit 320‘000 Stellplätzen mit Ein-
fachtraktion
• LG1_400: RoLa je zur Hälfte auf der Gotthard- und Lötschbergachse
Lötschbergachse: ab 2013 mit 215‘000 Stellplätzen mit durchgängiger Doppeltraktion und
Schiebedienst zwischen Domo und Brig (Schiebedienst für solche Züge heute noch nicht
zugelassen), Gotthardachse: ab 2020 zusätzlich mit 215‘000 Stellplätzen mit durchgängi-
ger Doppeltraktion ohne Schiebedienst
• G2_ab2020: RoLa auf Gotthardachse erst ab 2020 mit 320‘000 Stellplätzen mit Einfach-
traktion
Grafik 3-1: Die vier RoLa-Hauptvarianten im Überblick
Variante L1 Basel Variante G2 Basel
Stündliche Abfahrt
Basel und Domo ab 2013 Stündliche Abfahrt
430‘000 Stellplätze/Jahr Basel und Chiasso ab 2013
320‘000 Stellplätze/Jahr
Domodossola Domodossola
Chiasso Chiasso
Variante LG1_400 Variante G2_ab2020
Basel Basel
Stündliche Abfahrt ab Basel
zweistündlich ab Chiasso und
Domo ab 2013
430‘‘000 Stellplätze/Jahr
Stündliche Abfahrt
Basel und Chiasso ab 2020
320‘000 Stellplätze/Jahr
Domodossola Domodossola
Chiasso Chiasso
133. Die vier RoLa-Hauptvarianten ECOPLAN
Die nachfolgende Grafik zeigt, zu welchem Zeitpunkt welche Anzahl Stellplätze angeboten
wird (L steht für RoLa-Varianten via Lötschbergachse, G für RoLa-Varianten via Gotthard-
achse).
Grafik 3-2: Stellplatzangebot der vier RoLa-Hauptvarianten
Angebotene Stellplätze nach Varianten, bei 280 Betriebstagen
500'000
450'000 L1
400'000
G2
350'000
LG1_400
300'000
250'000 G2_ab2020
200'000
150'000
100'000
50'000
0
2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025
Jahr
Motivation für die Wahl der vier RoLa-Hauptvarianten
Die vier oben präsentierten RoLa-Hauptvarianten sind aus wirtschaftlicher Sicht optimierte
Varianten, welche die Vorgabe einer Grenze-zu-Grenze-RoLa mit 400'000 Stellplätzen nur
ungefähr einhalten können. Nachfolgend zeigen wir auf, wieso diese Varianten so definiert
wurden.
L1: Angebot von 430'000 Stellplätzen auf der Lötschbergachse
Auf der Lötschbergachse können gemäss Angaben der SBB – vorbehältlich der Zulassung
des Schiebediensts Domo-Brig – RoLa-Züge mit einer maximalen Länge von 750m und einer
maximalen Traktionsmasse von 1800 Tonnen verkehren. Mit dem unterstellten Rollmaterial12
können Züge mit 32 Stellplätzen geführt werden (vgl. Tabelle 3-3 für Details zur RoLa-
Zugskomposition und zum Traktionskonzept). Wir unterstellen ein attraktives stündliches
Angebot Nord-Süd und Süd-Nord. Insgesamt werden also täglich 2*24 RoLa-Züge geführt,
total also 48 Trassen durch RoLa-Züge auf der Lötschbergachse besetzt. Wird die Ausdün-
12
Niesky, 8achs. Niederflurwagen – Typ Saadkms "Rollende Landstrasse"
143. Die vier RoLa-Hauptvarianten ECOPLAN
nung über das Wochenende und an weiteren Schwachlasttagen (von Freitag bis Sonntag,
bzw. Feiertagen) berücksichtigt, ergeben sich – umgerechnet auf Volllasttage – rund 280
Betriebstage (vgl. dazu die Ausführungen im Kapitel 5.3). Pro Jahr ergibt dies ein Angebot
von rund 430'000 Stellplätzen.13
G2: Angebot von 320'000 Stellplätzen auf der Gotthardachse
Die Lötschbergachse hat den Vorteil, dass sie hochprofiligen Verkehr aufnehmen kann. Da-
mit ist das Nachfragepotenzial für die RoLa auf der Lötschbergachse grösser als auf der
Gotthardachse, da auf der Gotthardachse nur Lastwagen bis zu einer bestimmten Eckhöhe
(vgl. dazu die Ausführungen im Kapitel 5.1) mit einer RoLa transportiert werden können. Um
die Vergleichbarkeit der beiden RoLa-Varianten via Lötschberg- und Gotthardachse zu er-
leichtern, gehen wir davon aus, dass anteilmässig in etwa gleich viel des vorhandenen Nach-
fragepotenzials auf die RoLa verlagert wird. Wir schätzen, dass das Nachfragepotenzial am
Gotthard aufgrund der Beschränkungen bei den Eckhöhen rund 25% tiefer liegt. Ein zum
Lötschberg vergleichbares Angebot am Gotthard läge also etwa bei 320'000 Stellplätzen.
Wird auf der Gotthardachse ein Stellplatzangebot von 320'000 angepeilt, so kann dies bei
einem stündlichen Angebot Nord-Süd und Süd-Nord nach Eröffnung von Gotthard- und Ce-
neri-Basistunnel mit einer Einfachtraktion (das heisst also, nur einer Lok pro Zug) erbracht
werden. Pro Zug werden 24 Stellplätze angeboten (vgl. Tabelle 3-3 für Details zur RoLa-
Zugskomposition und zum Traktionskonzept).
Bis zur Eröffnung von Gotthard- und Ceneri-Basistunnel (also von 2013 bis 2020) kann mit
dem langfristig eingeplanten Wagenmaterial kein wirtschaftlich optimales Konzept gefahren
werden, da die Fahrzeiten in dieser Zeit länger sind. Wird das stündliche Angebot beibehal-
ten und mit dem langfristig eingeplanten Wagenmaterial gefahren, so sind die Züge kürzer
und leichter als es technisch grundsätzlich möglich wäre.14
LG1_400: 430'000 Stellplätze, je zur Hälfte via Gotthard- und Lötschbergachse
Mit dieser Variante wird die RoLa auf die Gotthard- und Lötschbergachse aufgeteilt. Die Ro-
La wird ab 2013 mit einem zweistündlichen Angebot auf der Lötschbergachse zwischen Ba-
sel und Domo gestartet. Nach der Eröffnung des Gotthard- und Ceneri-Basistunnels im Jahr
2020 wird ebenfalls ein zweistündliches Angebot von Basel nach Chiasso gefahren. Damit
ergeben sich in Basel stündliche Abfahrten, in den südlichen Terminals Chiasso und Domo
zweistündliche. Insgesamt wird so ein Angebot von 430'000 Stellplätzen ab dem Jahr 2020
zur Verfügung gestellt.
13
48 Züge à 32 Stellplätzen während rechnerisch 280 Volllast-Betriebstagen.
14
Technisch wären auf der Gotthardachse vor Eröffnung des Gotthard- und Ceneri- Basistunnels Zugskompositio-
nen mit 25, statt wie hier unterstellt 23, Stellplätzen möglich. Würde diese technische Grenze ausgereizt, wäre für
die Periode 2013 bis 2020 mehr Wagenmaterial zu beschaffen als langfristig nötig. Dies wurde aber hier nicht
unterstellt, da die RoLa-Wagen nicht anderweitig eingesetzt oder umgerüstet und auch kaum weiterverkauft wer-
den können.
153. Die vier RoLa-Hauptvarianten ECOPLAN
G2_ab2020: Gotthard-RoLa nach Eröffnung des Gotthard- und Ceneri-Basistunnels
Da bis zur Eröffnung von Gotthard- und Ceneri-Basistunnel auf der Gotthardachse aus be-
trieblicher Sicht keine optimalen Umläufe erzielt werden können, wird in dieser Variante un-
terstellt, dass die RoLa auf der Gotthardachse erst nach der Eröffnung der beiden neuen
Tunnel in Betrieb genommen wird.
3.2 Traktionskonzepte
Für die Festlegung der Traktionskonzepte (siehe Tabelle 3-3) müssen gemäss SBB folgende
Rahmenbedingungen eingehalten werden:
• Die Trassen wurden hinsichtlich der Fahrzeiten optimiert (vgl. nächstes Kapitel). Diese
schnellen Trassen können nur durch den Verzicht auf betriebliche Zwischenhalte erreicht
werden. Dies bedeutet bspw., dass auf der Lötschbergachse die gesamte Strecke Basel-
Domo mit Doppeltraktion (zwei Loks pro Zug) gefahren werden muss (kein Betriebswech-
selpunkt in der Nähe von Thun).
• Auf der Lötschbergachse können mit der Piattaforma Sempione II (ca. ab 2014)15 Zugs-
längen von maximal 750m gefahren werden. Aufgrund der Steigung von Domo bis Brig
kann mit einer Doppeltraktion allerdings maximal eine Traktionsmasse von 1300 Tonnen
erreicht werden. Damit auf der Lötschbergachse RoLa-Züge mit 32 Stellplätzen angebo-
ten werden können, ist ein Schiebedienst zwischen Domo und Brig nötig. Ein Schiebe-
dienst ist heute noch nicht zugelassen.16
• Auf der Gotthardachse sind bis zur Eröffnung des Gotthard- und Ceneri-Basistunnels nur
Züge mit einer Länge von maximal 640m und einer maximalen Traktionsmasse von 1400
Tonnen bei Doppeltraktion möglich. Nach der Eröffnung des Gotthard- und Ceneri-
Basistunnels können mit einer Doppeltraktion RoLa-Züge bis zu einer Maximallänge von
750m geführt werden. Mit einer Einfachtraktion können RoLa-Züge bis 1300 t Traktions-
masse geführt werden, was einer Zugslänge von rund 510m entspricht.
Unter Berücksichtigung obiger Rahmenbedingungen ergeben sich für die vier RoLa-
Hauptvarianten folgende wirtschaftlich sinnvolle Traktionskonzepte:
• L1: Doppeltraktion und Schiebedienst zwischen Domo und Brig (Schiebedienst für solche
Züge heute noch nicht zugelassen), Zugslänge 714m, max. Traktionsmasse: 1760 t (vgl.
auch Fussnote 16)
• G2: 2013 bis 2019: durchgängige Doppeltraktion ohne Schiebedienst, Zugslänge 513m,
max. Traktionsmasse: 1248 t
15
Vereinfachend haben wir unterstellt, dass bereits ab 2013 Zugslängen von 750m möglich sind. Allerdings haben
wir eine Einführungsphase mit geringeren Auslastungen unterstellt, die sich u.U. auch mit kürzeren Zügen errei-
chen lässt.
16
Der Schiebedienst ist ab Frühling 2007 möglich, allerdings nur für Lasten bis 1'600 Bruttotonnen. Höhere Zugs-
gewichte sind noch nicht möglich, die Zulassung dürfte kritisch sein (Anmerkung: die in der Berechnung maximal
unterstellte Traktionsmasse beträgt 1'760 Bruttotonnen).
163. Die vier RoLa-Hauptvarianten ECOPLAN
ab 2020: Einfachtraktion ohne Schiebedienst, Zugslänge 514m, max. Traktionsmasse:
1300 t
• LG1_400: Lötschbergachse: Doppeltraktion und Schiebedienst zwischen Domo und Brig
(Schiebedienst für solche Züge heute noch nicht zugelassen), Zugslänge 714m, max.
Traktionsmasse: 1760 t
Gotthardachse: Doppeltraktion ohne Schiebedienst, Zugslänge 714m, max. Traktions-
masse: 1760 t
• G2_ab2020: Einfachtraktion ohne Schiebedienst, Zugslänge 514m, max. Traktionsmasse:
1300 t
3.3 Fahr- und Terminalzeiten
Fahrzeiten
Die SBB haben auf Basis des Fahrplans 2008 die Möglichkeit von schnelleren Trassen un-
tersucht. Gemäss SBB sind für die Realisierung von beschleunigten Trassen systematische
Vorgaben der Infrastrukturbetreiber für die Betriebskonzepte nötig. Dazu müsste die heutige
Netzzugangsverordnung angepasst werden.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die von den SBB (bzw. von der SMA im Auftrag der SBB)
berechneten Fahrzeiten für schnelle Trassen. Die Fahrzeiten können am Lötschberg unter 4
Stunden gedrückt werden, am Gotthard sind vor Eröffnung von Gotthard- und Ceneri-
Basistunnel Fahrzeiten von 4.6 Stunden erreichbar.
Im ZEB-Fahrplan (also nach Eröffnung von Gotthard- und Ceneri-Basistunnel) können für
normale Gütertrassen, Fahrzeiten von knapp über 4 Stunden erreicht werden. Die Beschleu-
nigungspotenziale im ZEB-Fahrplan wurden nicht abgeschätzt.
Tabelle 3-1: Fahrzeitenvergleich Gotthard und Lötschberg
Annahmen 2007 (SBB)
Durchschn. Zeit für einen
Fahrzeit Geschw. Terminal- vollständigen
Streckenlänge (km) (h) (km/h) zeit (h) Umlauf (h)
Lötschberg Bs-DomoII: 2013 bis 2019,
beschleunigte Trasse 253 3.85 66 2.15 12
Lötschberg Bs-DomoII: ab 2020 (ZEB),
normale Gütertrasse 253 4.25 60 1.75 12
Gotthard ohne GBT, ohne Ceneri: 2013 bis 2019,
beschleunigte Trasse 281 4.60 61 1.90 13
Gotthard mit GBT, mit Ceneri: ab 2020 (ZEB),
normale Gütertrasse 281 4.35 65 1.65 12
173. Die vier RoLa-Hauptvarianten ECOPLAN
Terminalzeiten
Die für einen stabilen Betrieb kürzest mögliche Terminalzeit kann auf 1 ½ Stunden geschätzt
werden.17 Sie setzt sich wie folgt zusammen:
Tabelle 3-2: Heutige und die minimal einzuhaltende Terminalzeit
Optimierte, minimale
Terminalzeiten mit 2-
Heutige Terminalzeiten Modulzug (2*16
bei 21 NT-Wagen *) Stellplätzen)
[Minuten] [Minuten]
Entladezeit (ab Zugseinfahrt, inkl. Rangierung etc.): 30 22
Technische Kontrolle der leeren Kompositionen (je nach
45 30
Personal-Einsatz 30 bis 60 Minuten, inkl. Hauptbremsprobe)
Beladeprozess 30 22
Lok anhängen, Zusatzbremsprobe, Bremszettel usw.: 15 15
Total 120 89
*) gemäss Angaben Ralpin und Hupac
Längere Terminalzeiten von bspw. 2 Stunden erhöhen die Zuverlässigkeit, die für das hier
unterstellte stündliche Angebot unabdingbar ist. Für die beschleunigten Trassen ergeben sich
genügend lange Terminalzeiten von gut 2 Stunden am Lötschberg und knapp 2 Stunden am
Gotthard. Bei den normalen Gütertrassen im ZEB-Fahrplan ergeben sich Terminalzeiten von
1.65 Stunden (Gotthard) bzw. 1.75 Stunden (Lötschberg). Durch verschiedene Massnahmen
(bspw. Einsatz von mehreren Visiteuren, ständige Reservehaltung eines vollständiges Er-
satzzuges im nördlichen und südlichen Terminal) sollte auch bei diesen Terminalzeiten die
Zuverlässigkeit garantiert sein. Alternativ können auch im ZEB-Fahrplan die RoLa-Trassen
beschleunigt werden, damit die Terminalzeiten über 2 Stunden betragen.
Umlaufzeiten
Die obige Tabelle 3-1 zeigt, dass mit den erreichbaren Fahr- und Terminalzeiten Umlaufzei-
ten von 12 Stunden am Lötschberg erreicht werden können. Am Gotthard kann dagegen erst
nach Eröffnung des Gotthard- und Ceneri-Basistunnels eine Umlaufzeit von 12 Stunden rea-
lisiert werden. Bis zum Jahre 2020 muss am Gotthard mit Umlaufzeiten von 13 Stunden ge-
rechnet werden, dies trotz beschleunigten Trassen.
Die beiden folgenden Tabellen fassen die Annahmen zur Traktion (Tabelle 3-3) und zu den
Fahrzeiten, dem Stellplatzangebot und dem benötigten Rollmaterial (Tabelle 3-4) zusammen.
17
Sie liegt damit deutlich höher als noch in der Ecoplan-Studie 2003 geschätzt. In der Ecoplan-Studie 2003 wurde
mit Terminalzeiten von 1 Stunde gerechnet.
18Variantenbezeichnung L1 G2 LG1_400 G2_ab2020
Zeitperiode Lötschberg ab Gotthard 2013 Gotthard mit Lötschberg ab Gotthard mit Gottlard mit
Tabelle 3-3:
2013 bis 2019 Ceneri ab 2020 2013 Ceneri ab 2020 Ceneri ab 2020
Traktionskonzept durchgängige durchgängige durchgängige durchgängige
Doppeltraktion Doppeltraktion Einfachtraktion Doppeltraktion Doppeltraktion Einfachtraktion
3. Die vier RoLa-Hauptvarianten
mit ohne ohne mit ohne ohne
Schiebedienst Schiebedienst Schiebedienst Schiebedienst Schiebedienst Schiebedienst
von Basel Weil Basel Weil Basel Weil Basel Weil Basel Weil Basel Weil
nach Domo II Chiasso Chiasso Domo II Chiasso Chiasso
Strecke Berg bzw. GBT
LBT ohne Ceneri GBT mit Ceneri LBT GBT mit Ceneri GBT mit Ceneri
19
Schiebedienst Domo II - Brig Domo II - Brig
nur S-N keiner keiner nur S-N keiner keiner
Länge des Zugs (m) 714 513 514 714 714 514
Traktionskonzepte der 4 RoLa-Hauptvarianten
Maximale Traktionsmasse (t) 1'760 1'248 1'300 1'760 1'760 1'300
Anzahl Stellplätze / Zug 32 23 24 32 32 24
Anzahl Begleitwagen / Zug 2 1 1 2 2 1
Anzahl Loks / Zug 2 2 1 2 2 1
ECOPLANVariantenbezeichnung L1 G2 LG1_400 G2_ab2020
Zeitperiode Lötschberg ab Gotthard 2013 Gotthard mit Lötschberg ab Gotthard mit Gotthard mit
Tabelle 3-4:
2013 bis 2019 Ceneri ab 2020 2013 Ceneri ab 2020 Ceneri ab 2020
Fahrzeit, Anzahl Züge, Angebotene Stellplätze
Zeit für 1 Rundlauf (h) 12 13 12 12 12 12
3. Die vier RoLa-Hauptvarianten
Züge pro Richtung 24 24 24 12 12 24
Züge pro Tag 48 48 48 24 24 48
Betriebstage 280 280 280 280 280 280
Angebotene Stellplätze 430'080 309'120 322'560 215'040 215'040 322'560
Rollmaterialeinsatz
Kompositionen im Einsatz 12 13 12 6 6 12
20
Je 1 Reserve Nord/Süd 2 2 2 2 1 2
Total Kompositionen im Einsatz 14 15 14 8 7 14
Zu beschaffendes Rollmaterial (inkl. Reserve und Schiebeloks)
Niederflurwagen 470 362 352 268 235 352
Loks (inkl. Schiebedienst) 40 38 18 23 18 18
Begleitwagen 35 19 18 20 18 18
Fahrzeiten/Stellplatzangebot/Rollmaterial der 4 RoLa-Hauptvarianten
ECOPLAN4. Annahmen zu den RoLa-Kosten ECOPLAN
4 Annahmen zu den RoLa-Kosten
Die nachfolgenden Ausführungen fassen die zentralen Annahmen zu den Kosten einer RoLa
zusammen.
4.1 Trassenpreise
Die von uns verwendeten Trassenpreise sind in untenstehender Tabelle ersichtlich. Sie ent-
sprechen dem aktuellen Leistungskatalog Infrastruktur BLS/SBB18. Die darauf aufbauende
Trassenpreisberechnung wurde uns vom OneStopShop der BLS/SBB19 zur Verfügung ge-
stellt.
Tabelle 4-1: Annahmen zu den Trassenpreisen
Trassenpreiskomponente 2007 2013 2017 2020 Bezugsgrösse
Fahrdienst 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 CHF pro Zugkm
Unterhalt Kunde *) 0.0010 0.0025 0.0025 0.0025 CHF pro Btkm
Unterhalt BAV 0.0015 CHF pro Btkm
Energiedienstleistung 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 CHF pro Zugkm
Energie SBB (Ferngüterzug) 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 CHF pro Btkm
Energie BLS (Ferngüterzug) **) 0.0026 0.0025 0.0025 0.0025 CHF pro Btkm
Energie Lokzüge 0.0044 0.0044 0.0044 0.0044 CHF pro Btkm
DB SBB Kunde (Nto) *) 0.0000 0.0052 0.0052 0.0052 CHF pro Ntkm
DB SBB BAV (Nto) 0.0052 CHF pro Ntkm
DB BLS Kunde (Bto) *) 0.0000 0.0035 0.0035 0.0035 CHF pro Btkm
DB BLS BAV (Bto) 0.0035 CHF pro Btkm
SIM-Zuschlag (ab 2007: Grossprofil-Zuschlag) 300 300 300 300 CHF pro Zug
Knoten klein 3 3 3 3 CHF pro Knoten klein
Knoten gross 5 5 5 5 CHF pro Knoten gross
Basistunnel Zuschlag Lötschberg ***) n.n.b. 144 144 144 CHF pro Zug
Basistunnel Zuschlag Gotthard ***) - - 420 420 CHF pro Zug
Basistunnel Zuschlag Ceneri ***) - - - 79 CHF pro Zug
*) keine Subventionen mehr
**) Für die Berechnungen wurde der prov. Stand der Trassenpreise vom Oktober 2006 zu Grunde gelegt. Die Kosten für
Energie BLS (Ferngüterzüge) liegt für 2007 noch leicht über denjenigen der SBB.
***) Basistunnelzuschlag entspricht dem Streckenausgleich zwischen Berg- und Basisstrecke. Frühester Termin für die
Bekanntgabe des Basistunnelzuschlags am Lötschberg ist Juni 2007. Ob der Basistunnelzuschlag eingeführt wird und
wie er genau ausgestaltet ist, ist noch offen.
Vereinfachung: Strecke Iselle-Domo wird mit Schweizer Trassenpreisen berechnet.
Bei der Festlegung der ab 2013 für die Wirtschaftlichkeitsberechnung zu unterstellenden
Trassenpreise wurden folgende Annahmen getroffen:
18
BLS/SBB (2006), Ausführungsbestimmungen zum Leistungskatalog Infrastruktur 2007 (10. Dezember 2006 bis
14. Dezember 2007).
19
Herren Fankhauser und Faita.
214. Annahmen zu den RoLa-Kosten ECOPLAN
• Ausgangslage ist das Trassenpreissystem 2007: Mit Ausnahme der nachfolgend erwähn-
ten Trassenpreiskomponenten entsprechen die ab 2013 angesetzten Trassenpreise den
Preisen von 2007.
• Keine Trassenpreissubventionen mehr: Die Trassenpreissubventionen entfallen sowohl
auf dem Mindestpreis (Unterhalt Kunde) wie auch auf dem Deckungsbeitrag.
• Für den Lötschberg-, Gotthard- und Ceneri-Basistunnel wurde ein spezieller Basistunnel-
zuschlag angesetzt, der den Streckenausgleich zwischen Berg- und Basisstrecke aus-
gleicht. Damit zahlen Züge zwischen Thun und Brig in etwa gleich hohe Trassenpreise,
unabhängig davon ob sie durch den Basistunnel oder über die Scheitelstrecke verkehren.
Für den Lötschberg wurde dieser Basistunnelzuschlag auf 144 CHF/Zug veranschlagt.20
Wird das Verfahren zur Berechnung des Basistunnelzuschlags am Lötschberg auf Gott-
hard und Ceneri angewandt, so ergeben sich Zuschläge von 420 resp. 79 CHF pro Zug.
Für die Berechnung der Kosten wurden folgende Annahmen unterstellt:
• Für die Berechnung der Trassenpreise massgebliche Streckenlängen auf der Gotthard-
achse von Basel/Weil nach Chiasso
– Auf der Gotthard-Bergstrecke: 319 km
– Mit Gotthard-Basistunnel: 287 km
– Mit Gotthard- und Ceneri-Basistunnel: 281 km
• Für die Berechnung der Trassenpreise massgebliche Streckenlängen auf der Lötschberg-
achse von Basel/Weil nach Domo II
– Mit Lötschberg-Basistunnel: 253 km
– Davon auf BLS-Netz: 60 km
– Strecke mit Schiebelok (Domo II – Brig) 46 km
Weiter wurde auf der Lötschbergachse unterstellt, dass für den kurzen italienischen Stre-
ckenabschnitt mit Schweizer Trassenpreisen gerechnet werden kann (Annahme zur Ver-
einfachung der Berechnungen).
20
Ecoplan (2005), Lötschberg Basis- und Scheitelstrecke: Umsetzung Trassenpreisstrategie und Vorschlag der
BLS Infrastruktur für ihre Umsetzung. Bern.
22Sie können auch lesen