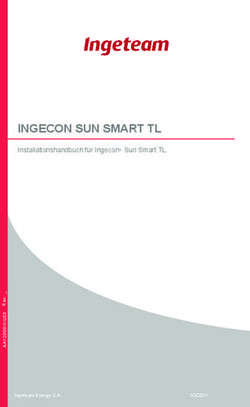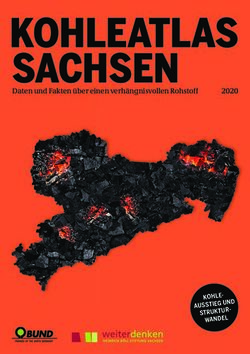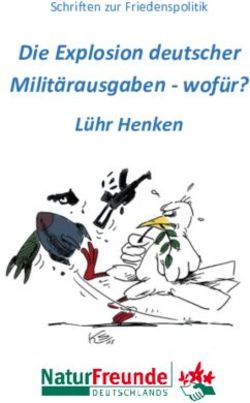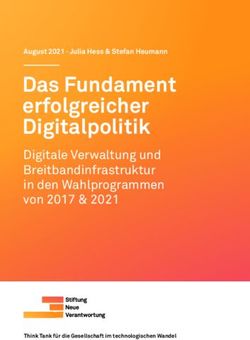DAS UNGENUTZTE POTENZIAL - Vier Hebel für mehr Wachstum in Nordrhein-Westfalen Düsseldorf, April 2017 - Boston Consulting Group
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Inhaltsverzeichnis
1. Zusammenfassung 1
2. Ein zukunftsfähiger Haushalt 3
3. Das verschenkte Talent 14
4. Die Innovationslücke 23
5. Das Infrastrukturdefizit 28
Abbildungsverzeichnis 34
Quellenverzeichnis 35
Inhalt I1. Zusammenfassung
Nordrhein-Westfalen (NRW) kämpft seit Jahrzehnten mit hohen Schulden, hoher Arbeitslosigkeit
und mäßigem Wirtschaftswachstum. Betrachtet man den Zeitraum seit dem Jahr 2000, belegt
NRW bei diesen Indikatoren einen der letzten Plätze unter den Flächenländern. Zwar erholte sich
NRW von der Wachstumsdelle des Jahres 2015 (0,8 %) und erreichte im Folgejahr mit 1,8 % ein
beinahe durchschnittliches Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP)1, doch ist auch 2017 die
Nettoneuverschuldung mit über 1,6 Mrd. Euro immer noch höher als die aller anderen
Bundesländer zusammen.2
NRW hat großes Potenzial, das es aber nicht vollständig nutzt. Durch die Realisierung von vier
Ansätzen kann ein zusätzliches Wachstum des BIP von mehr als 38 Mrd. Euro realisiert werden:
10 Mrd. Euro durch die bessere Integration von Frauen, Absolventen von MINT-Studiengängen
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) sowie Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt;
16 Mrd. Euro durch die Steigerung der Investitionen in Forschung und Entwicklung auf das Niveau
der führenden Bundesländer und 12 Mrd. Euro durch höhere Infrastrukturausgaben in den
Bereichen Straßenverkehr und Breitbandversorgung. Wesentliche Voraussetzung ist eine echte
Trendwende in der Haushaltpolitik, um Investitionen und Schuldenabbau gleichermaßen zu
verwirklichen.
Wenn es gelingt, dieses Potenzial zu nutzen, würde dies eine Steigerung des nordrhein-westfälischen
BIP des Jahres 2016 um 6 % bedeuten. NRW hätte das Potenzial, damit die derzeitige Wachstums-
lücke gegenüber Bayern und Baden-Württemberg zu schließen.
1
Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen
2017, 72.
2
Die Summe der Nettoneuverschuldung der anderen 15 Bundesländer beläuft sich in 2017 auf 1,1 Mrd. Euro.
12. Ein zukunftsfähiger Haushalt
Investitionen sind die entscheidende Voraussetzung für Wirtschaftswachstum, weil sie
Innovationen ermöglichen und dadurch die Produktivität erhöhen. Indirekt können sie durch die
Steigerung der Beschäftigung, die Senkung der Langzeitarbeitslosigkeit, die Anhebung der
Staatseinnahmen und insbesondere die Verringerung der Schulden außerdem zu mehr
Generationen- und Verteilungsgerechtigkeit beitragen.3 Die Expertenkommission "Stärkung von
Investitionen in Deutschland" im Auftrag des Bundesministers für Wirtschaft und Energie hat zudem
auf die hohe Komplementarität von öffentlichen und privaten Investitionen hingewiesen: Öffentliche
Investitionen tragen dazu bei, attraktive Rahmenbedingungen für private Investitionen zu
schaffen.4
Die Einhaltung einer Schuldenbremse muss keineswegs dazu führen, dass Investitionen noch weiter
eingeschränkt werden. Schulden- und Investitionsvorgaben gehören vielmehr zusammen wie
zwei Seiten einer Medaille, um Wachstum zu ermöglichen.5 Auch die Bundesregierung setzt in ihrem
aktuellen Zehn-Punkte-Plan für inklusives Wachstum auf Investitionen, indem fiskalische Spielräume
durch Mehreinnahmen zur Steigerung der Bruttoinvestitionsquote eingesetzt werden. "Vorrang für
Investitionen ist erforderlich, damit Deutschland nicht von der Substanz zulasten künftiger
Generationen lebt."6
3
Krebs und Scheffel 2016, 2 und 6.
4
Expertenkommission 2015, 5.
5
Bertelsmann Stiftung 2017.
6
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 2017, 2.
3Steigende Verschuldung und eine schwache wirtschaftliche Entwicklung
Die Verschuldung von NRW ist seit 1974 kontinuierlich gewachsen und belief sich im Jahr 2015
auf fast 138 Mrd. Euro – eine Summe, die laut der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2019
auf 142 Mrd. Euro steigen soll. Diese Zahl bildet allerdings nur den Kernhaushalt des Landes ab.
Nimmt man alle Sonderhaushalte und Eventualverbindlichkeiten (z. B. den Bau- und
Liegenschaftsbetrieb des Landes sowie die Garantien aus der Abwicklung der WestLB) hinzu, steigt
die Zahl noch einmal drastisch auf 194 Mrd. Euro (2015).
Auch die Zinsbelastung pro Kopf lag 2015 mit 231 Euro pro Einwohner deutlich über dem Durch-
schnitt der alten Flächenländer von 197 Euro.7 2015 belief sich der Schuldenstand pro Einwohner
in NRW auf ca. 7.800 Euro und lag damit, wie schon seit über einem Jahrzehnt, deutlich über dem
Durchschnitt der Bundesländer.8
Hohe öffentliche Schulden gehen in der Regel langfristig mit schwachem Wirtschaftswachstum
einher.9 NRW erwirtschaftete 2015 mit 646 Mrd. Euro über ein Fünftel der gesamten Wirtschafts-
leistung Deutschlands. Pro Kopf der Einwohner erreichte es aber im Vergleich zu den anderen
Bundesländern nur ein unterdurchschnittliches BIP i. H. v. 36.500 Euro.10 Gesamtwirtschaftlich wird
NRW außerdem von einer überdurchschnittlich hohen Arbeitslosenquote von 7,6 % (März 2017)
geprägt.11 Insgesamt erreichte NRW im IW-Regionalranking 2016 nur den drittletzten Platz vor
Bremen und Sachsen-Anhalt.12 Offenbar versprechen andere Standorte bessere Bedingungen, auch
wenn NRW für Direktinvestitionen aus dem Ausland und für Start-ups in der Digitalwirtschaft
durchaus attraktiv zu sein scheint.13
7
Landesrechnungshof 2016, 70 f.
8
Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen 2016, A 109.
9
Bertelsmann Stiftung 2015, 10.
10
Wesentliche Gründe sind die relative Schwäche der Industrie und der Exportwirtschaft, siehe Ministerium
für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen 2017, 80 ff.
11
Auch die Investitionsquote von 8,3 % (Anteil der Bruttoanlageinvestitionen am BIP, 2015) lag unter dem
Länderdurchschnitt.
12
Hentze 2016, 7.
13
IW Consult GmbH 2017.
4Der überforderte Landeshaushalt
Seit 2010 ist NRW ein sogenanntes Nehmerland nach der bisherigen Methode des Länderfinanz-
ausgleichs, hat also durchgängig Ausgleichszahlungen und Bundesergänzungszuweisungen
erhalten.14 Diese Entwicklung ist Ausdruck der langsam, aber stetig schwindenden Finanzkraft
NRWs. Lag die Finanzkraftmesszahl bis 2009 stets über 100 %, so ist sie mittlerweile unter die 97-%-
Marke gefallen.15
Dabei gibt NRW trotz des hohen Schuldenstandes immer noch überdurchschnittlich viel Geld aus,
wenn man die nicht kurzfristig beeinflussbaren Zins- und Versorgungslasten sowie Investitionen aus
der Betrachtung ausklammert. Der Betrag dieser eingesetzten Haushaltsmittel (der "verfügbaren
Finanzmassen") von 3.500 Euro pro Einwohner lag 2015 über 7 % höher als der Durchschnitt der
alten Flächenländer.16 NRW hat also im Vergleich zu anderen Bundesländern in den letzten Jahren
trotz hoher Steuereinnahmen und der herannahenden Schuldenbremse nicht gespart. Die
vom Landesrechnungshof angemahnte konsequente Haushaltskonsolidierung wurde weiter hinaus-
geschoben.17
14
Landesrechnungshof 2016, 37.
15
Schrödter 2016, 165. Die Finanzkraftmesszahl vergleicht das Steueraufkommen pro Einwohner (aus anteili-
gen Gemeinschaftssteuern und Landessteuern nach örtlichem Aufkommen) mit dem Durchschnittswert
aller Länder.
16
PwC 2016, 160.
17
Landesrechnungshof 2016, 9.
5Abbildung 2: Die Schulden von NRW steigen trotz sinkender
Nettokreditaufnahme kontinuierlich
1. Für 2016 Zahlen laut Haushaltsplanung. Tatsächliche erreichte NRW 2016 einen außerplanmäßigen Haushaltsüberschuss von 217 Mio. EUR
Anmerkung: Schuldendienst ohne nicht veranschlagte Tilgung; Daten beziehen sich auf den Kernhaushalt; Daten in jeweiligen Preisen
Quelle: Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen. 2016. Finanzplanung 2016 bis 2020 mit Finanzbericht 2017. Landtagsdrucksache 16/12501
NRW hat als eines der letzten Bundesländer kurz vor dem Ende der laufenden Wahlperiode am
6. April 2017 ein einfaches Landesgesetz zur Regelung der Schuldenbremse beschlossen.18 NRW
gehört damit zu den letzten Ländern, die die grundgesetzliche Schuldenbremse (Artikel 109 Abs. 3
Satz 1 GG) in das Landesrecht übernommen haben, und zur Minderheit derjenigen Länder, die sich
gegen eine Verankerung der Schuldenbremse in der Landesverfassung entschieden haben.19 Der
Landesrechnungshof und die große Mehrheit der Gutachter hatten sich für eine solche Verankerung
18
Viertes Gesetz zur Änderung der Landeshaushaltsordnung – Umsetzung der grundgesetzlichen Schulden-
regel in das nordrhein-westfälische Landesrecht, Landtagsdrucksache 16/13315.
19
Matz 2016, 16 f.
6eingesetzt.20 Auch die Bundesbank forderte schon 2012 angesichts der Föderalismusreform "eine
grundlegende Neuorientierung in der Haushaltspolitik, die noch immer häufig eher darauf
ausgerichtet scheint, den rechtlich vorhandenen Verschuldungsspielraum weitgehend auszunutzen –
und diesen bei Bedarf zudem weit auszulegen."21
Die nun getroffene Regelung gewährt der Landesregierung einen vergleichsweise großen Spielraum,
um das ab 2020 geltende Verbot der Neuverschuldung zu umgehen.22 Sie stellt es durch
weitgefasste Formulierungen hauptsächlich in das Ermessen des Finanzministers zu beurteilen, ob
eine Ausnahmesituation vorliegt, die auch in Zukunft eine Kreditaufnahme rechtfertigt. Der Landtag
hat ein Mitwirkungsrecht; das Klagerecht der Opposition gegen den Landeshaushalt, das noch
2011 und 2013 angesichts der Höhe der Neuverschuldung zur Feststellung von Verfassungsverstößen
führte, entfällt dagegen.23 Darüber hinaus enthält das neue Gesetz auch keine konsequente Regelung
zur Rückführung bestehender Schulden und bezieht die ausgelagerten Sonderhaushalte entgegen
den Empfehlungen der Bundesbank nicht mit ein.24
Das Investitionsdefizit
NRW liegt mit einer Investitionsquote25 zwischen 8,3 % (2015) und 8,8 % (2016) deutlich unter dem
Durchschnitt der Bundesländer von 9,8 % (2015) und klar hinter Bayern mit 10,5 % (2015). Die
Investitionen pro Einwohner lagen 2015 in NRW bei 318 Euro, in Bayern mit 688 Euro sogar bei
mehr als dem Doppelten.26 Die öffentlichen Investitionen NRWs sind zudem nicht nur
unterdurchschnittlich, sondern weisen einen langfristigen negativen Trend auf. 2016 gehörte NRW
sogar zu den drei Ländern mit dem größten Rückgang der Investitionsquote.27
20
Hierzu gab es am 20. April 2015 und am 24. Januar 2017 öffentliche Anhörungen im Landtag. Zur
dezidierten Auffassung des Landesrechnungshofes siehe Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen 2015,
69.
21
Deutsche Bundesbank 2012, 51.
22
Landesrechnungshof 2017, 2 ff.
23
Radiobeitrag von Wolfgang Otto im WDR 5 Morgenecho, "Rot-Grün plant die Schuldenbremse light",
vom 24. Januar 2017.
24
Deutsche Bundesbank 2012, 46.
25
Anteil der Investitionen an den bereinigten Gesamtausgaben des Landes.
26
PwC 2016, 35.
27
Hentze 2017, 2.
7Abbildung 3: Die Investitionsquote des Landes NRW liegt unter dem
Durchschnitt und fällt immer weiter
1. Gemäß Haushaltsplan bzw. mittelfristiger Finanzplanung
Anmerkung: Investitionsquote ist der Anteil der Investitionsausgaben an den bereinigten Gesamtausgaben
(Ausgaben ohne besondere Finanzierungsvorgänge); Angaben beziehen sich auf den Kernhaushalt
8Die anderen Haushaltsbereiche sind im Vergleich überproportional gewachsen; das gilt
insbesondere für die Personalausgaben, die seit 2012 wieder stark zunehmen. Zum planmäßigen
Wachstum von durchschnittlich über 3 % pro Jahr im Zeitraum von 2012 bis 2019 kommen allein
2015 und 2016 rund 8.000 zusätzliche Stellen aus Nachtragshaushalten, die zuletzt mit
unvorhergesehenen Handlungsbedarfen in den Bereichen Flüchtlinge sowie innere Sicherheit und
Bildung (insbesondere Inklusion) begründet wurden. Damit erreicht die Gesamtzahl der Stellen im
Landesdienst mit ca. 293.000 den höchsten Stand seit 2006.28 Während die Zuweisungen und
Zuschüsse in erster Linie den Kommunen zugutekommen, handelt es sich bei den Verwaltungs- und
Personalausgaben um Strukturkosten, die zum Teil – etwa in Form von Versorgungsaufwand –
später auch noch Folgekosten nach sich ziehen.
Der Landeshaushalt als Profiteur aktuell günstiger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen
NRW profitiert ebenso wie andere Bundesländer massiv von den außergewöhnlich guten gesamt-
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland in den letzten Jahren: eine sehr gute
Beschäftigungslage, Rekordsteuereinnahmen, ein sehr geringes Zinsniveau und ein durch den Euro
begünstigtes Exportklima. Allein die erhöhten Steuermehreinnahmen und die Zinsminderausgaben
belaufen sich von 2012 bis zum Planjahr 2017 in NRW auf über 43 Mrd. Euro mehr finanziellen
Spielraum. Dem steht eine Absenkung der Neuverschuldung um nur knapp 14 Mrd. Euro
gegenüber.29
Zusätzlich finden sich im Haushalt Sondereffekte. So wurde zum Beispiel der Bau- und Liegen-
schaftsbetrieb (BLB) zu einer vorgezogenen Sondertilgung eines Landesdarlehens veranlasst, obwohl
dessen Zinssatz über den Marktkonditionen lag.30 Diese Spielräume wurden jedoch kaum zu einer
Konsolidierung des Haushaltes und neuer Investitionstätigkeit genutzt.
28
Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen 2016, 44, und Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen 2015,
44.
29
BCG-Analyse..
30
Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen 2016, 40.
9Der Ausblick: Mittelfristige Haushaltrisiken
Laut der offiziellen mittelfristigen Finanzplanung des Landes Nordrhein-Westfalen wird ein
ausgeglichener Haushalt im Jahr 2020 erreicht und damit die Schuldenbremse eingehalten. Dabei
rechnet die Finanzplanung mit weiterhin günstigen Rahmenbedingungen bis 2020: kontinuierlich
stark steigende Steuereinnahmen um durchschnittlich 3,5% im Jahr, eine sehr gute
Beschäftigungslage sowie eine weitere leichte Verringerung der Zinsausgaben. 31
Diese
optimistischen Annahmen implizieren aber zugleich wesentliche Risiken in einem Szenario, bei
dem sich die volkswirtschaftliche Gesamtlage verschlechtert.
31
Landtag Nordrhein-Westfalen 2016
10Würde das Wachstum des nominalen BIP gegenüber dem hohen Planwert für 2020 (+2,9 %) um
1,5 Prozentpunkte zurückbleiben, so würden auch die Steuereinnahmen um ca. 4 Mrd. Euro geringer
ausfallen als geplant.32 Eine solche verminderte Wachstumsrate, die in den letzten 20 Jahren allein
sechs Mal unterschritten wurde33, ergibt sich zum Beispiel schon dann, wenn die nordrhein-
westfälische Wirtschaft nur ihr langfristiges durchschnittliches Wachstum erreicht und darüber
hinaus außenwirtschaftliche Risiken eintreten, wie sie für den Brexit prognostiziert werden.
Würde außerdem das Zinsniveau gegenüber 2016 nur um 1 Prozentpunkt dauerhaft steigen, lägen
die Zinsausgaben langfristig um 1,4 Mrd. höher als für 2020 geplant.34 Und würde schließlich das
durchschnittliche Wachstum der Personalausgaben von 2016-2020 gegenüber der mittelfristigen
Planung nur um 0,5 Prozentpunkte steigen, wie es in den letzten beiden Jahren der Fall war, ergäbe
sich gegenüber der Planung ein Mehrbedarf von ~700 Mio. €. Diese drei Abweichungen zusammen
wären theoretisch bereits so hoch wie das gesamte Investitionsbudget des Landes im Planjahr 2020.
32
BCG-Analyse auf Basis der in der mittelfristigen Finanzplanung des Landes NRW angegebenen Annahmen
sowie der Compound Annual Growth Rate (CAGR) der Steuereinnahmen der Planung 2016-2020
33
Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2017. Zum Brexit-Risiko für die deutsche Wirtschaft siehe
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) 2016. Zu weiteren wahrscheinlichen
außenwirtschaftlichen Risiken siehe die Zusammenfassung "Wachstum 2017 – Viele Risiken für
Konjunktur" in der Rheinischen Post vom 25. Januar 2017.
34
Landesrechnungshof 2016, 65. Dieser Zinsanstieg auf nominell ca. 3 % entspräche einer Normalisierung der
Renditen auf inländische Schuldverschreibungen der öffentlichen Hand auf das Durchschnittsniveau der
letzten zehn Jahre. Siehe hierzu die entsprechenden Zeitreihen der Bundesbank, abrufbar auf
https://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Statistiken/Zeitreihen_Datenbanken/Makrooekonomische_Zeit
reihen/its_details_value_node.html?https=1&https=1&https=1&https=1&https=1&https=1&tsId=BBK01.WT0
004&dateSelect=2011.
11Abbildung 4: Drei Haushaltrisiken könnten den Spielraum für Investitionen
komplett auslöschen
1. Durch Erhöhung des Zinsniveaus um 1 Prozentpunkt werden ~1,4 Mrd. EUR höhere Zinsausgaben ggü. der Planung notwendig, Angaben laut
Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen 2015
Quellen: BCG-Analyse; Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen. 2016. Finanzplanung 2016 bis 2020 mit Finanzbericht 2017. Landtagsdrucksache
16/12501; Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen. 2015. Jahresbericht 2015
Über den Zeitraum bis 2020 hinaus gefährden mittelfristig insbesondere die Zuweisungen und
Zuschüsse sowie Personalausgaben den Spielraum für Investitionen. Aufgrund der demografischen
Entwicklung sind die Versorgungsausgaben in den letzten Jahren sehr stark gewachsen und
betragen jetzt schon über 10 % der bereinigten Gesamtausgaben und über ein Drittel der
Personalausgaben. Das Wachstum wird sich fortsetzen und soll seinen Höhepunkt im Jahr 2027
erreichen, wenn die Zahl der Versorgungsberechtigten mit über 226.000 prognostiziert wird. Die
jährlichen Versorgungsausgaben werden dann ca. 7,7 Mrd. Euro betragen, die größtenteils aus dem
laufenden Haushalt bestritten werden müssen.35 In Zukunft werden die Rückstellungen aus den
beiden Sondervermögen im Pensionsfonds des Landes zusammengefasst, dem ab 2018 jährlich nur
35
Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen 2016, 38.
12noch 200 Mio. Euro aus dem Landeshaushalt zugeführt werden. Hierzu stellte der
Landesrechnungshof fest: "Die verminderten Zuführungen an den Pensionsfonds gewährleisten
jedenfalls keine auch nur annähernd ausreichende Vorsorge für die Beamtenpensionen."36
Erschwerend kommt hinzu, dass der aktuelle Versorgungsbericht aus methodischen Gründen
immer noch auf der Projektion des Jahres 2011 beruht, die den starken, zum außerplanmäßig über
Nachtragshaushalte beschlossenen Personalaufwuchs der letzten Jahre noch nicht berücksichtigt.
Weiterhin blendet er die wahrscheinlichen Lohnsteigerungen und Inflationsausgleiche aus.37 Die
Enquêtekommission des Landtags zur "Bewertung der Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte
in Nordrhein-Westfalen unter den Bedingungen der Schuldenbremse und des demografischen
Wandels in der Dekade 2020 bis 2030" warnte 2015 vor einer "Stellenexpansion ohne ausreichende
Vorsorge". Die Kommission hielt sogar eine Kürzung der Beamtenplanstellen um 15 % bis 20 % bis
2030 für geboten, um den Personalkörper auf das finanzierbare Maß zurückzuführen.38
Handlungsempfehlungen für die Landesfinanzen
Erhöhung der Investitionsquote im Landeshaushalt mindestens auf das Durchschnittsniveau aller
Bundesländer von ca. 10 %
Verankerung der grundgesetzlichen Schuldenbremse in der Landesverfassung als wirksamstes
Instrument für eine Haushaltskonsolidierung
Realistische Haushaltsplanung auf Basis von belastbaren Risikoszenarien
Stopp des überproportionalen Anstiegs der Personalausgaben und deren mittelfristige Senkung
Erhöhung der jährlichen Einzahlungen in den neuen Pensionsfonds des Landes mindestens bis
zum Niveau der früheren Versorgungssondervermögen
36
Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen 2016, 48.
37
Hentze 2016, 3. Er liefert ein Rechenbeispiel, wonach eine jährliche Erhöhung der Pensionen um 2 % bis
2040 zu einer kumulierten nominalen Mehrbelastung des Landeshaushalts um 42 Mrd. Euro führen würde.
38
Landtag NRW Enquêtekommission 2015, 116.
133. Das verschenkte Talent
Laut Industrie- und Handelskammer NRW klaffen im Land seit Jahren die Nachfrage und das
Angebot von qualifizierten Fachkräften auseinander. Diese Unterversorgung des Arbeitsmarktes
wird sich in den nächsten Jahren in vielen Branchen dramatisch verschärfen.39 Erfolgt keine
Änderung des Status quo, so prognostiziert BCG in der Studie "Die halbierte Generation", dass im
Jahr 2020 in NRW 40.000 Arbeitskräfte fehlen werden.40
Auf der anderen Seite verfügt NRW über qualifizierte Humanressourcen, deren Potenzial heute
nicht hinreichend genutzt wird. Eine bessere Mobilisierung der vorhandenen Talente könnte wesent-
lich zur Sicherung der wirtschaftlichen Zukunftsfähigkeit des Landes beitragen. Das betrifft in
besonderem Maße Hochschulabsolventen.41 Weiterhin sind Frauen ein in der "Stillen Reserve" (nicht
erwerbstätig und nicht aktiv arbeitssuchend) überrepräsentierter Teil der Gesellschaft. Ähnlich
verspricht die Teilhabe von Flüchtlingen am nordrhein-westfälischen Arbeitsmarkt den
Fachkräftemangel mittelfristig abzuschwächen.
Bei erfolgreicher Aktivierung dieser drei Gruppen könnte NRW bis zu 168.000 zusätzliche Fachkräfte
mobilisieren. In NRW entspräche dies einer zusätzlichen Wertschöpfung (BIP) von über 10 Mrd.
Euro bzw. ca. 1,6 % des im Jahr 2015 erwirtschafteten BIP.
39
IHK NRW, 2017; ausgenommen juristische Berufe, bei denen es in den nächsten Jahren zu einem
zunehmenden Überangebot von Arbeitskräften kommen wird.
40
Bis 2030 könnte sich diese Lücke gar auf 1,0 und 1,5 Millionen ausweiten – ein Mangel, der das Land rund
90 Mrd. Euro an entgangener Wirtschaftsleistung kosten würde; BCG 2015, 3 und 9.
41
In einer Untersuchung regional-ökonomischer Effekte von Hochschulabsolventen in Bayern ermittelten
Kratz und Lenz, dass eine 1% Steigerung von Absolventen zu einer 0,135% Erhöhung der
Bruttowertschöpfung führt
14Die Abwanderung von Absolventen
Das einwohnerstärkste Bundesland NRW hat unter den Flächenländern die höchste Bevölkerungs-
dichte und auch die höchste Studierendendichte in Relation zur Einwohnerzahl.42 Doch nicht alle
Absolventen bleiben in NRW. Eine Langzeitstudie in Form des Absolventenpanels43 erlaubt
Rückschlüsse auf Wanderungsbewegungen von Absolventen innerhalb Deutschlands. Das ifo
Institut hat im Jahr 2015 ermittelt, dass jeder vierte Absolvent einer nordrhein-westfälischen
Hochschule das Bundesland zur Aufnahme des ersten Jobs verlässt. Wird der Beobachtungszeitraum
auf fünf Jahre nach Abschluss verlängert, erhöht sich die Binnenwanderungsquote sogar auf gut ein
Drittel (29,2 %)44 der nordrhein-westfälischen Absolventen.
Übertragen auf die Absolventenzahlen des Jahres 2015 ergibt dies eine Abwanderung von ca.
25.000.45 Bis Ende 2020 werden über 4.300 weitere Absolventen des Jahrgangs das Bundesland
verlassen haben. Im Bereich der MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und
Technik) ergibt sich eine Abwanderungspopulation von nahezu 8.500, die sich bis 2020 auf ca. 10.000
erhöht.46 Bei der innerdeutschen Wanderung von Ingenieuren profitiert Bayern am meisten,
während NRW als größter Ausbilder und "Exporteur" auftritt.47 Wenn es gelänge, die
Standortattraktivität für Absolventen auf das Niveau Bayerns zu heben, könnte der Arbeitsmarkt in
NRW jährlich ca. 3.700 Hochqualifizierte, davon über 1.250 aus dem MINT-Bereich, dazugewinnen.
Dies würde zu einer spürbaren Entlastung eines in 2016 mit 20.000 offenen Akademikerstellen
unterversorgten MINT-Bereichs führen.48 Unter Absolventen wirtschaftsnaher Fachbereiche49 wäre
mit einer ähnlich großen Steigerung von über 1.200 zusätzlichen Hochqualifizierten zu rechnen, die
dem Arbeitsmarkt jährlich zusätzlich zur Verfügung stünden.
42
Statistisches Bundesamt 2017. Auf einen Studenten entfallen knapp 24 Einwohner, im Bundesschnitt rund
30 Einwohner. Basiert auf Bevölkerungsdaten vom 31. Dezember 2015 und Studentenzahlen für 2015/2016.
43
Langzeitstudie des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW).
44
Haußen und Übelmesser 2015, 44 und 46.
45
BCG-Analyse basierend auf NRW-Absolventenzahlen 2015 von Destatis; Wanderungsquoten durch das
ifo Institut ermittelt.
46
2014 verließen 95.961 Absolventen nordrhein-westfälische Hochschulen, davon 35.092 im MINT-Bereich.
47
Institut der Deutschen Wirtschaft (IW Köln) 2014; Untersuchungszeitraum: 2012.
48
Anger et al. 2017, 50.
49
Berücksichtigt betriebs- und volkswirtschaftliche sowie Managementabschlüsse.
15Als Hauptgründe für einen Wechsel des Bundeslandes nennen Absolventen vor allem bessere
Verdienst- und Aufstiegschancen.50 Mit besseren Karrierechancen für Hochqualifizierte könnte das
Bundesland von einer höheren Bleibequote profitieren und seine Wertschöpfung (BIP) um ca.
360 Mio. Euro pro Jahr steigern.51
Abbildung 5: NRW verliert jährlich nahezu ~ 25 % seiner Absolventeinnen
und Absolventen an andere Bundesländer
1. Bayern ist Spitzenreiter im Bundesvergleich
Anmerkung: BL = Bundesland; Szenariorechnung geht von einem identischen Wanderungsverhältnis für Nicht-MINT-Absolventen und MINT-Absolventen aus
Quelle: BCG-Analyse; Statistische Ämter der Länder für Bruttowertschöpfung; DESTATIS für Absolventenzahlen
50
Haußen und Übelmesser 2015, 46.
51
Basierend auf der durchschnittlichen Bruttowertschöpfung je Arbeitsstunde und Erwerbstätigen in NRW in
2015 (Statistische Ämter der Länder).
16In Deutschland herrschen beachtliche regionale Unterschiede, was die Integration von Frauen in
den Arbeitsmarkt angeht. Während Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin und Sachsen
eine Beschäftigungsquote52 erreichen, die sogar leicht über derjenigen von Männern liegt, arbeiten
im Bundesschnitt nur 53,4 % der Frauen zwischen 15 und 65 Jahren (Männer: 60,2 %). NRW ist im
Ländervergleich Schlusslicht und erreicht eine Frauenerwerbsquote von lediglich 48,65 %.
Abbildung 6: Tausende weibliche Fachkräfte stehen dem Talentpool in NRW
derzeit nicht zur Verfügung
Anmerkung: VZÄ = Vollzeitäquivalente, berücksichtigt 5,9 Millionen Frauen zwischen 15 und 65 Jahren als potenzieller Erwerbstätigenpool; Teilzeitarbeit
umgerechnet auf VZÄ unter Berücksichtigung durchschnittlicher Arbeitszeit von Frauen jeweils in Voll- und Teilzeit; Fachkraft definiert als Arbeitskraft mit
abgeschlossener Lehre/Berufsschule.
Quelle: BCG-Analyse; IT.NRW; Statistisches Bundesamt; Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen; Eurostat;
Bundesagentur für Arbeit
52
Anhand der Beschäftigungsquote lässt sich der Grad der Arbeitsmarktintegration ablesen, indem sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigte – die quantitativ bedeutendste Erwerbstätigengruppe – in Relation zur
Bevölkerung gesetzt werden.
17Damit bleibt ein signifikanter Teil dieses Talentpools in NRW ungenutzt. Ein wesentliches Hindernis
auf dem Weg zu einer höheren Erwerbstätigenquote ist dabei das unzureichende Betreuungs-
angebot. Frauen erfüllen fünfmal häufiger als Männer familiäre Betreuungspflichten, im
Besonderen von Kindern53, während NRW gleichzeitig mit einer Betreuungsquote der unter
3-Jährigen i. H. v. 25,7 % im Ländervergleich den niedrigsten Wert erreicht.54 Auch mit Blick auf
Ganztagsschulen schneidet NRW unterdurchschnittlich ab. Mit 8 zusätzlichen Wochenstunden bleibt
die verlängerte Lernzeit in Ganztagsgrundschulen überschaubar im Vergleich zu Hessen mit
22 Stunden und dem Bundesschnitt von 14 Stunden. Auch in der Sekundarstufe I findet sich NRW
mit 4 zusätzlichen Wochenstunden, die für außerschulische Aktivitäten zur Verfügung stehen, unter
den Schlusslichtern wieder (vgl. Spitzenreiter Hessen mit 16 Stunden; Bundesschnitt: 8 zusätzliche
Stunden).55
Unzureichende Betreuungsangebote in Verbindung mit einem im Vergleich zu Männern um 22 %
geringeren Einkommen (Bundesschnitt: 21 %)56 begünstigen traditionelle Rollenbilder: Frauen
bleiben zur Kinderaufsicht zuhause oder beschränken sich auf Teilzeitarbeit, während Männer
Vollzeit arbeiten gehen. Die BCG-Studie "Frau Dich!" hat demografische Daten aus dem Mikrozensus
ausgewertet und ermittelt, dass die Entscheidung für Teilzeit oft permanent ist: So steigt die Teilzeit-
quote unter berufstätigen Frauen zwischen 18 und 27 Jahren sowie zwischen 32 und 40 Jahren
sprunghaft an und verbleibt anschließend auf hohem Niveau bei ca. 50 % über das gesamte
Erwerbsleben.57
53
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut (WSI) 2015.
54
Statistisches Bundesamt 2016a.
55
Bertelsmann Stiftung 2016, 10.
56
Statistisches Bundesamt 2016b.
57
BCG, 2016, 6.
18Bei einer Erhöhung der Frauenerwerbsquote in NRW auf den Bundesdurchschnitt stünden über
175.000, bei einer Erhöhung auf den Durchschnitt der westdeutschen Flächenländer immerhin noch
mehr als 130.000 zusätzliche Fachkräfte zur Verfügung.58 Umgerechnet könnte das BIP von NRW
jährlich um ca. 13 Mrd. Euro bzw. 9,6 Mrd. Euro erhöht werden.59
Weitere Anstrengungen sind notwendig, um den Zugang zu Betreuungsmöglichkeiten für
Kleinkinder und zu Ganztagsschulen zu erleichtern und so die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie kontinuierlich zu verbessern. So steigerte zwar NRW die Betreuungsquote der unter 3-
Jährigen zwischen 2012 und 2016 mit einer Wachstumsrate von jährlich über 9 % und damit 3 %
schneller als die alten Bundesländer – von 2015 auf 2016 fiel jedoch die Betreuungsquote in NRW
wieder um 0,2 % auf aktuell 25,7 %.60
Erfolgreiche Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt
Städte und Gemeinden in NRW registrierten zum Stichtag 1. Oktober 2016 über 214.000 Flücht-
linge.61 Diese enorme Zuwanderung stellt Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft vor große Heraus-
forderungen, ist aber zugleich auch Chance für ein Bundesland, in dem der demografische Wandel
sowie ein zunehmender Mangel an qualifizierten Beschäftigten drängende Zukunftsthemen sind.
Der Großteil dieser zugewanderten Menschen ist jung. Die Mehrheit der Asylantragsteller im Januar
2017 war jünger als 30 Jahre – eine Altersstruktur, die auch in den Vorjahren beobachtet wurde.62
Zwar ist das Industrialisierungsniveau der Herkunftsländer im europäischen Vergleich gering, was
bei einem Großteil der Flüchtlingen mit schwach ausgeprägten MINT-Kompetenzen einhergeht,
jedoch eröffnet das günstige Altersprofil bei rechtzeitiger Investition in Integration und
Qualifizierung die Perspektive, den Arbeitsmarkt in NRW dauerhaft mit neuen Fachkräften zu
verstärken. Voraussetzung hierfür sind differenzierte, dem Bildungsstand der Ankommenden
58
Hierbei wird noch nicht berücksichtigt, dass sich durch bessere Betreuungsangebote auch der Anteil der
Vollzeitkräfte unter den bereits erwerbstätigen Frauen erhöhen ließe.
59
BCG-Analyse.
60
Statistisches Bundesamt 2016a.
61
Bezirksregierung Arnsberg 2017.
62
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 2017.
19angepasste Bildungsangebote. Während 69 % der volljährigen Asylantragsteller in Deutschland in
den Jahren 2015 und 2016 mindestens eine mittlere Schulbildung genossen hatten, benötigen
diejenigen mit geringer bis keiner Bildung spezielle Fördermaßnahmen.63 Zusätzlich sind gezielte
Sprachkurse auch für den Erwerb berufsspezifischer Sprachkenntnisse erforderlich.
In ihrer Studie "Integrationskraft Arbeit" hat BCG die Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen
unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten analysiert. Dabei wurden Kosten von ca. 7.500 Euro pro Kopf
für zusätzliche Qualifizierungs- und Unterstützungsmaßnahmen64 ermittelt. Stellt man dem die
möglichen wirtschaftlichen Erträge65 gegenüber, so erwirtschaftet ein neuer Mitarbeiter bereits im
ersten Jahr einen Mehrwert von ca. 19.650 Euro.66
Gelingt die Integration von Flüchtlingen in den nordrhein-westfälischen Arbeitsmarkt auf
zumindest vergleichbarem Niveau wie bei früheren Migrationswellen, könnten innerhalb der
nächsten zwei bis drei Jahre einmalig über 35.000 zusätzliche Fachkräfte dem Arbeitsmarkt zur
Verfügung stehen.67 Bis 2020 würde so die jährliche Wertschöpfung NRWs (BIP) um weitere
3,4 Mrd. Euro gesteigert werden.68
63
BCG-Analyse basierend auf BAMF-Daten aus "Aktuelle Zahlen zu Asyl, Dezember 2016" und
"BAMF-Kurzanalyse Ausgabe 04/2016: Sozialstruktur, Qualifikationsniveau und Berufstätigkeit".
64
BCG-Analyse: ca. 7.550 Euro pro eingestellten Flüchtling.
65
BCG-Analyse anhand eines Beispielunternehmens: ca. 11.200 Euro.
66
BCG-Analyse. Die zugrunde gelegten Beträge für Erträge und Förderungen dieser wirtschaftlichen
Betrachtung stammen aus einem anonymisierten Beispiel eines mittelständischen Unternehmens.
Für die Kosten wurde der Durchschnitt aller untersuchten Unternehmen herangezogen.
67
BCG-Analyse basierend auf prognostizierter Erwerbstätigenquote von Flüchtlingen durch das Deutsche
Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) sowie das durch den Landtag NRW gemeldeten Ausbildungsniveau
von Bürgern mit Migrationsstatus.
68
BCG-Analyse. Unter der Annahme einer durchschnittlichen Bruttowertschöpfung in NRW (47,39 Euro) und
einer Beschäftigungsquote von 46,3 % (vom DIW erwartete Beschäftigungsquote für das Jahr 2020 von in
2015 zugewanderten Flüchtlingen) sowie unter der Annahme, dass sich das Ausbildungsniveau der heute
16- bis unter 30-Jährigen dem von in Deutschland bereits lebenden Migranten anpasst, während das
Ausbildungsniveau der über 30-Jährigen unverändert bleibt.
20Abbildung 7: Mittelfristiges Fachkräftepotenzial unter Geflüchteten liegt bei
über 35.000 (bei besserer Ausbildung)
1. Bevölkerung in NRW mit Migrationsstatus und beruflichem Bildungsabschluss liegt bei 57 % (vs. 87 % unter Bevölkerung ohne Migrationsstatus)
Anmerkung: 0,7 % der in NRW gemeldeten Geflüchteten sind über 65 Jahre alt; Arbeitsmarktpotenzial berücksichtigt Fachkräfte und Ungelernte sowie eine
Beschäftigungsquote von 46,3 % (2020); über 30-Jährige spiegeln Berufsbildung der 6 Hauptherkunftsländer von Asylbewerbern im Jahr 2014 wider;
Fachkräftepotenzial der Geflüchteten basiert auf Anteil der NRW-Bevölkerung mit Migrationsstatus und abgeschlossener Berufsausbildung oder tertiärer
Bildung (2015)
Quelle: BCG-Analyse; Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (erwartete Beschäftigungsquote aufgenommener Migranten 2020); Ministerium für Arbeit,
Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (Qualifikationsniveau); Bundesamt für Migration (Altersverteilung, berufliche Bildung);
Bezirksregierung Arnsberg (Anzahl Geflüchtete)
21Handlungsempfehlungen zur Mobilisierung der Talente
Kritisches Benchmarking aller Standortfaktoren mit dem Ziel, die Abwanderung Hochqualifizier-
ter einzudämmen
Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch beschleunigten Ausbau des Betreu-
ungsangebots für Kleinkinder und Schüler
Zielgruppenspezifische Förderung der Integration von Flüchtlingen, u. a. mit qualitativ hoch-
wertigen allgemeinen und berufsspezifischen Sprachkursen sowie vorbereitenden Maßnahmen
zur Integration in den Arbeitsmarkt
224. Die Innovationslücke
Innovation ist ein zentraler Treiber für Wachstum. Mit einer breit aufgestellten und qualitativ
hochwertigen Forschungs- und Entwicklungslandschaft verfügt NRW über eine gute Ausgangsbasis.
Auch die Umsetzung in Innovation – gemessen an dem Verhältnis der Ausgaben für Forschung und
Entwicklung (F & E) zu Patentanmeldungen – ist in NRW vergleichsweise gut, jedoch gibt es für
NRW noch großes Verbesserungspotenzial im Vergleich zu anderen Bundesländern wie Baden-
Württemberg. Zentral sind dabei die Ausgaben für F & E: Würde NRW hierbei das Niveau des
Spitzenreiters Baden-Württemberg erreichen, wäre eine Steigerung des BIP von bis zu
ca. 16 Mrd. Euro möglich.69
Gute Basis für Innovation durch dichte Wissenschaftslandschaft
NRW verfügt mit insgesamt etwa 70 Hochschulen70 und vielen weiteren Forschungsinstituten (u. a.
12 Max-Planck-Instituten und 14 Fraunhofer-Instituten) über eine dichte Wissenschaftslandschaft71
und damit über eine wichtige Voraussetzung für Innovation. Ausgaben für Forschung und
Entwicklung sind in diesem Zusammenhang ein wichtiger Indikator für die Innovationskraft eines
Standorts. Ausgedrückt als Anteil am regionalen BIP beliefen sich die F&E-Ausgaben in NRW im
Jahr 2014 auf ca. 2 %, womit NRW nur vor dem Saarland, den östlichen Bundesländern
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt sowie Schleswig-Holstein lag (der
höchste Anteil am BIP war ca. 4,9 % in Baden-Württemberg).72
69
Vgl. Svetlana Sokolov-Mladenović, Slobodan Cvetanović und Igor Mladenović 2016, 1. Hier angegebene
Berechnung ausgehend von einer realen Wachstumsrate von 1,4 % im Jahr 2014 (Veränderung zum
Vorjahr), da für dieses Jahr die aktuellsten F&E-Daten zur Verfügung stehen.
70
Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2017.
71
Bundesministerium für Bildung und Forschung 2016.
72
Bundesamt für Statistik 2016c.
23Abbildung 8: Bei F&E-Ausgaben liegt NRW nur knapp vor den
strukturschwächsten Bundesländern
Anmerkung: F&E: Forschung und Entwicklung; BB: Brandenburg; BE: Berlin; BW: Baden-Württemberg; BY: Bayern; HB: Bremen; HE: Hessen; HH; Hamburg;
MV: Mecklenburg-Vorpommern; NI: Niedersachsen; NRW: Nordrhein-Westfalen; RP: Rheinland-Pfalz; SH: Schleswig-Holstein; ST: Sachsen-Anhalt SL:
Saarland; SN: Sachsen; TH: Thüringen
Quelle: Bundesamt für Statistik Interne Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie deren Anteil am Bruttoinlandsprodukt nach Bundesländern 2012
bis 2014
Ein positiveres Bild ergibt sich bei der Betrachtung der Patentanmeldungen. Im Jahr 2014 belief
sich die Anzahl der Patentanmeldungen beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) pro
100.000 Einwohner in NRW auf ca. 40, womit NRW den vierten Platz hinter Hamburg, Bayern und
Baden-Württemberg einnahm (Baden-Württemberg: 136 Anmeldungen).73 Rechnet man Patent-
anmeldungen beim DPMA und dem Europäischen Patentamt (EPA) zusammen, kommt NRW auf 59
(im Vergleich dazu Bayern 152 und Baden-Württemberg 17474). Das bedeutet, dass NRW mit
73
BCG-Analyse basierend auf Bundesamt für Statistik und Deutsches Patent- und Markenamt
Patentanmeldungen 1995 – 2014; Bundesamt für Statistik Einwohnerzahlen 2006 – 2014.
74
Eurostat 2016. Die Daten beziehen sich auf das Jahr 2012, da dies die aktuellsten auf europäischer Ebene
und auf Regionen bezogenen Daten sind.
24weniger F&E-Mitteln als die Spitzenreiter unter den Bundesländern trotzdem eine hohe Zahl von
Patenten produziert.75
Würde NRW den Anteil seiner F&E-Ausgaben am BIP (von 2012 bis 2014 konstant bei ca. 2 %) auf
das Niveau des Spitzenreiters Baden-Württemberg erhöhen (von 2012 bis 2014 konstant bei ca. 5 %),
könnte es bei Annahme von gleichbleibenden durchschnittlichen F&E-Ausgaben je Patentanmeldung
zur Spitzengruppe der Bundesländer aufschließen.
Abbildung 9: NRW wäre unter den Spitzenreitern, wenn es ähnlich viel in
F&E investierte wie Baden-Württemberg
Anmerkungen: Anteil der F&E-Ausgaben am BIP 2012: NRW ~ 2,0 % und BW ~ 4,9 % (BW Rang 1); Szenario bei der Erhöhung der F&E-Ausgaben NRWs auf
4,9 % des BIPs bei gleichbleibenden F&E-Ausgaben pro Patentanmeldung; F&E: Forschung & Entwicklung; EPO: European Patent Office; DPMA: Deutsches
Patent- und Markenamt
Quelle: BCG-Analyse; Bundesamt für Statistik und Deutsches Patent- und Markenamt Patentanmeldungen 1995 – 2014; Bundesamt für Statistik
Einwohnerzahlen 2006 – 2014; Bundesamt für Statistik Interne Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie deren Anteil am Bruttoinlandsprodukt nach
Bundesländern 2012 bis 2014; Eurostat Patent applications to the EPO by priority year by NUTS 3 regions
75
Siehe auch Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung (vormals Rheinisch-Westfälisches Institut für
Wirtschaftsforschung) und Stifterverband-Wissenschaftsstatistik 2010.
25Ausgehend von der Annahme, dass eine Erhöhung des Anteils der F&E-Ausgaben am BIP um 1 % zu
einer Steigerung der realen Wachstumsrate um 2,2 % führt76, würde eine Erhöhung des Anteils der
F&E-Ausgaben auf das Niveau Baden-Württembergs mit einer Wachstumssteigerung von ca.
16 Mrd. Euro einhergehen.77 Dabei ist jedoch zu bedenken, dass diese Auswirkungen aufgrund der
Langfristigkeit der Forschungsaktivitäten mit einer zeitlichen Verzögerung auftreten werden.
Erhöhung der Standortattraktivität NRWs für Forschung und Entwicklung
Um diese Steigerung zu ermöglichen, ist insbesondere eine Erhöhung des privaten Anteils der
F&E-Ausgaben erforderlich. Während sich NRW bei den staatlichen Ausgaben bereits im Mittelfeld
der Bundesländer befindet, liegt der Anteil der privaten F&E-Ausgaben noch weit hinter dem der
führenden Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg. Der Anteil der Wirtschaft an den F&E-
Ausgaben beläuft sich 2014 in NRW lediglich auf 57 %, während Baden-Württemberg mit 77 % und
Bayern mit 81 % weit vorne liegen.78
Um die Standortattraktivität für den Einsatz privater F&E-Mittel zu erhöhen, ist eine Vielzahl von
Faktoren zu betrachten. Ein für NRW positiver Standortfaktor sind die im Bundesländervergleich
niedrigen Strompreise, denn diese liegen in NRW unter dem Bundesdurchschnitt und sind niedriger
als in Bayern oder Baden-Württemberg.79 Die Attraktivität eines Standorts wird darüber hinaus
bestimmt durch Anzahl und Qualität der verfügbaren Arbeitskräfte, die Lebensqualität (um
Mitarbeiter von diesem Standort zu überzeugen), dem Vorhandensein eines Ökosystems von
Unternehmen und Forschungseinrichtungen, einer guten Infrastruktur sowie effektiven
Unterstützungs- und Regulierungsmaßnahmen durch die Regierung.
76
Vgl. Svetlana Sokolov-Mladenović, Slobodan Cvetanović und Igor Mladenović 2016.
77
BCG-Analyse ausgehend von einer realen Wachstumsrate von 1,4 % im Jahr 2014 (Veränderung zum
Vorjahr), da für dieses Jahr die aktuellsten F&E-Daten zur Verfügung stehen.
78
BCG-Analyse basierend auf Bundesamt für Statistik 2015.
79
Stromauskunft 2017.
26Zum letzteren Aspekt zählen beispielsweise die Gewerbesteuern. Betrachtet man die gewogenen
Gewerbesteuerhebesätze, so hat NRW – abgesehen von Hamburg – die höchsten Gewerbesteuern im
Bundesländervergleich.80 Ein so hohes Niveau an Gewerbesteuern stellt eine hohe Belastungsprobe
dar, insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen. Auf der anderen Seite sind
Gewerbesteuern eine wichtige Einnahmequelle für die Kommunen, was die Anpassung erschwert.
Gewerbesteuern sind dabei aber nur einer von vielen Faktoren der Standortattraktivität. Andere
wichtige Indikatoren in diesem Bereich sind Bürokratiekosten, die ein Grund dafür sein können,
warum sich ein Unternehmen gegen einen Standort entscheidet. Daher müssen Bürokratiekosten
konsequent gemessen und, wo möglich, gesenkt werden. Hierzu kann die Schaffung eines
Landesnormenkontrollrates dienen.
Die Attraktivität eines Standorts wird auch durch die Möglichkeit der Kooperationen mit innovativen
Partnern bestimmt. Dies gilt im Besonderen für Kooperationen zwischen Wissenschaft und
Industrie. Um diese zu fördern, ist jedoch eine Stärkung der Hochschulautonomie essenziell. Mit
diesen Maßnahmen kann NRW die Grundlagen für zukünftige Innovationen verbessern.
Handlungsempfehlungen für Innovation
Steigerung der staatlichen Investitionen um jährlich 1 % bis 2020 auf das Niveau Baden-Württem-
bergs sowie Initiative zur Stärkung privater F&E-Mittel
Steigerung der Standortattraktivität u. a. durch eine Senkung der Gewerbesteuern auf den Durch-
schnitt der Bundesländer sowie parallele Entlastung der Kommunen
Objektive Messung und systematische Begrenzung der Bürokratiekosten, z. B. durch die Schaffung
eines Landesnormenkontrollrates
Stärkung der Hochschulfreiheit, insbesondere bei der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und bei
der Einwerbung von Drittmitteln
80
DIHK 2016.
275. Das Infrastrukturdefizit
Eine leistungsfähige Infrastruktur ist das Grundgerüst einer starken Wirtschaft. Vor dem
Hintergrund, dass diese Bereiche die täglichen Aktivitäten der meisten Menschen in NRW betreffen,
liegt der Schwerpunkt dieses Kapitels auf der Verkehrsinfrastruktur von Straßen sowie auf der
digitalen Infrastruktur. NRW hat dabei große Defizite, die insbesondere in einer maroden
Verkehrsinfrastruktur und zu geringen Investitionen bestehen.
Um seine Wirtschaftskraft zu stärken, muss NRW konsequent in den Erhalt und in den Ausbau
seiner Infrastruktur investieren; dies gilt für Verkehrsinfrastruktur und digitale Infrastruktur
gleichermaßen. Viele Studien haben gezeigt, dass Investitionen in Infrastruktur positive makro-
ökonomische Effekte haben, z. B. einen höheren Beschäftigungsstand und stärkeres Wachstum des
BIP.81 Allein durch eine Senkung der Staustunden in NRW könnte das BIP NRWs beispielsweise
um ca. 2 Mrd. Euro gesteigert werden, und durch einen Zuwachs der FTTH-/FTTB-Anschlüsse
könnte weiteres Wachstum von ca. 10 Mrd. Euro erreicht werden.
Die Kosten der schlechten Verkehrsinfrastruktur
Durch die Bevölkerungsdichte und den Transitverkehr werden Teile der Verkehrsinfrastruktur in
NRW besonders stark beansprucht. Mehr als 40 % aller Autobahnen sowie Bundes- und
Landesstraßen NRWs befinden sich in einem schlechten Zustand. Insbesondere die mit
Landesmitteln finanzierten Straßen sind in einem deutlich schlechteren Zustand als die mit
Bundesmitteln finanzierten. Insgesamt befinden sich ca. 380 Autobahn-, ca. 1.300 Bundesstraßen-
und ca. 6.400 Landesstraßenkilometer in einem schlechten bis sehr schlechten Zustand.82
81
Siehe hierzu beispielsweise Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) 2010.
82
BCG-Analyse basierend auf Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen (Straßen.NRW) 2015;
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen 2015.
28Abbildung 10: Rund 41% aller Autobahnen, Bundesstraßen und
Landesstraßen in NRW sind in einem schlechten Zustand
1. Kreisstraßen von der Betrachtung ausgeschlossen 2. Substanzwertbenotung 2014 3. Substanzwertbenotung 2011 4. Substanzwertbenotung 2011
Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln 2016 Die wirtschaftliche Situation Nordrhein-Westfalens. Bestandsaufnahme und Handlungsempfehlungen;
Straßen.NRW 2015 Zustand der Fahrbahnbefestigungen und Brücken in NRW; Landtag Nordrhein-Westfalen, 2015 Zustands- und Erhaltungsprognose der
Landesstraßen in NRW, Vorlage 16/3125
Die vergleichsweise schlechte Verkehrsinfrastruktur des Landes drückt sich auch in der Tatsache aus,
dass NRW das höchste Stauaufkommen aller Bundesländer hat. Laut ADAC gab es 2016 in
Deutschland ca. 694.000 Staus mit einer Staulänge von insgesamt über 1,3 Mio. km83 – davon
entfielen ca. 28 % auf NRW. Die gesamten Staustunden beliefen sich 2016 bundesweit auf
ca. 419.000, der Anteil NRWs auf ca. 30 %.84 Damit stand NRW sowohl bei den Staukilometern als
auch bei den Staustunden an der Spitze aller Bundesländer: NRW verzeichnete im Jahr 2016 ca.
56 Staustunden pro Kilometer Autobahn. Nimmt man an, dass auf 1 Autobahnkilometer bei Stau
ca. 600 Autos mit je 1 Person stehen, ergäbe sich dadurch für 2016 ein Verlust von ca. 4 Mrd. Euro
83
ADAC, 2016.
84
ADAC 2016.
29Bruttowertschöpfung.85 Lägen die Staustunden pro Kilometer nur auf dem Niveau Bayerns, könnte
dieser Verlust fast um die Hälfte reduziert und somit eine Steigerung des BIP um ca. 2 Mrd. Euro
erreicht werden.
Damit Stau vermieden wird, bedarf es einer möglichst intakten Verkehrsinfrastruktur. Um die zuletzt
gemessene Qualität der Landesstraßen und Brücken zu erhalten sowie eine Vergrößerung des
Nachholbedarfs bei der Sanierung zu vermeiden, müssten laut einer im Auftrag des Landesbetriebs
Straßenbau Nordrhein-Westfalen erstellten Prognose jährlich ca. 195 Mio. Euro investiert werden.86
Dieses Szenario beschreibt den Finanzbedarf für eine "Beibehaltung bzw. Wiederherstellung der
Zustandsverteilung von 2011 bei einem in etwa gleichbleibenden Nachholbedarf bis 2028".87 Doch
selbst mit dem jüngst erhöhten Budget für den Erhalt der Landesstraßen bleiben die Mittel ca. 35 %
unter dem Bedarf. Dabei zielt dieses Szenario lediglich auf den Erhalt, nicht aber auf einen Ausbau
der Verkehrsinfrastruktur ab.
85
BCG-Analyse. Berechnung: (Staustunden pro km Autobahn in NRW × Personen pro km Autobahn bei Stau
× Gesamtnetz Autobahn in NRW) × durchschnittliche Bruttowertschöpfung pro Person pro Stunde =
Wertverlust durch Stau in NRW 2016. Annahmen: Autos pro km Stau ca. 600 mit ca. 1 Person pro Auto.
Angaben: Staustunden pro km Autobahn 2016 ca. 57; Gesamtnetz Autobahnen NRW ca. 2.200 km;
durchschnittliche Bruttowertschöpfung pro Person pro Stunde in Deutschland ca. 52 Euro. Anmerkung:
Staumodell unter der Annahme, dass sich auf der Autobahn bei zweispuriger Strecke nur PKWs befinden.
86
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen 2015, 4.
87
idem, 2.
30Abbildung 11: Die Ausgaben NRWs für den Erhalt von Landesstraßen und
Brücken liegen ~ 35% unter Bedarf
1. Erhaltungsprogramm Landesstraßen NRW (enthält auch Ausgaben für Sanierung von Brücken, Rad- und Gehwegen); 2. Angaben des jährlichen
Finanzierungsbedarfs für ein Qualitätsszenario, bei dem der zuletzt gemessene Zustand der Landesstraßen und Brücken in NRW erhalten bleibt und ein
Anwachsen des Nachholbedarfs vermieden wird, entnommen aus: Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-
Westfalen. 2015 3. Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel, Stützbauwerke etc.) 4. Sonstige Anlagenteile: Entwässerungseinrichtungen, Erdkörper etc.
Quelle: Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen. 2017. Erhaltungsprogramm Landesstraßen 2017;
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen. 2015. Zustands- und Erhaltungsbedarfsprognose der
Landesstraßen in Nordrhein-Westfalen. Vorlage 16/3125
Eine leistungsfähige Infrastruktur für das digitale Zeitalter
Bei der digitalen Infrastruktur muss vermieden werden, dass ein ähnlicher Nachholbedarf wie bei
der Verkehrsinfrastruktur anfällt. Aktuell liegt NRW bei der Breitbandversorgung im oberen Mittel-
feld aller Bundesländer, in Zukunft jedoch könnte NRW von anderen Flächenstaaten, die ihre
digitale Infrastruktur stärker ausbauen, schnell überholt werden.
31Laut Breitbandatlas des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) liegt
NRW, wo 77 % aller Haushalte eine Breitbandversorgung von > 50 Mbit/s haben, derzeit direkt
hinter den drei noch dichter besiedelten Stadtstaaten (Hamburg und Bremen jeweils 94 % und Berlin
90 %).88 Betrachtet man jedoch neuere Technologien, ergibt sich ein nicht mehr ganz so positives
Bild: In NRW haben nur 6,9 % aller Haushalte einen Breitbandzugang durch Glasfasertechnologie
(im Vergleich dazu Bayern 9,7 %, Schleswig-Holstein 15,3 % und Hamburg 71,4 %).89 Auch ist der
Mobilfunkstandard 5G noch nicht Teil von NRWs aktueller Gigabit-Strategie. NRW muss also
aufpassen, nicht den Anschluss an Schlüsseltechnologien für das digitale Zeitalter zu verlieren.
Diese Gigabit-Strategie sieht vor, NRW bis zum Jahr 2026 flächendeckend mit Glasfasernetzen
auszustatten. In einem ersten Schritt soll dazu die flächendeckende Versorgung mit 50 Mbit/s bis
2018 erreicht werden. Dazu werden nach Angaben NRWs aktuell Fördermittel i. H. v. ca.
0,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt90; besonderer Fokus soll hierbei der Anschluss von Gewerbe-
gebieten und ländlichen Räumen sein.91 Dies ist besonders dringlich in Anbetracht der Tatsache, dass
NRW an dritter Stelle derjenigen Bundesländer mit der höchsten Anzahl an Gewerbeflächen ohne
Glasfaserversorgung liegt.
Der Freistaat Bayern stellt in seinem Förderprogramm für den Breitbandausbau mit ca.
1,5 Mrd. Euro den dreifachen Investitionsbetrag zur Verfügung. Laut einer Pressemitteilung vom
Februar 2017 gibt es derzeit in über 1.000 bayerischen Gemeinden Baumaßnahmen, wobei allein bei
diesen Projekten bereits 26.000 km Glasfaserleitung verlegt werden.92 Darüber hinaus hat Vodafone
angekündigt, bis 2019 bis zu 70 % aller Einwohner Bayerns den Zugang zu Kabelglasfasernetzen mit
1.000 Mbit/s zu ermöglichen.93 Auch andere Bundesländer wie etwa Schleswig-Holstein setzen
konsequent auf den Ausbau von Glasfasernetzen. Zum Vergleich: NRW hat das Ziel definiert, bis
88
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) 2016.
89
Deutscher Bundestag 2016.
90
Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen
2016.
91
idem.
92
Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat 2017.
93
Vodafone-Pressemitteilung vom 19. Januar 2017.
32Sie können auch lesen