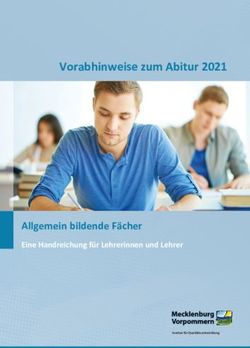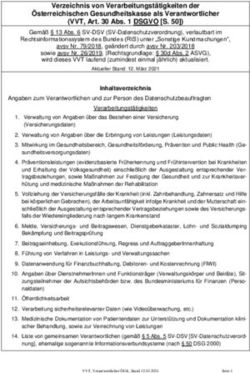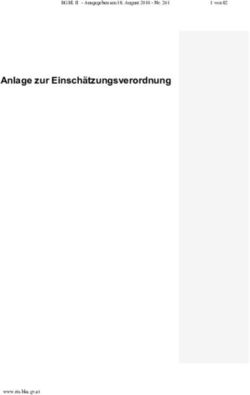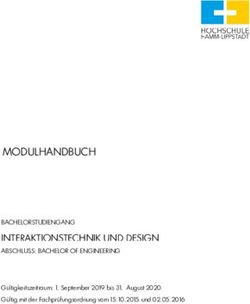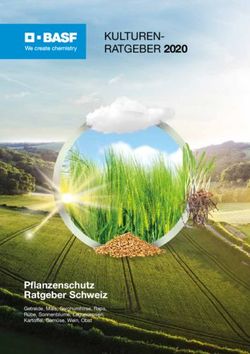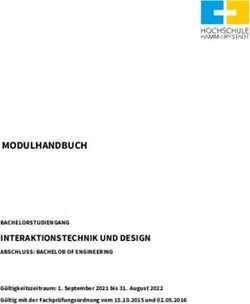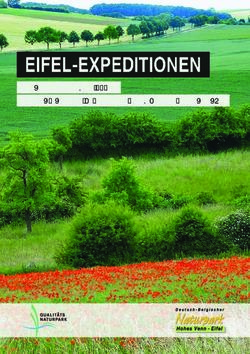FÖRDERMÖGLICHKEITEN AUSSCHREIBUNGEN SCHWERPUNKTE PROGRAMME STIPENDIEN PREISE u.a - FORSCHUNGSNACHRICHTEN 02/2018 - TU Dresden
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Dezernat Forschungsförderung und Transfer FÖRDERMÖGLICHKEITEN AUSSCHREIBUNGEN SCHWERPUNKTE PROGRAMME STIPENDIEN PREISE u.a. FORSCHUNGSNACHRICHTEN 02/2018 Dezernat 5 Sachgebiet Forschungsförderung Weißbachstraße 7, 01069 Dresden
Forschungsnachrichten 02/2018 vom 27.02.2018
Inhaltsverzeichnis
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Seite 5 Gründung eines Instituts für gesellschaftlichen Zusammenhalt
Seite 7 Richtlinie zur Fördermaßnahme „Computational Life Sciences“
Seite 8 Richtlinie zur Förderung multinationaler Forschungsprojekte zur Gesundheits-
und Sozialversorgung bei Neurodegenerativen Erkrankungen im Rahmen des
EU Joint Programme ? Neurodegenerative Disease Research (JPND)
Seite 10 Richtlinie zur Förderung von transnationalen Forschungsprojekten für
Nachwuchswissenschaftler im Rahmen des ERA-Netzes zu Herz-Kreislauf-
Erkrankungen (ERA-NET CVD)
Seite 12 Richtlinie zur Förderung von transnationalen Forschungsprojekten zu
psychischen Störungen im Rahmen des ERA-NET NEURON
Seite 13 Richtlinie zur Förderung von transnationalen Forschungsprojekten zu
psychischen Störungen im Rahmen des ERA-NET NEURON
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
Seite 14 Errichtung von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge im engen
Zusammenhang mit dem Abbau bestehender Netzhemmnisse sowie dem
Aufbau von Low Cost-Infrastruktur und Mobile Metering-Ladepunkten
Seite 15 Förderaufruf Errichtung von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge ...
Deutsche Forschungsgemeinschaft
Seite 16 ANR-DFG-Förderprogramm für deutsch-französische Forschungsprojekte in
den Geistes- und Sozialwissenschaften
Seite 17 Auf- und Ausbau integrierter Forschungs- und Weiterbildungsprogramme für
Clinician Scientists in der Universitätsmedizin
Seite 19 Cooperation between DFG, FNI and NSTC: Possibility for Projects between
Germany, Mozambique and Zambia in the Field of Agricultural Sciences
Seite 21 DFG-GACR Cooperation: Possibility for Joint German-Czech Research
Projects
Seite 22 DFG-RFBR Cooperation: Possibility for Joint German-Russian Research
Seite 2/51Forschungsnachrichten 02/2018 vom 27.02.2018
Projects
Seite 23 Joint Sino-German Research Projects
Seite 25 Neues DFG-Förderprogramm „Gerätezentren – Core Facilities“
Seite 27 Priority Programme “Epithelial Intercellular Junctions as Dynamic Hubs to
Integrate Forces, Signals and Cell Behaviour” (SPP 1782)
Seite 28 Priority Programme “Experience and Expectation: Historical Foundations of
Economic Behaviour” (SPP 1859)
Seite 30 Priority Programme “Quantum Dynamics in Tailored Intense Fields (QUTIF)”
(SPP 1840)
Seite 31 Schwerpunktprogramm „Elektromagnetische Sensoren für Life Sciences
(ESSENCE)“ (SPP 1857)
Seite 33 Schwerpunktprogramm „Kooperativ interagierende Automobile“ (SPP 1835)
Seite 35 TWAS-DFG Cooperation Visits Programme
Seite 37 Trilaterale Forschungskonferenzen 2019–2021
Land
Seite 39 Ausschreibung von Promotions- und Habilitationsstipendien und
Förderprogrammen der Graduiertenakademie
Stiftungen
Seite 40 Alzheimer-Promotionsstipendien der Hans und Ilse Breuer-Stiftung
Seite 41 Else Kröner-Memorial-Stipendien 2018
Seite 42 Forschungsstipendien
Seite 43 Förderprogramm der Karl und Veronica Carstens-Stiftung
Vereine
Seite 44 Standard und Pilot Grants zur Alzheimer Forschung
Preise und Sonstiges
Seite 45 DGSP-Forschungspreis
Seite 46 Förderpreis für Schmerzforschung 2018
Seite 3/51Forschungsnachrichten 02/2018 vom 27.02.2018
Seite 47 Hufeland-Preis 2018
Seite 48 SolarWorld Junior Einstein-Award
Seite 49 Wilhelm Vaillant-Preis 2018
Seite 50 Wolfgang-Stille-Preis
Seite 51 Wrighly Prophylaxe Preis 2018
Seite 4/51Forschungsnachrichten 02/2018 vom 27.02.2018
Gründung eines Instituts für gesellschaftlichen Zusammenhalt
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1454.html
Termin: 01.03.2018
Der Deutsche Bundestag hat Mittel zur Gründung eines "Instituts für
gesellschaftlichen Zusammenhalt" bereitgestellt. Anlass sind aktuelle
Entwicklungen, die darauf schließen lassen, dass es Bevölkerungsgruppen gibt,
die das bestehende politische System nicht mehr unterstützen, die sich an den
Rand gedrängt fühlen, bzw. zur parlamentarischen Demokratie und ihren
Repräsentanten auf Distanz gehen. Die hierfür ursächlich anzunehmenden
Zweifel an den Grundlagen von Staat und Gesellschaft erfordern eine
umfassende wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Strukturen und
Wahrnehmungen gesellschaftlicher Zugehörigkeit.
Wissenschaftliche Einrichtungen mit einschlägigem Forschungsprofil werden
aufgerufen, sich in einem wettbewerblichen Verfahren am Aufbau eines
dezentralen Instituts für gesellschaftlichen Zusammenhalt zu beteiligen.
Vorgesehen ist die Förderung von bis zu zehn Institutionen, die sich in einer
Verbundstruktur, zusammenschließen. Die gemeinsame Ausarbeitung eines
inhaltlichen und organisatorischen Konzepts für das dezentrale Institut wird im
Rahmen einer einjährigen Vorphase gefördert. Daran schließt eine vierjährige
Hauptphase an.
Die Aufgaben und Zielstellungen des "Instituts für gesellschaftlichen
Zusammenhalt" umfassen im Wesentlichen die folgenden Aspekte:
- Identifizierung und interdisziplinäre Analyse der aktuellen für den
gesellschaftlichen Zusammenhalt relevanten gesellschaftlichen Trends und
Entwicklungen sowie ihrer historischen Wurzeln.
- Zusammenführung und Weiterentwicklung bereits vorhandenen Wissens,
insbesondere zu problematischen Aspekten gesellschaftlichen Zusammenhalts.
- Untersuchung und Operationalisierung des Begriffs "Gesellschaftlicher
Zusammenhalt" mit dem Ziel der Entwicklung eines übergreifenden Konzepts
sowie aussagekräftiger Indikatoren.
- Austausch und Aufbau von Kooperationsbeziehungen mit der Zivilgesellschaft
und der politisch-administrativen Praxis.
- Maßnahmen der Politik- und Gesellschaftsberatung.
Themenschwerpunkte in der Hauptphase:
Seite 5/51Forschungsnachrichten 02/2018 vom 27.02.2018
- Neue soziale Umbrüche
- Zugehörigkeiten und Identitäten
- Staat und Gesellschaft
- Ambivalenzen der Globalisierung
- Wandel der öffentlichen Meinungsbildung
- Freiheit und Sicherheit
Für die einjährige Vorphase können bis zu 120 000 Euro pro antragstellende
Institution beantragt werden. Für die anschließende vierjährige Hauptphase mit
Verlängerungsoption stehen im Ausbaustand insg. bis zu 10 Millionen Euro
jährlich zur Verfügung.
Das Verfahren ist zweistufig angelegt, es umfasst eine einjährige Vor- und eine
vierjährige Hauptphase, die um weitere fünf Jahre verlängert werden kann. In der
ersten Verfahrensstufe sind dem Projektträger begutachtungsfähige
Interessenbekundungen bis spätestens zum 1. März 2018 vorzulegen.
Seite 6/51Forschungsnachrichten 02/2018 vom 27.02.2018
Richtlinie zur Fördermaßnahme „Computational Life Sciences“
https://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/7088.php
Termin: 12.04.2018
Mit der vorliegenden Förderrichtlinie „Computational Life Sciences“ soll die
Entwicklung innovativer rechnergestützter Methoden und Analysewerkzeuge für
Biologie und Gesundheitsforschung weiter vorangetrieben werden.
Das Ziel dieser Förderrichtlinie ist es, durch die Entwicklung innovativer
Methoden und Softwarewerkzeuge zur bioinformatischen Verarbeitung,
Modellierung und Simulation auf aktuelle Bedarfe in den Lebenswissenschaften
einzugehen. Dadurch sollen der lebenswissenschaftlichen Forschung in
Deutschland effiziente und zuverlässige Hilfsmittel zur Verfügung gestellt werden,
um die durch neueste experimentelle Methoden oder die Zusammenführung
verschiedener Modalitäten gewonnenen Daten geeignet zu modellieren und zu
analysieren.
Diese Förderrichtlinie ist eingebettet in das Rahmenprogramm
Gesundheitsforschung der Bundesregierung.
Es sind vier Auswahlrunden geplant. In der ersten Auswahlrunde zum
Einreichungsstichtag 12. April 2018 werden Projekte zu den unten genannten
Themen gefördert. Zur Erreichung der Zielsetzungen der Förderrichtlinie werden
der Fokus der weiteren Auswahlrunden sowie die genauen Spezifikationen der
ausgeschriebenen Themen regelmäßig überprüft, angepasst und separat durch
die jeweils gültigen Förderaufrufe veröffentlicht (vgl. Nummer 7.2). Die weiteren
Förderaufrufe erfolgen in den Folgejahren mit Einreichungsstichtag im Monat
März. Die Förderaufrufe mit dem genauen Einreichungsstichtag werden auf der
Internetseite des Projektträgers (https://www.ptj.de/computational-life-sciences)
veröffentlicht.
Seite 7/51Forschungsnachrichten 02/2018 vom 27.02.2018
Richtlinie zur Förderung multinationaler Forschungsprojekte zur
Gesundheits- und Sozialversorgung bei Neurodegenerativen
Erkrankungen im Rahmen des EU Joint Programme ?
Neurodegenerative Disease Research (JPND)
http://www.gesundheitsforschung-bmbf.de
Termin: 06.03.2018
Ziel der Bekanntmachung ist die Förderung einer begrenzten Anzahl
ambitionierter, innovativer, multinationaler und multidisziplinärer Verbundprojekte.
Sie sollen die Gesundheits- und Sozialversorgung sowohl auf Makroebene
(Systeme und Infrastrukturen) sowie auf der Ebene der Betroffenen, ihrer
Pflegenden und Familien untersuchen. Stärken und Schwächen formeller und
informeller Pflegeansätze und der bestehenden Infrastrukturen sollen bewertet
werden. Damit sollen Voraussetzungen für die Umsetzung verbesserter,
evidenzbasierter Ansätze geschaffen werden, die die Qualität der Versorgung
verbessern und die Lebensqualität Betroffener steigern.
Der überwiegende Teil der Forschung zur Gesundheits- und Sozialversorgung
wäre ohne die aktive Beteiligung von Betroffenen unmöglich. Verbundprojekte
müssen daher Betroffene, deren Betreuende und die Öffentlichkeit angemessen
einbeziehen. Es wird erwartet, dass die geförderten Verbünde partizipatorische
Ansätze in jedes Stadium des Forschungsprozesses einbeziehen, sofern dies
angebracht ist. Dies schließt auch die Ausarbeitung des Forschungsantrags ein.
Es muss beschrieben werden, auf welchen Ebenen des Forschungsprozesses
Betroffene oder Betreuende beteiligt sein werden und welche Aufgaben sie
übernehmen. Wenn möglich sollten Betroffenenvertretungen aus jedem der am
Konsortium beteiligten Länder konsultiert werden. Sofern der Antrag keinen
partizipatorischen Ansatz enthält, muss dies begründet werden.
Forschungsprojekte zur Gesundheits- und Sozialversorgung können sich auf
Patientinnen und Patienten mit den unten genannten neurodegenerativen
Erkrankungen beziehen:
– Alzheimer-Erkrankung und andere Demenzen;
– Parkinson und mit Parkinson verwandte Erkrankungen;
– Prionenerkrankungen;
Seite 8/51Forschungsnachrichten 02/2018 vom 27.02.2018
– Motoneuronerkrankungen;
– Huntington-Krankheit;
– Spinozerebelläre Ataxie (SCA);
– Spinale Muskelatrophie (SMA).
Mit dieser Fördermaßnahme leistet das BMBF einen Beitrag zur Ausgestaltung
des Aktionsfelds 6 im Rahmenprogramm Gesundheitsforschung der
Bundesregierung
Seite 9/51Forschungsnachrichten 02/2018 vom 27.02.2018
Richtlinie zur Förderung von transnationalen
Forschungsprojekten für Nachwuchswissenschaftler im Rahmen
des ERA-Netzes zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen (ERA-NET CVD)
http://www.gesundheitsforschung-bmbf.de
Termin: 15.03.2018
Den gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen der Forschung im Herz-
Kreislauf-Bereich wird nur durch eine effektive Kooperation auf transnationaler
Ebene zu begegnen sein. Um das Ziel einer effektiven Koordination auf -
nationaler und europäischer Ebene zu gewährleisten, sind verstärkte,
disziplinübergreifende Interaktionen erforderlich. Vor diesem Hintergrund wurde
das Europäische Netzwerk zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen („ERA-NET
Cardiovascular Diseases“, kurz: ERA-CVD) mit aktuell 23 Partnern gegründet,
das durch die Europäische Kommission gefördert wird. Ziel von ERA-CVD ist es,
neue und vorhandene Forschungsaktivitäten und -programme der beteiligten
europäischen Länder auf dem Gebiet der Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu
koordinieren (www.ERA-CVD.eu).
Die vorliegende transnationale gemeinsame Bekanntmachung wird speziell für
Mit dieser Fördermaßnahme leistet das BMBF einen Beitrag zur Ausgestaltung
der Aktionsfelder „Bekämpfung von Volkskrankheiten“ und
„Gesundheitsforschung in internationaler Kooperation" im Rahmenprogramm
Gesundheitsforschung der Bundesregierung.Nachwuchswissenschaftlerinnen
und Nachwuchswissenschaftler durchgeführt.
Ausgeschlossen von der Förderung sind:
– interventionelle klinische Studien;
– der Aufbau neuer Kohorten/Register und/oder Biomaterialbanken;
– cerebrovaskuläre und rheumatische Erkrankungen;
– Forschungsansätze, die primär das Risiko-Management im Sinne von
Präventionsstrategien und allgemeine Gesundheitsförderung zur Vermeidung von
Herz-Kreislauf-Erkrankungen betreffen;
– Durchmusterungsansätze bzw. -studien, wie z. B. Studien zur Identifizierung
von neuen Biomarkern oder Früherkennungsscreening in der Bevölkerung oder
Seite 10/51Forschungsnachrichten 02/2018 vom 27.02.2018
von Risikopersonen.
Seite 11/51Forschungsnachrichten 02/2018 vom 27.02.2018
Richtlinie zur Förderung von transnationalen
Forschungsprojekten zu psychischen Störungen im Rahmen des
ERA-NET NEURON
RL im Rahmen des ERA-NET NEURON
http://www.gesundheitsforschung-bmbf.de
Termin: 08.03.2018
Ziel der Bekanntmachung ist die Förderung von transnationalen
Verbundvorhaben mit wichtigen Fragestellungen zu psychischer Gesundheit und
psychischen Störungen. Dies umfasst unter anderem affektive (z. B.
Depressionen und bipolare Störungen) und psychotische Störungen, sowie
Angst-, Autismus-Spektrum-, Substanzgebrauchs- und andere psychische
Störungen. Die Forschungsprojekte können sich auf den gesamten
Lebensverlauf beziehen. Viele dieser Störungen entwickeln sich in Kindheit,
Jugend oder frühem Erwachsenenalter (unter 25 Jahre). Daher ist es von
besonderem gesellschaftlichem Interesse neben neuen Strategien zur Diagnose
auch pharmakologische, Psycho- und Hirnstimulationstherapien zu entwickeln,
um die psychische Gesundheit in dieser Fokusgruppe zu verbessern.
Mit dieser Fördermaßnahme leistet das Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) einen Beitrag zur Ausgestaltung des Aktionsfeldes 6 im
Rahmenprogramm Gesundheitsforschung der Bundesregierung.sundheit in
dieser Fokusgruppe zu verbessern.
Die Fördermaßnahme wird zeitgleich durch die Förderorganisationen im
jeweiligen Land veröffentlicht und zentral durch ein gemeinsames NEURON-
Sekretariat koordiniert. Für die Umsetzung der nationalen Teilvorhaben in einem
Verbund gelten die jeweiligen nationalen Richtlinien.
Seite 12/51Forschungsnachrichten 02/2018 vom 27.02.2018
Richtlinie zur Förderung von transnationalen
Forschungsprojekten zu psychischen Störungen im Rahmen des
ERA-NET NEURON
http://www.gesundheitsforschung-bmbf.de
Termin: 08.03.2018
Diese transnationale gemeinsame Bekanntmachung wird zum Thema
‚psychische Störungen‘ durchgeführt.
Ziel der Bekanntmachung ist die Förderung von transnationalen
Verbundvorhaben mit wichtigen Fragestellungen zu psychischer Gesundheit und
psychischen Störungen. Dies umfasst unter anderem affektive (z. B.
Depressionen und bipolare Störungen) und psychotische Störungen, sowie
Angst-, Autismus-Spektrum-, Substanzgebrauchs- und andere psychische
Störungen. Die Forschungsprojekte können sich auf den gesamten
Lebensverlauf beziehen. Viele dieser Störungen entwickeln sich in Kindheit,
Jugend oder frühem Erwachsenenalter (unter 25 Jahre). Daher ist es von
besonderem gesellschaftlichem Interesse neben neuen Strategien zur Diagnose
auch pharmakologische, Psycho- und Hirnstimulationstherapien zu entwickeln,
um die psychische Gesundheit in dieser Fokusgruppe zu verbessern.
Insbesondere soll die multidisziplinäre Zusammenarbeit zwischen
Forschungsgruppen gefördert werden sowie translationale Forschungsansätze,
bei denen Grundlagenforschung mit klinischen Fragestellungen kombiniert wird.
Viele Fragestellungen zu psychischen Störungen erfordern die Zusammenarbeit
zwischen Psychiatern und Neurologen. Daher ist eine Zusammenarbeit beider
Disziplinen in den Forschungsprojekten erwünscht, wo dies sinnvoll ist. Daneben
soll ebenfalls die Zusammenarbeit mit Forschenden zu neurowissenschaftlichen
Grundlagen und gegebenenfalls weiteren Disziplinen, wie z. B. der
Neuropädiatrie, gefördert werden.
Von der Förderung ausgeschlossen sind Forschungsprojekte zu
Demenzerkrankungen
Seite 13/51Forschungsnachrichten 02/2018 vom 27.02.2018
Errichtung von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge im engen
Zusammenhang mit dem Abbau bestehender Netzhemmnisse
sowie dem Aufbau von Low Cost-Infrastruktur und Mobile
Metering-Ladepunkten
im Rahmen des Sofortprogramms Saubere Luft 2017 bis 2020
http://www.dlr.de/pt/desktopdefault.aspx/tabid-11212/16307_read-50767/cat-400
0/scat-4020/
Termin: 31.03.2018
Dieser Förderaufruf bezieht sich grundsätzlich auf Nummer 2.3 der Richtlinie zu
einer gemeinsamen Förderinitiative zur Förderung von Forschung und
Entwicklung im Bereich der Elektromobilität vom 8. Dezember 2017 (BAnz AT
15.12.2017 B4). Da das „Sofortprogramm Saubere Luft 2017 bis 2020“ vor allem
auf eine schnelle Verbesserung der Luftqualität zielt, wird der Fördergegenstand
auf Vorhaben eingeschränkt, die eine kurzfristige Wirksamkeit plausibel machen
können und deren Umsetzung gleichzeitig Forschungsfragen adressieren:
Konkret sollen deshalb Projekte mit oben genanntem Ziel gefördert werden, die
sich mit mindestens einem der folgenden vier Themen der Buchstaben A bis D
beschäftigen:
A. Demonstrationsräume (Reallabore) zur Erprobung des Abbaus von
Netzausbauhemmnissen
B. Low Cost-Ladeinfrastruktur
C. Ladeinfrastrukturlösungen mit intelligentem Management in nicht öffentlich-
zugänglichen Räumen (Betriebshöfe, Arbeitgeberparkplätze etc.)
D. Errichtung von intelligenten Ladesystemen für das privat motivierte Parken
und Laden (Parkhaus in Mehrfamilienhäusern, öffentlich zugängliche Parkhäuser)
Die Forschungsarbeiten werden dabei in der Regel weder von der Kommune
noch von den Betreibern/Nutzern der Ladeinfrastruktur erbracht, sondern von
Forschungseinrichtungen, die in das Verbundvorhaben integriert werden. Die
Kommunen und Betreiber/Nutzer sind jedoch verpflichtet, zusammen mit der
Forschungseinrichtung ein Forschungskonzept zu entwickeln und die für die
Beforschung erforderlichen Daten zur Verfügung zu stellen.
Seite 14/51Forschungsnachrichten 02/2018 vom 27.02.2018
Förderaufruf Errichtung von Ladeinfrastruktur für
Elektrofahrzeuge ...
im Rahmen des Sofortprogramms Saubere Luft 2017 bis 2020
https://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/wexsservlet?page.navid=to_bookma
rk_official&bookmark_id=bCQcXDDHQwbu2KCMBQb
Termin: 31.03.2018
Mit dem Sofortprogramm „Saubere Luft 2017 bis 2020“ stellt die
Bundesregierung Kommunen mit besonders hoher NOX-Belastung Fördermittel
von insgesamt 1 Mrd. Euro zur kurzfristigen und nachhaltigen Verbesserung der
Luftqualität zur Verfügung.
Konkret sollen deshalb Projekte gefördert werden, die sich mit mindestens einem
der folgenden vier Themen – idealerweise werden mehrere Themen in einer -
Kommune adressiert und gebündelt dargestellt (siehe Nummer 5).
- Demonstrationsräume (Reallabore) zur Erprobung des Abbaus von
Netzausbauhemmnissen
- Low Cost-Ladeinfrastruktur
- Ladeinfrastrukturlösungen mit intelligentem Management in nicht öffentlich-
zugänglichen Räumen (Betriebshöfe, Arbeitgeberparkplätze etc.)
- Errichtung von intelligenten Ladesystemen für das privat motivierte Parken und
Laden (Parkhaus in Mehrfamilienhäusern, öffentlich zugängliche Parkhäuser)
Antragsberechtigt sind die betroffenen Kommunen (siehe Anlage) sowie
Unternehmen, Forschungseinrichtungen und sonstige juristische Personen, die
im Rahmen eines Verbundvorhabens mit einer betroffenen Kommune
zusammenarbeiten.
Das Antragsverfahren ist zweistufig. Zunächst sind Projektskizzen für das
Verbundvorhaben im Umfang von ca. 15 Seiten einzureichen. Die Projektskizzen
sind bis zum 31. März 2018 über den folgenden Link einzureichen:
https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/emo
Seite 15/51Forschungsnachrichten 02/2018 vom 27.02.2018
ANR-DFG-Förderprogramm für deutsch-französische
Forschungsprojekte in den Geistes- und Sozialwissenschaften
http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_17_86/index.
html
Termin: 15.03.2018
Seit 2007 ermöglicht das gemeinsame Abkommen zwischen der französischen
Agence Nationale de la Recherche (ANR) und der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG) zur wissenschaftlichen Zusammenarbeit in den
Geistes- und Sozialwissenschaften die Förderung integrierter deutsch-
französischer Forschungsprojekte. 2018 wird dieses Förderprogramm zum
zwölften Male ausgeschrieben.
Das Förderprogramm, das die deutsch-französische Zusammenarbeit in den
Geistes- und Sozialwissenschaften ausbauen und intensivieren möchte, stieß in
den vergangenen Jahren auf breite Resonanz in der Wissenschaft. Bereits seit
2010 wird auch dem wissenschaftlichen Nachwuchs die Möglichkeit eröffnet, in
Kooperation mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Partnerlands
eigene Projektanträge zu stellen. Diese Förderpolitik wird auch in der neuen
Ausschreibung konsequent fortgesetzt. Für Postdoktoranden und
Postdoktorandinnen besteht somit das Angebot, ein eigenes Forschungsprojekt
zu realisieren – ohne thematische Vorgaben. Dadurch wird die Basis für
nachhaltige deutsch-französische Kooperationen und Netzwerke geschaffen.
Neben der allgemeinen Intensivierung der deutsch-französischen
wissenschaftlichen Zusammenarbeit verfolgt das Programm noch zwei weitere
Ziele. Die Geistes- und Sozialwissenschaften in beiden Ländern sollen ermuntert
werden, durch die Zusammenführung national geprägter
Wissenschaftstraditionen in bestimmten Forschungsfeldern Ergebnisse zu
erarbeiten, die auch für wichtige und längst nicht mehr nationalstaatlich
begrenzte gesellschaftliche oder politische Probleme von Belang sind. Sie sollen
ferner in den Bereichen, in denen Deutsch und Französisch als
Wissenschaftssprachen nach wie vor eine Rolle spielen, die Vorzüge der
Mehrsprachigkeit auch im Wissenschaftsbetrieb nutzen und demonstrieren.
Förderanträge können bis 15. März 2018 bei der DFG beziehungsweise der ANR
eingereicht werden.
Seite 16/51Forschungsnachrichten 02/2018 vom 27.02.2018
Auf- und Ausbau integrierter Forschungs- und
Weiterbildungsprogramme für Clinician Scientists in der
Universitätsmedizin
Termin: 18.04.2018
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) schreibt die Förderung von
Clinician Scientist-Programmen in der Universitätsmedizin aus. Ziel der
Förderung ist die Verbesserung der Vereinbarkeit einer klinischen und
wissenschaftlichen Tätigkeit von Ärztinnen und Ärzten während der
Facharztweiterbildung. In der Nachwuchsförderung ausgewiesene
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind aufgerufen, Projektanträge für
den Auf- und Ausbau integrierter Forschungs- und Weiterbildungsprogramme für
Clinician Scientists einzureichen.
Die Clinician Scientist-Programme sollen einen wesentlichen Beitrag zur
Ausbildung und wissenschaftlichen Qualifikation von forschungsaktiven Ärztinnen
und Ärzten leisten. Für die Laufzeit eines Programms wird die DFG in einer
fünfjährigen Förderung 80 Prozent der Kosten für sogenannte Rotationsstellen
übernehmen, die übrigen 20 Prozent müssen von der jeweiligen Medizinischen
Fakultät übernommen werden. Im Anschluss an die DFG-Förderung sollen die
Programme nachhaltig in der Universitätsmedizin verankert werden.
Das Clinician Scientist-Programm kann an einer übergeordneten
wissenschaftlichen Fragestellung ausgerichtet sein. Alternativ können aber auch
die am Ort vorhandenen wissenschaftlichen Schwerpunkte die wissenschaftliche
Grundlage des Programms bilden. Auch die Konzeption als übergeordnete
Dachstruktur bei bereits bestehenden Clinician Scientist-Programmen sowie
deren Ausbau ist möglich. In allen Fällen sind die wissenschaftlichen Leitthemen
oder das Leitthema im Antrag darzulegen.
Darüber hinaus ist zu erläutern, wie das Clinician Scientist-Programm in
bestehende Strukturen, wissenschaftliche Schwerpunkte der Medizinischen
Fakultät sowie am Ort vorhandene Forschungsverbünde integriert wird.
Die wissenschaftlichen Projekte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des
Clinician Scientist-Programms sowie die Arbeitsgruppen, in denen diese Projekte
durchgeführt werden sollen, müssen international kompetitiv sein. In einem
Antrag muss daher dargelegt werden, wie dies sichergestellt wird.
Im Antrag sollen darüber hinaus u. a. folgende Punkte berücksichtigt werden:
Seite 17/51Forschungsnachrichten 02/2018 vom 27.02.2018
- Qualifizierungs- und Mentoringkonzept
- Rekrutierungskonzept
- Interne Organisationsstruktur
- Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in
der Wissenschaft und zur Vereinbarkeit von wissenschaftlicher Karriere und
Familie
- Nachhaltigkeitskonzept
Der Antrag auf Förderung eines Clinician Scientist-Programms wird gemeinsam
von mehreren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern konzipiert. Die
Beantragung erfolgt durch eine Person als alleinige Antragstellerin
beziehungsweise alleiniger Antragsteller, die im Hauptamt Hochschullehrerin
beziehungsweise Hochschullehrer ist und an einer Medizinischen Fakultät tätig
ist. Die an der Konzeption des Antrags beteiligten Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler übernehmen die Rolle von Mitverantwortlichen. Von den am
Antrag beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern werden eine
besondere wissenschaftliche Qualifikation sowie ausgewiesene Erfahrungen in
der Nachwuchsbetreuung erwartet.
Die Gesamtförderdauer des Clinician Scientist-Programms beträgt fünf Jahre. Die
erste Förderperiode beträgt drei Jahre. Über eine Weiterförderung von zwei
Jahren wird nach Begutachtung auf Basis von Fortsetzungsanträgen
entschieden. In der ersten Förderperiode können jährlich bis zu acht Personen
für jeweils drei Jahre in das Clinician Scientist-Programm neu aufgenommen
werden. Die im Anschluss an die erste Förderperiode notwendige Finanzierung
für die im zweiten und dritten Jahr aufgenommenen Personen stellt die DFG nach
erfolgreicher Fortsetzungsbegutachtung bereit.
Bei Antragstellung muss eine schriftliche Zusicherung der Medizinischen Fakultät
über eine 20-prozentige Gegenfinanzierung der beantragten Rotationsstellen mit
eingereicht werden.
Um eine internationale Begutachtung zu ermöglichen, wird gebeten, den Antrag
und die Anlagen zum Antrag in englischer Sprache zu verfassen. Die Einreichung
des Antrags ist ausschließlich über das elan-Portal der DFG vom 21. März 2018
bis 18. April 2018 möglich.
Seite 18/51Forschungsnachrichten 02/2018 vom 27.02.2018
Cooperation between DFG, FNI and NSTC: Possibility for Projects
between Germany, Mozambique and Zambia in the Field of
Agricultural Sciences
http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_17_88/index.
html
Termin: 15.03.2018
To facilitate and foster collaborative work between research teams from
Germany, Mozambique and Zambia, the Deutsche Forschungsgemeinschaft
(DFG, German Research Foundation), the Fundo Nacional de Investigação (FNI)
of Mozambique, and the National Science and Technology Council (NSTC) of
Zambia have issued a call for joint project proposals for the funding period 2018
to 2020 in the field of agricultural and livestock sciences. Collaborations of
research teams from these countries are invited to submit bilateral or trilateral
proposals with at least one partner in Germany and one partner in Mozambique
or Zambia respectively.
The following are the thematic area of focus:
crop sciences (including plant breeding, plant genetics and genomics, plant
health, crop production)
livestock sciences (including animal breeding, genetic improvement of livestock,
livestock production, animal nutrition, livestock health and veterinary medicine)
agro-ecological systems in Zambia and Mozambique including socioeconomic
aspects
Support will be granted only to those proposals where the respective partner
organisations recommend funding. Please note that at the DFG there are no
separate funds available for these efforts, proposals must succeed on the
strengths of their intellectual merit and teams.
The proposal must include a description of the full proposed research programme
and research team and describe the total resources for the joint project (that is,
the funds requested for both the African partners and German groups). All
applicants are requested to use the Joint Project Description Template.
Submission Date and Acceptance of the Grant Offer:
Seite 19/51Forschungsnachrichten 02/2018 vom 27.02.2018
In accordance with the proposal target date of the FNI and NSTC, proposals to
the DFG should be submitted not later than 15 March 2018.
Please note that the African partners must accept the grant offer within one
month and start the project within six months.
Seite 20/51Forschungsnachrichten 02/2018 vom 27.02.2018
DFG-GACR Cooperation: Possibility for Joint German-Czech
Research Projects
Funding Period 2019–2021
http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_17_90/index.
html
Termin: 03.04.2018
On the basis of their long standing cooperation and the respective Memorandum
of Understanding the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German
Research Foundation) and the Czech Science Foundation (GACR) have opened
the possibility for funding of joint German-Czech projects in all areas of basic
research for the period of 2019–2021.
These joint proposals have to be based on a close interaction between the
German and Czech research teams and should present joint project goals and a
joint work plan with balanced contributions from all project partners. Proposals
without strong interaction between the partners should be submitted as separate
proposals in the standard funding schemes of DFG and GACR.
At the DFG the proposals in this call are submitted in the funding scheme
“Sachbeihilfe/Research Grants” and will be reviewed in competition with all other
proposals in this scheme. It is important to note that there are no separate funds
available for these efforts, proposals must succeed on the strengths of their
intellectual merit in competition with all other proposals in the funding scheme
“Sachbeihilfe/Research Grants”. All proposals will be reviewed by both
organisations separately. The results of the review process will be shared
between the agencies. Support will be granted for those proposals where both
DFG and GACR recommend funding.
In accordance with the full proposal target date of GACR proposals to the DFG
should be submitted no later than 3 April 2018. The next call for the funding
period of 2020–2022 is foreseen for late 2018.
Seite 21/51Forschungsnachrichten 02/2018 vom 27.02.2018
DFG-RFBR Cooperation: Possibility for Joint German-Russian
Research Projects
Funding Period 2019–2021
http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_17_91/index.
html
Termin: 01.03.2018
On the basis of their long standing cooperation and the respective Memorandum
of Understanding the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German
Research Foundation) and the Russian Foundation for Basic Research (RFBR)
have opened the possibility for funding of joint German-Russian projects in all
areas of basic research for the period of 2019–2021.
These joint proposals have to be based on a close interaction between the
German and Russian research teams and should present joint project goals and
a joint work plan with balanced contributions from all project partners. Proposals
without strong interaction between the partners should be submitted as separate
proposals in the standard funding schemes of DFG and RFBR.
At the DFG the proposals in this call are submitted in the funding scheme
“Sachbeihilfe/Research Grants” and will be reviewed in competition with all other
proposals in this scheme. It is important to note that there are no separate funds
available for these efforts, proposals must succeed on the strengths of their
intellectual merit in competition with all other proposals in the funding scheme
“Sachbeihilfe/Research Grants”. All proposals will be reviewed by both
organisations separately. The results of the review process will be shared
between the agencies. Support will be granted for those proposals where both
DFG and RFBR recommend funding.
In accordance with the full proposal target date of RFBR proposals to the DFG
should be submitted no later than 1 March 2018. The next call for the funding
period of 2020–2022 is foreseen for late 2018.
Seite 22/51Forschungsnachrichten 02/2018 vom 27.02.2018
Joint Sino-German Research Projects
http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_18_03/index.
html
Termin: 07.03.2018
he present initiative is a bilateral funding measure by two funding bodies: the
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foundation) and
the National Natural Science Foundation of China (NSFC). The programme
succeeds the former Joint Research Projects funded by the Sino-German Center
for Research Promotion.
This initiative aims to bring together relevant and competitive researchers from
Germany and China to design and carry out jointly organised research projects.
Funding within this initiative will be available for collaborative research projects
consisting of researchers from both partner countries. Within these research
teams, each national funding organisation will fund as a rule only those project
components that are carried out within its own country. The collaborative
research projects must involve active communication and cooperation between
the participating researchers. The collaborative projects selected to take part in
the initiative will receive research funding for a period of up to three years.
The objectives of the initiative are:
- to promote high-quality research projects in the participating countries
- to stimulate mobility of researchers between the participating countries
- to promote training of researchers
- to accelerate the exchange of new scientific knowledge among researchers and
between researchers and other interested groups
The present initiative is open to joint research projects in all fields of the natural,
life, management and engineering sciences.
This call for proposals is open to researchers based at universities, academic
institutions and research centres in Germany and China. Funding is available for
bilateral collaborative research projects comprising researchers from the two
participating countries. Within a research project, contributions from Germany
and China should be roughly balanced with regard to scientific contents.
Seite 23/51Forschungsnachrichten 02/2018 vom 27.02.2018
Applicants are required to fulfil any national requirements for funding and follow
the general regulations of their respective funding organisation (see below).
Applications that do not meet these requirements will not be considered.
The assessment of all proposals will be based on a peer review process.
Collaborative projects suitable for joint funding will be selected based on this
assessment.
Applicants of a bilateral collaborative project within this call must submit their joint
application to their respective national funding organisation. Chinese applicants
submit their documents to NSFC, German applicants to DFG, following the formal
requirements of their respective funding organisation. All documents must be
written in English. Please note that the documents submitted at DFG and NSFC
must not differ with regard to the scientific content of the proposal.
Additional specific requirements for German and Chinese applicants are outlined
below. Applications arriving late and applications not fulfilling the national
requirements will not be considered. No legal entitlement can be derived from the
submission of a project description.
All proposals must be submitted by 7 March 2018.
Seite 24/51Forschungsnachrichten 02/2018 vom 27.02.2018
Neues DFG-Förderprogramm „Gerätezentren – Core Facilities“
http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2017/info_wissenschaft_17_95/i
ndex.html
Der Hauptausschuss der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) hat das
Förderangebot für gerätebezogene Forschungsinfrastruktur im Juli 2017 neu
strukturiert und weiterentwickelt. Infolgedessen steht ab sofort das neue
Förderprogramm „Gerätezentren – Core Facilities“ zur Verfügung, um Anträge
einzureichen.
In diesem Programm stehen Nutzungs- und Managementkonzepte im
Vordergrund, um eine Professionalisierung des Betriebs und Managements von
Gerätezentren zu fördern und die Bildung von stabilen Strukturen für die Nutzung
dieser Zentren zu unterstützen. Antragsteller sind formal die Hochschulen; diese
bestimmen eine antragsverantwortliche Person, die die wissenschaftliche
Federführung innehat.
Die maximale Förderdauer eines Gerätezentrums beträgt fünf Jahre.
Hochschulen können für diesen Zeitraum Mittel in einem Umfang von i.d.R. bis zu
150 000 Euro pro Jahr beantragen. Die Anschaffung von Großgeräten wird in
diesem Programm nicht gefördert.
Anträge können ab sofort gemäß DFG-Merkblatt 21.5 eingereicht werden; von
den dortigen Angaben abweichend aber bis voraussichtlich Ende April 2018 nicht
über das elan-Portal der DFG, sondern ausschließlich auf elektronischem
Datenträger per Post oder per E-Mail (max. 10 MB) mit dem Betreff
„Gerätezentren“ an Link auf E-Mailwgi@dfg.de.
Ansprechpartner in der DFG:
Für allgemeine Fragen:
Herr Dr. Manfred Mürtz, Tel. 0228 885-2432, Email: manfred.muertz@dfg.de
Für administrative Fragen:
Frau Claudia Ihlefeldt, Tel. 0228 885-2302, E-Mail: claudia.ihlefeldt@dfg.de
Da die DFG "die Bereitschaft der antragstellenden Hochschule, das betreffende
Zentrum finanziell mit Personal- und Sachmitteln zu unterstützen und auch nach
Förderende weiterzuführen" voraussetzt, ist eine Koordination über Dezernat 5,
SG 5.1 zwingend erforderlich.
Seite 25/51Forschungsnachrichten 02/2018 vom 27.02.2018
Erste Ansprechpartnerin: Frau Behnke, Tel: -33772, E-Mail:
gerlinde.behnke@tu-dresden.de
Seite 26/51Forschungsnachrichten 02/2018 vom 27.02.2018
Priority Programme “Epithelial Intercellular Junctions as Dynamic
Hubs to Integrate Forces, Signals and Cell Behaviour” (SPP 1782)
http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_17_84/index.
html
Termin: 01.05.2018
Epithelia line organ and body surfaces to provide structural support and serve as
barriers against diverse external stressors such as mechanical force, pathogens,
toxins, and dehydration. Further, they separate different physiological
environments and are instrumental during morphogenesis. Epithelial functions
depend greatly on the ability of intercellular junctions to sense and integrate
chemical signals and mechanical forces. They transmit these into cells to direct
rapid changes in cell architecture and/or transcriptional programming, thus
directing cellular behaviour. Understanding at a mechanistic level how
intercellular junctions sense their neighbours, chemical signals and force, and
conversely, how the cytoskeleton feeds back to intercellular junctions, will be
central to comprehend control of tissue morphogenesis, homeostasis and
regeneration. Further, elucidating how defects in intercellular junction
components by-pass junction-mediated control of epithelial tissue integrity is a
prerequisite to understand the basis of multiple disorders including epithelial
inherited fragility disorders, inflammation and cancer.
The primary goal of the Priority Programme is to understand how intercellular
junctions sense and respond to chemical and mechanical signals from their
external environment and from the cytoskeleton and how they convert these
signals into processes that instruct epithelial morphogenesis, differentiation and
pathogenesis. Current participating scientists have established interdisciplinary,
collaborative projects, ranging from the level of molecules to cells, tissues and
model organisms, combining biophysical, biochemical, cell biological and
physiological techniques.
Applications must be written in English and submitted by 1 May 2018 via the
electronic elan system. Furthermore, please send an electronic version (pdf
format) of the application to the coordinator of the Priority Programme.
Seite 27/51Forschungsnachrichten 02/2018 vom 27.02.2018
Priority Programme “Experience and Expectation: Historical
Foundations of Economic Behaviour” (SPP 1859)
http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_17_79/index.
html
Termin: 01.06.2018
While the Priority Programme focusses on economic history, its goals are best
met by a broad collaboration involving researchers from different disciplines. We
invite researchers from history, economics, law, and the social and behavioural
sciences to submit proposals for research projects.
Research Questions
Economic decision-making takes place in a complex environment under
uncertainty. To reduce uncertainty, economic actors rely on expectations about
the future development of economic key variables. The central purpose of this
Priority Programme is to investigate how these expectations are formed. The
basic hypothesis is that the formation of expectation is not a uniform,
standardised and time-invariant process but depends on specific historical factors
and circumstances.
The Priority Programme aims at a close integration of historical and economic
methods. Three questions dominate our research: First, how does historical
experience shape expectations of the future? Second, do expectations change
across space and/or time because of differences in culture, institutions, or
technology? Third, how do expectations change in the short term due to
economic crises or exogenous shocks? The common goal of our interdisciplinary
approach is to contribute to the theory of economic expectations by studying
historical processes of expectation formation. A central task of this programme is
to identify new historical sources which will help us reconstruct empirically
processes of expectation formation, and to implement new methods for their
analysis.
Structure and Project Design
In this Priority Programme, scholars from different universities and research
institutes work together to shed light on the historical dimension of the formation
of economic expectations. Currently, the programme combines the expertise of
economists, historians, economic sociologists, and legal historians. Workshops
Seite 28/51Forschungsnachrichten 02/2018 vom 27.02.2018
organised independently by joint projects serve to facilitate their cooperation on
common methods and topics. International scholars are invited to foster
cooperation with non-German universities.
The core research areas for which the programme invites proposals include:
- financial markets, crises, and phenomena of speculation
- firms, innovation, and technological change
- households and consumer behaviour
- economic policy and regulation
- experts and scientific forecasting
- history of economic knowledge
Proposals must be written in English and submitted to the DFG by 1 June 2018.
Seite 29/51Forschungsnachrichten 02/2018 vom 27.02.2018
Priority Programme “Quantum Dynamics in Tailored Intense
Fields (QUTIF)” (SPP 1840)
http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_17_80/index.
html
Termin: 14.03.2018
In this Priority Programme, the dynamics of strongly perturbed quantum systems
is to be investigated in the nonrelativistic regime with tailored radiation fields on
the femtosecond and attosecond time scale. By combining experimental and
theoretical expertise and bringing together the fields of optics, quantum dynamics
and chemistry, the programme aims to achieve milestones such as the control
and observation of subfemtosecond charge migration or the laser-based
recognition and manipulation of chiral molecules. The main focus lies on gas-
phase systems, in order to watch microscopic phenomena with minimal
disturbance by their environment. Proposals for this Priority Programme should
take the control of microscopic processes with light to a new level.
Proposals must be written in English and submitted to the DFG by 14 March
2018.
Seite 30/51Forschungsnachrichten 02/2018 vom 27.02.2018
Schwerpunktprogramm „Elektromagnetische Sensoren für Life
Sciences (ESSENCE)“ (SPP 1857)
http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_17_78/index.
html
Termin: 27.03.2018
Die Leitidee des Schwerpunktprogramms ist die Etablierung interdisziplinärer
Forschung auf dem Gebiet elektromagnetischer Sensoren – deren Messprinzip
auf der Wechselwirkung zwischen den elektromagnetischen Feldern der
Sensoren und den zu untersuchenden oder nachzuweisenden Biomolekülen,
Zellen, biologischem Gewebe oder Stoffgemischen basiert – mit Fokus auf die
obigen Anwendungsfelder in den Lebenswissenschaften. Neben den möglichen
praktischen Einsatzfeldern in der Medizin, Biologie, Pharmakologie,
Lebensmittelchemie, Agrartechnik und Umweltanalytik/Umweltmonitoring, die
sich beispielsweise vom klinischen Bereich über Point-of-Care-Anwendungen bis
hin zur Labor- und Freifelddiagnostik erstrecken, ist auch die
Grundlagenforschung von besonderem Interesse, zum Beispiel in der
Molekularbiologie und Toxikologie. Die gesellschaftliche Relevanz dieser
Thematik ergibt sich aus dem großen Potenzial zur unmittelbaren Verbesserung
der Lebensqualität, unter anderem durch schnellere, exaktere und einfacher
anzuwendende Analyse- und Diagnoseformen und darüber hinaus durch
Möglichkeiten für neue Therapien.
Wissenschaftliches Ziel und Aufgabe ist die grundlegende interdisziplinäre
Erforschung neuartiger Prinzipien, Konzepte und Technologien
elektromagnetischer Sensoren im Mikrowellen-, Millimeterwellen- und Terahertz-
Bereich (300 Megahertz bis 10 Terahertz). Diese zu untersuchenden
Sensorklassen reichen von einzelnen, dedizierten Sensoren über Sensorarrays
bis hin zu komplexen Multifunktionssensoren, teilweise in Kombination mit
neuartigen zugeschnittenen Oberflächenfunktionalisierungen für
elektromagnetische „Transducer“ im oben genannten Frequenzbereich. Dies
umfasst beispielsweise neue Forschungsansätze für Sensoren zum Nachweis
und der Beobachtung spezifischer Moleküle sowohl organischer als auch
anorganischer Natur. Weiterhin ist die messtechnische Beobachtung von
vereinzelten Zellen und Zellkulturen von hoher Relevanz, zum Beispiel in
Biofilmen sowie (human-)biologischen und medizinischen Versuchsreihen, wie
sie sowohl in der Grundlagenforschung als auch in der angewandten Analyse
und Diagnostik und dem Pflanzenschutz üblich sind. Zuletzt dienen die Sensoren
der Charakterisierung großer Zellverbände und Gewebe zum Beispiel zur
Seite 31/51Forschungsnachrichten 02/2018 vom 27.02.2018
Krebsvorsorge und -behandlung, mobiler medizinischer Vorortversorgung oder
vielfältiger minimalinvasiver Diagnoseverfahren im klinischen Bereich.
Reichen Sie Ihren Antrag für die zweite Förderphase bitte bis spätestens 27.
März 2018 bei der DFG ein. Die Antragstellung erfolgt ausschließlich über das
elan-Portal zur Erfassung der antragsbezogenen Daten und zur sicheren
Übermittlung von Dokumenten. Sofern Sie beabsichtigen, einen Neuantrag
einzureichen, wählen Sie bitte unter „Antragstellung – Neues Projekt –
Schwerpunktprogramm“ im elektronischen Formular aus der angebotenen Liste
„SPP 1857 – Elektromagnetische Sensoren für Life Sciences (ESSENCE)“ aus.
Seite 32/51Forschungsnachrichten 02/2018 vom 27.02.2018
Schwerpunktprogramm „Kooperativ interagierende Automobile“
(SPP 1835)
http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_17_93/index.
html
Termin: 04.04.2018
Das Schwerpunktprogramm konzentriert sich in der nun anstehenden zweiten
Phase auf folgende Themenbereiche:
- Kooperative Wahrnehmung
- Situationsprädiktion
- Kooperative Manöver- und Trajektorienplanung
- Daten und Informationsbasis
- Systemergonomie
- Querschnittsthemen kooperativ interagierender Automobile
Die Projektanträge sollen explizit erläutern, welcher der genannten
Themenbereiche schwerpunktmäßig adressiert wird, warum die untersuchte
Fragestellung dafür relevant ist, welche neuartigen wissenschaftlichen Ansätze
und Methoden für die Lösung erforscht werden sollen und welche Ergebnisse bei
erfolgreichem Verlauf entstehen und gegebenenfalls auch anderen
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zur Verfügung gestellt würden.
Interdisziplinäre Anträge sowie Projekte, die eine Bewertung im
Zusammenwirken mit anderen Projekten ermöglichen, sind ebenso besonders
erwünscht wie Ansätze, die ein konkretes Potenzial für die Umsetzung auf
Erprobungsplattformen aufzeigen.
Arbeiten, die den Schwerpunkt auf Fahrerassistenzfunktionen oder die
eigenständige Automatisierung einzelner Fahrzeuge ohne kooperative Interaktion
legen, sowie Projekte, die nur singuläre Komponenten (Car2X, Aktorik usw.) im
Blick haben, liegen hingegen nicht im Fokus des Schwerpunktprogramms.
Reichen Sie Ihren Antrag für die zweite Förderphase bitte bis spätestens 4. April
2018 bei der DFG ein.
Seite 33/51Forschungsnachrichten 02/2018 vom 27.02.2018
Seite 34/51Forschungsnachrichten 02/2018 vom 27.02.2018
TWAS-DFG Cooperation Visits Programme
Ausschreibung von TWAS, The World Academy of Sciences for the
Advancement of Science in Developing Countries
http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_17_81/index.
html
Termin: 31.03.2018
Auf Grundlage der Vereinbarung mit The World Academy of Sciences for the
Advancement of Science in Developing Countries (TWAS) macht die Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG) Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an
deutschen wissenschaftlichen Einrichtungen auf die Möglichkeit aufmerksam,
promovierte Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler aller
Fachrichtungen aus Subsahara-Afrika zu einem dreimonatigen Forschungs- und
Kooperationsaufenthalt an ihre Institution einzuladen.
Die DFG zahlt der Gastgebereinrichtung eine monatliche Pauschale zur Deckung
der Aufenthaltskosten des Gastes und dessen Visakosten sowie eine monatliche
Pauschale für Projektausgaben der Institution, beispielsweise für Verwaltungs-,
Material- und Laborkosten. Für die Gastwissenschaftlerinnen und
-wissenschaftler selbst stellt die DFG die Flug- und Bahntickets vom
Heimatflughafen zum Gastgeberinstitut und die Auslandskrankenversicherung
zur Verfügung.
Antragsvoraussetzungen sind:
Herkunft aus einem Land Subsahara-Afrikas und
Forschungstätigkeit an einer Universität oder Forschungseinrichtung in einem
Land Subsahara-Afrikas;
Erlangung der Promotion nicht länger als fünf Jahre vor der Deadline;
Antragstellerinnen und Antragsteller dürfen nicht schon in Deutschland tätig sein.
Der Antrag ist von den Gastwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern bis
spätestens 31. März 2018 bei TWAS einzureichen.
Weiterführende Informationen
Seite 35/51Forschungsnachrichten 02/2018 vom 27.02.2018
Weitere Informationen zum TWAS-DFG Cooperation Visits Programme und zu
allen Antragsunterlagen:
https://twas.org/opportunity/twas-dfg-cooperation-visits-programme
Seite 36/51Forschungsnachrichten 02/2018 vom 27.02.2018
Trilaterale Forschungskonferenzen 2019–2021
http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2018/info_wissenschaft_18_05/i
ndex.html
Termin: 30.04.2018
ie Geistes- und Sozialwissenschaften sind kultur- und sprachgebunden. Sprache
und Kultur sind ihr Gegenstand und ihr Medium. Um den Austausch und die
Netzwerkbildung zwischen Geistes- und Sozialwissenschaftlerinnen und
-wissenschaftlern aus Deutschland, Frankreich und Italien nachhaltig zu fördern
und dabei den Gebrauch von Deutsch, Französisch und Italienisch als
Wissenschaftssprachen ausdrücklich zu unterstützen, haben die Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG), die Fondation Maison des Sciences de
l’Homme (FMSH) und die Villa Vigoni das Programm „Trilaterale
Forschungskonferenzen“ entwickelt, in dem Mehrsprachigkeit ein tragendes
Prinzip ist.
Format
Jede Trilaterale Forschungskonferenz besteht aus einer Serie von drei
Veranstaltungen, die möglichst im Jahresrhythmus aufeinanderfolgen. Alle drei
Treffen finden in der Villa Vigoni statt. Vorgeschlagen werden können Projekte
aus allen Bereichen der Geistes- und Sozialwissenschaften. Die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer einer Forschungskonferenz bestehen aus einer Kerngruppe von
bis zu 15 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus den drei beteiligten
Ländern. Diese Gruppe bleibt während aller Treffen gleich. Ausdrücklich
erwünscht ist die Beteiligung von Nachwuchswissenschaftlerinnen und
-wissenschaftlern. Diese sind zudem ausdrücklich eingeladen, eigenständig
Forschungskonferenzen zu beantragen. An den Arbeitstreffen können in
begrenztem Umfang Gäste beteiligt werden. Diese müssen nicht zwingend aus
Deutschland, Frankreich oder Italien stammen. Die Förderung durch die drei
Partner erstreckt sich nicht auf die Gäste. Die DFG ermöglicht deutschen
Bewilligungsempfängerinnen und -empfängern, Mittel für Gäste aus Viertländern
zu verwenden, wenn deren Teilnahme sich aus der Sache begründet. Dies führt
jedoch nicht zu einer Erhöhung der Gesamtbewilligung.
Arbeitssprachen einer Trilateralen Forschungskonferenz sind Deutsch,
Französisch und Italienisch.
Verfahren
Seite 37/51Sie können auch lesen