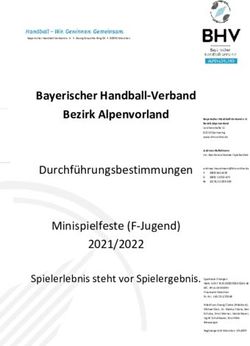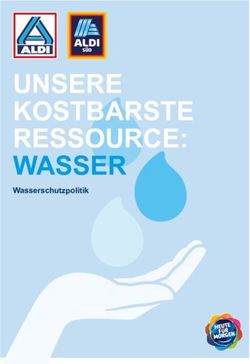Information Bernried Erdwärme Energie aus tiefer Überzeugung - September 2009
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Information
Bernried Erdwärme
Energie aus tiefer Überzeugung
September 2009
Fragen und Antworten Bernried Erdwärme - 2.9.2009 Seite 1 von 9Kurzbeschreibung
Die Gemeinde Bernried und die Projektgesellschaft BE Geothermal GmbH planen im Norden
von Bernried am Starnberger See ein hydrothermales Erdwärmekraftwerk zur Erzeugung
von Strom und Fernwärme. Die geplante vertikale Bohrtiefe beträgt für die zwei
Förderbohrungen ca. je 4.900m und für die zwei Rückflussbohrungen etwa je 4.300m.
Thermalwasser mit ca. 150°C und einer Schüttung von bis zu 125 l/sec werden pro
Förderbohrung erwartet. Geplanter Baubeginn ist Anfang 2010 nach Auswertung der 3D
seismischen Messkampagne. Das Kraftwerk hat eine Brutto-Leistung von 9 - 11 MW
elektrisch: bei einer geplanten Auslastung von über 90% wird es netto (d.h. nach Abzug des
Eigenverbrauchs) 55 GWh Strom pro Jahr produzieren. Das Kraftwerk soll die Gemeinde
Bernried, die Klinik Höhenried und eventuell den Süden der Gemeinde Tutzing mit
umweltfreundlicher Fernwärme versorgen.
Für die Landwirtschaft könnten sich zusätzliche Nutzen entwickeln: mit der Wärme, die
insbesondere im Sommer von den Haushalten wenig gebraucht wird, könnte z.B. während
der Wuchs- und Erntezeit eine Futtertrocknungsanlage betrieben werden.
Ein solches Kraftwerk spart 50.000 Tonnen CO2 pro Jahr und versorgt etwa 15.000
Haushalte mit Strom. Es ist vergleichbar mit etwa 24 Windrädern, wobei im Gegensatz zu
Wind- oder Solarenergie die Energie aus Erdwärme grundlastfähig ist, d.h. sie steht immer
zur Verfügung. Um die gleiche Wärme- und Strommenge zu erzeugen, müsste man etwa
120.000 Raummeter (60.000t) Buchen-Brennholz pro Jahr verbrennen.
Das Geothermie-Kraftwerk Bernried wird helfen, die Energieziele des Landkreises Weilheim
zu erreichen. So wie andere Landkreise in Oberbayern möchte man im Jahr 2020 den CO2
Ausstoß um 40% gegenüber dem Stand von 1999 reduzieren. Damit schließt sich Weilheim
als Landkreis dem deutschen Reduktionsziel von ebenfalls 40% bis zum Jahr 2020 an.
Viele Generationen können die Energie aus der Tiefen Geothermie nutzen: rechnerische
Modelle anderer Projekte zeigen, das nach 50 Jahren Nutzung das Thermalwasser an der
Produktionsbohrung um nur 1°C kälter wird. Die Nutzungsdauer kann mit über 100 Jahren
geschätzt werden.
Die positive ökologische Bilanz und die absolute Sauberkeit von Erdwärme passen
hervorragend in die Leitbilder der Gemeinden am Starnberger See. Landschaftspflege und
Naturschutz gelten hier schon immer als höchste Priorität. Diesem Leitbild entsprechend
orientiert sich die Projektentwicklung im Feld Bernried an hohen ökologischen Standards.
Aktuell wird in Bernried, Wielenbach, Seeshaupt und Tutzing eine 3D seismische
Messkampagne durchgeführt. Diese Messung soll den Untergrund für die geplanten
Bohrungen transparent machen. Insbesondere die wasserführende Kalkschicht (Malm) in
etwa 4.000m bis 5.000m Tiefe soll vor den Bohrungen in seiner Struktur genau bekannt sein.
Ergebnis ist die Bestimmung der möglichen Bohrplätze bzw. Standorte.
Fragen und Antworten Bernried Erdwärme - 2.9.2009 Seite 2 von 9Fragen und Antworten zum Geothermie-Projekt Bernried
Wie sieht das Projekt aus und was passiert mit dem Thermalwasser?
Für das Geothermie-Kraftwerk Bernried werden von 2 Standorten jeweils 2 Bohrungen
abgeteuft werden. 2 Bohrungen sollen Produktionsbohrungen werden (aus diesen wird
Thermalwasser gefördert) und 2 Reinjektionsbohrungen (Rückführungsbohrungen). Durch
diese Bohrungen wird das abgekühlte Thermalwasser wieder in den Untergrund geleitet.
Beide Standorte werden durch eine Thermalwasserpipeline miteinander verbunden. Die
Pipeline ist isoliert und wird unterirdisch verlegt. Das Thermalwasser fließt in einem
geschlossenen Kreislauf; es wird kein Thermalwasser entnommen. Eventuell im
Thermalwasser enthaltene Stoffe bzw. Gase können nicht in die Umwelt gelangen. Am
Standort der Produktionsbohrungen soll die Stromerzeugung und Fernwärmeerzeugung
durchgeführt werden. Am Standort der Reinjektionsbohrungen werden die
Bohrlochverschlüsse und ein kleines Pumpenhaus bleiben.
Wozu werden seismische Messungen ausgeführt?
Um den Standort der Bohrungen ausfindig zu machen, wird über die im August und
September 2009 durchgeführte seismische Messung der Untergrund in etwa 4.000m bis
5.000m erkundet. Erst nach vorliegen der Ergebnisse können schlussendlich die Bohrziele
und somit Plätze für Produktionsbohrungen und Reinjektionsbohrungen festgelegt werden.
Die Messungen werden aufwendig und intensiv ausgewertet, sodass die Standorte
voraussichtlich erst Mitte Dezember 2009 festliegen werden.
Wo könnten die Reinjektionsbohrungen sich befinden?
Aktuell gehen wir davon aus, dass sich der Standort für die Reinjektionsbohrungen im Osten
von Haunshofen befinden wird. Dies wird durch die seismische Messungen jedoch erst
bestätigt werden müssen.
Wo befindet sich das geplante Kraftwerk mit den Produktionsbohrungen?
Der Standort ist im Nord-Westen von Bernried, zwischen Bernried und Kampberg
vorgesehen.
Sehen Sie die vorläufigen Standorte auf Seite 8.
Warum ist die Planung so vorgesehen?
Die beiden Standorte wurden durch die geologische Vorerkundung auf Basis von
vorhandenen seismischen Messungen grob festgelegt. Diese alten Messdaten aus den
siebziger Jahren zeigen eine sehr günstige Struktur für das Gewinnen von geothermischer
Energie in einem etwa 4 km breiten Streifen, dessen Mitte sich auf der Line Unterzeismering
– Haunshofen befindet. Nur hier kann – nach dem jetzigen Stand der Erkundung – das
Thermalwasser in ausreichender Menge gefunden werden.
Fragen und Antworten Bernried Erdwärme - 2.9.2009 Seite 3 von 9Wird man das Kraftwerk von weitem sehen können?
Das Kraftwerk wird nach jetziger Standortplanung mit den vorgesehenen Kühlsystemen eine
Bauhöhe von etwa 10m erreichen. Dies ist wesentlich niedriger als der umliegende
Baumbestand. Nach jetzigem Planungsstand ist eine Luftkühlung vorgesehen, die keine
Dampfwolken produziert (sehen Sie die Skizze auf Seite 9).
Womit kann die Leistung des Kraftwerkes verglichen werden?
Die Leistung entspricht etwa der von 24 Windrädern der 2MW Klasse mit einer Nabenhöhe
von 80 m – die preiswerter wären, allerdings nur Strom produzieren, wenn Wind weht. Im
Vergleich zur Photovoltaik müsste bei einer Leistung von 1.000kWh pro Jahr und
installiertem 1-Kilowatt-Modul eine Fläche von etwa 1 Quadratkilometer bebaut werden. Die
Kosten wären deutlich höher wie bei einem Geothermiekraftwerk. Wind und Photovoltaik
können zudem keine Wärme liefern. Geothermiestrom ist die ideale Ergänzung zu diesen
beiden Stromerzeugungsarten, da dieser Strom Tag und Nacht produziert wird.
Wie arbeitet das Kraftwerk?
Das Thermalwasser gibt in einem Wärmetauscher die Wärmeenergie an ein Arbeitsmedium
ab. Dieses Arbeitsmedium hat einen niedrigen Siedepunkt und erzeugt bei den geplanten
Temperaturen von etwa 150°C ausreichend Dampfdruck. Der im Wärmetauscher
entstehende Dampf wird auf eine Turbine geleitet, die mit einem Generator gekoppelt ist.
(ORC-Prozess, ein Standard, der weltweit mit guten Erfahrungen gebaut wird). Die
Restwärme wird dem Fernwärmesystem zur Verfügung gestellt. Das Kraftwerk wird
unterirdisch an das Fernwärmenetz und das Stromnetz angeschlossen. Die
Thermalwasserpipeline zu den Reinjektionsbohrungen wird auch unterirdisch verlegt. Das
Kraftwerk wird nach jetzigen Planungen eine Fläche von 80m auf 100m benötigen.
Wie sieht die Ökobilanz der Tiefen Geothermie aus?
Die Analyse ausgewählter Umwelteffekte der geothermischen Stromerzeugung und ihrer
Alternativen kann mit Hilfe der Ökobilanz-Methodik bewertet werden. Hierbei werden die
Umwelteffekte über den gesamten Lebensweg der Anlagen – Bau, Betrieb, Abriss und
Nachsorge – und mit sämtlichen relevanten vor- und nachgelagerten Prozessen bilanziert.
Dieses schließt die Produktion benötigter Stoffe ebenso ein wie anfallende Transporte,
Bereitstellung benötigter Infrastruktur und Dienstleistungen (Planung, Instandhaltung usw.).
Durchgeführt wurde die Analyse vom Institut für Energetik (Kaltschmitt et al. 2002) im
Auftrag des Deutschen Bundestages (TAB Studie). Die Ergebnisse waren sehr ermutigend,
und aus diesem Grund beschloss der Bundestag auch die Entwicklung der Geothermie zu
fördern. Die Stromerzeugung aus Geothermie in Verbindung mit einer Wärmeauskopplung
wird beim Primär-Energieverbrauch nach der Ökobilanz-Methode mit 281 GJ/GWh hier etwa
auf das gleiche Niveau wie die Wasserkraft mit 203 GJ/GWh gestellt. Vergleich Windenergie
649 GJ/GWh und Photovoltaik 3.448 GJ/GWh.
Entstehen Geräusche beim Herstellen der Bohrungen?
Da heutige Bohranlagen mit Elektro-Motoren angetrieben werden, ist von den
Bohrungsarbeiten nur sehr wenig zu hören. Je nach Abstand zu den Siedlungen kann eine
Fragen und Antworten Bernried Erdwärme - 2.9.2009 Seite 4 von 9geräuschdämmende Maßnahme erforderlich werden. Dabei ist es am sinnvollsten, die
Schallquelle zu dämmen, zum Beispiel den Bohrmotor zusätzlich zu kapseln. Eine
Schallschutzwand ist weniger wirksam. Die zuständigen bayerischen Behörden fordern hier
äußerst strenge Umweltauflagen und kontrollieren diese regelmäßig.
Wie wird bei einer geothermischen Tiefbohrung die umliegende Natur
geschützt?
Bei einer Tiefbohrung, sei es bei einer Bohrung nach Öl, Gas oder auch nach
geothermischen Energiequellen, werden von den zuständigen bayerischen
Bergbaubehörden äußerst strenge Sicherheits-und Umweltauflagen eingefordert und auch
kontrolliert. Über ein Betriebsplanverfahren werden alle erforderlichen
sicherheitstechnischen, naturschutzfachlichen und wasserwirtschaftlichen Fragestellungen
geprüft. Zuständige Stelle hierfür ist die Regierung von Oberbayern, Bergamt Südbayern, in
München. So muss eine Bohrstelle (ähnlich wie eine Tankstelle) durch bauliche Maßnahmen
so abgesichert werden, dass weder Wasser, Öl, noch andere Stoffe in das Grundwasser
oder in die Umgebung gelangen. Dazu wird für den Bohrplatz meist ein komplettes
Ablaufsystem mit Auffangbecken und Abscheidern installiert. Entstehende Abwässer und
Bohrklein werden regelmäßig auf die Zusammensetzung geprüft und über
Entsorgungsunternehmen den Umweltauflagen entsprechend entsorgt.
Können bei den Bohrungen Erdbeben entstehen?
Das in Bernried eingesetzte Verfahren nutzt die Wärme aus Thermalwasser, welches über
Tiefbohrungen gefördert wird. In Bayern sind schon über 350 solcher Bohrungen, die
meisten zwischen 2.000m und 4.000m tief, vor allem bei der Suche nach Erdöl und Erdgas,
abgeteuft worden. Zu Erdbeben ist es dabei nicht gekommen. Grundsätzlich ist der
Münchner Raum tektonisch stabil, es gibt nur wenige Spannungen in der Erdkruste, deshalb
so gut wie keine Erdbeben. Lediglich mit sehr feinen Messgeräten können geringste
Erdbewegungen im Untergrund nachgewiesen werden. Die Erdbeben in Basel im Dezember
2006 entstanden vermutlich durch das sogenannte FRACCING, das Einpressen von Wasser
in tief liegende, sehr heiße Granitschichten mit extrem hohen Drücken von bis zu 1.000 bar.
Das FRACCING soll diese Granitschichten aufbrechen, die bestehenden Risse erweitern
und besser wasserdurchlässig machen, um eingeführtes Wasser im Granit erhitzen zu
können (HOT DRY ROCK - Verfahren, HDR). Zudem liegt Basel in einem bekannt
Erdbeben-gefährdetem Gebiet. Es liegen dort erhebliche tektonische Spannungen im
Erdkörper vor. Das Große Basler Erdbeben bezeichnet eine Serie von gewaltigen
Erdstößen, die Basel ab dem Nachmittag des Lukastages (18. Oktober) des Jahres 1356 in
Trümmer legten. Das FRACCING kommt in Bernried nicht zum Einsatz – unsere Bohrungen
sind wie sehr tiefe Brunnen zu sehen. Außerdem ist Südbayern tektonisch stabil.
Können bei der Tiefenwasser–Entnahme Hohlräume entstehen? Sind dadurch
Erdbeben und Einbrüche möglich?
Das erhoffte Thermalwasser befindet sich in einer Kalkstein-Schicht (Malm) in etwa 4,5 km
Tiefe. Diese Schicht darf man sich nicht als großes Loch vorstellen, es ist eher so, dass die
aus Jurakalken bestehende Schicht eine sehr feste und harte Gesteinsschicht ist, welche mit
Fragen und Antworten Bernried Erdwärme - 2.9.2009 Seite 5 von 9Klüften, Poren und Rissen durchzogen ist. Darin zirkuliert das Wasser ganz langsam,
wenige Millimeter in der Woche. Das Tiefen-Grundwasser stammt übrigens aus dem
südlichen Bereich der schwäbischen Alb und benötigt sehr lange für den Weg nach
Bernried. Entnommenes Wasser, z.B. wie bei einer Thermalbadnutzung in Bad Wörishofen,
wird durch nachfließendes Wassers aus diesen Gebieten ersetzt. In unserem Fall wird das
entnommene Wasser über die Reinjektionsbohrungen wieder in den
Tiefengrundwasserleiter verbracht. Übrigens: nur 2%-3% des Gesteines besteht aus diesen
mit Wasser gefüllten Rissen; das Gestein sorgt trotz dieser Poren und Risse seit
140 Millionen Jahren für ausreichend Stabilität.
Sind Hebungen durch Anhydritvorkommen möglich, wie in der Gemeinde
Staufen im Breisgau?
In Staufen im Breisgau (Baden-Württemberg, nähe Basel) wurde durch eine flache
Geothermiebohrung mit etwa 100m Bohrungstiefe Wasser in eine Anhydrit- (Kalziumsulfat-)
Schicht eingebracht. In Verbindung mit Wasser entsteht Gips, wobei sich das Volumen um
etwa 50% vergrößert. Dadurch kam es in der Altstadt von Staufen zu Hebungen von bis zu
20cm. Diese Anhydrit-Vorkommen befinden sich in der Nähe von Salzlagerstätten, die in
Bernried mit Sicherheit auszuschließen sind. Sehr viele Bohrungen sind in der weiteren und
näheren Umgebung abgeteuft worden, so dass die Gesteinsabfolge im Raum
Weilheim/Bernried sehr gut bekannt ist.
Wie erfolgt das Versickern des Thermalwassers in den Malm-
Grundwasserleiter?
Das abgekühlte Thermalwasser wird über Rückführungsbohrungen wieder in den tief
liegenden Malm-Grundwasserleiter gebracht. Dabei sind die Bohrungen mit einzementierten
Stahlrohren ausgekleidet, nur im Zielhorizont haben diese Stahlrohre Löcher. Das Wasser
kann also nur in den vorgesehenen Zielhorizont in etwa 4,5 km Tiefe versickern. Sollte das
Wasser nicht von alleine versickern, kann mit einer Pumpe der Druck leicht erhöht werden.
Welche Erfahrungen hat man mit Geothermieanlagen, die bereits in Betrieb
sind?
In Südbayern sind bisher sieben Geothermieanlagen ohne irgendwelche Beeinträchtigungen
der Umwelt in Betrieb. Die Anlagen in Erding, Simbach, Unterschleißheim, Pullach,
München-Riem und Straubing sind Anlagen zur geothermischen Wärmeversorgung; die
Anlage der Gemeinde Unterhaching ist die bisher größte Anlage in Bayern und nutzt die
Erdwärme nicht nur zur Wärmeversorgung sondern auch zur Stromerzeugung. Die
Wärmeversorgung wird seit dem Winter 2007/2008 genutzt. Die Stromerzeugung erfolgt
mittels eines Kraftwerks nach der Kalina-Technologie, das im Juni 2009 von Bundesminister
Sigmar Gabriel eingeweiht wurde. Die Bohrungen in Garching, Aschheim, Unterföhring,
Poing, Sauerlach und Dürrnhaar sind fertiggestellt: auch hier wird in den nächsten Monaten
der Bau der Strom- und Fernwärmeerzeugungsanlagen beginnen. Ein weiteres Geothermie-
Kraftwerk ist in Oberhaching, im Ortsteil Laufzorn, geplant. Hier sind die Bohrungen schon
voll im Gange. Gleiches gilt für die Gemeinde Kirchstockach, wo die erste Bohrung bereits
erfolgreich abgeteuft wurde und die zweite Bohrung kurz vor dem Start ist.
Fragen und Antworten Bernried Erdwärme - 2.9.2009 Seite 6 von 9Wie wird das Kraftwerk an das Netz angeschlossen? Muss der Strom lange
Wege zurücklegen?
Das Geothermie-Kraftwerk wird mit einer im Erdreich vergrabenen 20kV Stromleitung an das
öffentliche Netz angeschlossen; die Anbindungslänge von etwa 3 km ist für den
Stromtransport unbedeutend. Der Geothermiestrom ist grundlastfähig, d.h. der Strom steht
24h am Tag zur Verfügung.
Was ist die Zusammensetzung des Thermalwassers? Könnte es die Umwelt
gefährden?
Das Thermalwasser wird aller Voraussicht nach gelöste Mineralien (vor allem Salz und Kalk)
und gelöste Gase (vor allem CO2) enthalten. Es können auch giftige Stoffe in geringen
Mengen vorhanden sein. (Das in Erding gefundene Thermalwasser hat im Gegenzug
Trinkwasserqualität und wird nach einer Aufbereitung u.a. als Trinkwasser benutzt.) Da das
Thermalwasser in einem geschlossenen Kreislauf fließt, können diese Stoffe nicht
entweichen. Sie werden wieder in den Untergrund verbracht und, da die Bohrung komplett
mit Stahlrohren ausgekleidet ist, wird das oberflächennahe Grundwasser nicht berührt.
Wie ist das Projekt versichert?
Die BE Geothermal GmbH hat einen vollständigen Versicherungsschutz, der unter anderem
auch Bergschäden abdeckt.
Wie sind die Pläne für die Fernwärmeerzeugung?
Nach erfolgreichem Abteufen der Bohrungen wird die Gemeinde Bernried eine Gesellschaft
für den Bau des Fernwärmenetzes und für die Vermarktung der Fernwärme gründen. Der
größte Wärmekunde wird die Klinik Höhenried werden. Hier soll auch das
Wärmeverteilzentrum eingerichtet werden.
Wer ist für die Bohrungen und Stromerzeugung zuständig?
Die ausführende Projektgesellschaft ist die BE Geothermal GmbH, Leopoldstraße 244,
80807 München. www.begeothermal.com
Fragen und Antworten Bernried Erdwärme - 2.9.2009 Seite 7 von 9Skizzen und Bilder:
Lageplan vorläufige Planung: Roter Standort Produktionsbohrungen und Kraftwerk, Blauer
Standort Reinjektionsbohrungen. Vergrabene Thermalwasserpipeline grün. Blaue Leitung
Fernwärmeableitung nach Klinik Höhenried. Die Standorte können nur nach der Auswertung
der seismischen Messung festgelegt werden. Deutliche Verschiebungen sind noch möglich.
Fragen und Antworten Bernried Erdwärme - 2.9.2009 Seite 8 von 9Ansicht Bohrlochverschlüsse von 2 Bohrungen nach Abschluss der Bohrarbeiten (München-
Riem). So könnte der Standort in Haunshofen nach Fertigstellung aussehen.
Skizze Kraftwerk
Fragen und Antworten Bernried Erdwärme - 2.9.2009 Seite 9 von 9Sie können auch lesen