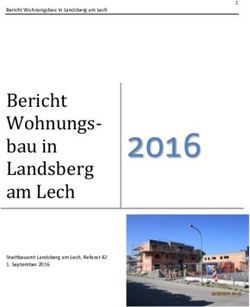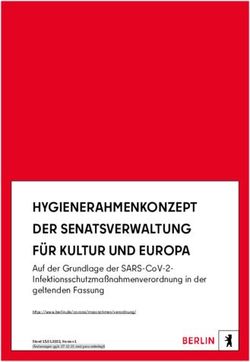Kritik - Repräsentation - Schuld. Anmerkungen zu einer moralisierenden Figur der Diskriminierungskritik
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Alfred Schäfer
Kritik – Repräsentation – Schuld. Anmerkungen zu einer
moralisierenden Figur der Diskriminierungskritik
Zusammenfassung: Aktuelle Diskriminierungsdiskurse benennen (generali-
sierte) Probleme und kritisieren die mit ihnen verbundenen Ausgrenzungs- und
Unterdrückungspraktiken im Namen der Betroffenen. Damit ist ein doppeltes
Repräsentationsproblem verbunden. Dieses besteht zum einen in der Bestimmt-
heit, mit der die Analyse entsprechender Phänomene vorgenommen und verall-
gemeinert wird. Im Namen dieser Bestimmtheit müssen andere Perspektiven
abgelehnt und vielleicht als Ausdruck der kritisierten Herrschaft adressiert werden.
Zum zweiten wird der Anspruch erhoben, im Namen der repräsentierten Gruppe
zu sprechen: In einer dekonstruktiven oder auch radikaldemokratischen Lesart
bedeutet dies, dass die Legitimität der eigenen Position durch die Repräsentation
einer Gruppe hervorgebracht wird, deren einheitliche Gestalt das Ergebnis der
Repräsentation selbst ist. In beiden Fällen (dem generalisierten Geltungsanspruch
der eigenen Kritik und der Stellvertretung) zeigt sich eine konstitutive Lücke
zwischen der Repräsentation und dem von ihr Repräsentierten. Der Beitrag unter-
sucht, wie diese (wohl für jede politische Repräsentation konstitutive) Lücke in
einer bestimmten Figur aktueller Diskriminierungsdiskurse mit Strategien der
Moralisierung bearbeitet wird. Diese Strategien verknüpfen die Sozialkritik mit
einem Schulddiskurs, von dem her sich die Thematisierung der unauflösbaren
Repräsentationsproblematik verbieten soll.
Abstract: Current discourses on discrimination present (generalised) issues and
condemn practices of exclusion and suppression in the name of those affected. In
relation to representation this approach is problematic in two ways. On the one
hand, analyses of such phenomena tend towards generalisation and their results are
often communicated in absolute terms. To enforce this certainty, these discourses
tend to negate alternative perspectives and denounce them, for example, as an ex-
pression of unjust supremacy. On the other hand, these positions claim to represent
the views of those affected. Employing a deconstructive as well as radically demo-
cratic point of view they base the legitimacy of their claim on representing a group,
whose allegedly homogenous nature itself only results from said representation.
Both cases (the generalised claim to validity of the critique as well as validity of
representation) point to an essential gap between what is represented and the way
in which it is represented. The article outlines how moralising strategies (which
69constitute an integral part of any form of political representation) are employed to
address this gap within some current discourses on discrimination. These strate-
gies combine elements of social criticism with a discourse on guilt in an attempt
to prohibit any debate on these (unsolvable) representational questions.
Keywords: Kritik, Repräsentation, Schuld
Die Kritik an gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten im Namen der Gleichheit, wie
sie für die Moderne typisch ist, lebt von zwei Elementen: vom Anspruch auf die
Wahrheit oder Richtigkeit der eigenen Analyse und von der Zielstellung, dadurch
einen verändernden Protest auszulösen. Allerdings ist das Verhältnis beider Ele-
mente zueinander eher kontingent. Wenn man nicht von der naiven Vorstellung
ausgeht, dass richtige Einsichten auch richtiges Handeln bewirken, wenn die Ana-
lyse vielleicht nicht die einzig richtige Perspektive darstellt und wenn die soziale
Empörung sich vielleicht eher nur pauschalisierend auf das bezieht, was für ihre
Zwecke aus der Komplexität der Sozialanalyse fruchtbar erscheint, dann bildet
das Verhältnis von Analyse und Empörung selbst einen sinnvollen Gegenstand
der Betrachtung. Wieviel Analyse braucht die Empörung, um sich als Empörung
zu stabilisieren? Wieviel Empörung braucht die kritische Analyse, um sich selbst
für praktisch oder politisch relevant zu halten? Vor dem Hintergrund solcher
Fragestellungen versuchen die folgenden Überlegungen, sich der Funktionslo-
gik einer bestimmten Figur der Diskriminierungskritik zu nähern, die auf eine
moralische Empörung setzt. Für diese scheinen analytisch die Herrschafts- und
Unterdrückungsverhältnisse generell soweit geklärt zu sein, dass Täter- und Op-
ferrollen gleichsam a priori zugerechnet werden können.
Es mag nicht zuletzt auch der Logik medialer Inszenierungen geschuldet sein,
wenn das Phänomen der (sexistischen, rassistischen, kolonialistischen) Diskri-
minierung im Gewand einer dramatisierenden Rhetorik auftritt. In einer solchen
Dramatisierung können Unterschiede verloren gehen, erscheinen Einschätzungen
und Be- bzw. Verurteilungen eindeutig verortbar zu sein. Solche Vereindeutigun-
gen gestatten dann, soziale Kategorien in der Logik von Unterdrückenden und
Unterdrückten anzuordnen und entsprechende Schuldzuweisungen vorzunehmen.
Dabei scheinen (mindestens) zwei Aspekte bedeutsam zu sein. Der erste besteht
in einer theoretischen Operation der Systematisierung: Es geht um systematische
Herrschaftsverhältnisse insofern, als sie immer und überall anzutreffen sind.
Noch auf der Mikroebene der Interaktion der beteiligten sozialen Kategorien wird
man sie finden. Der zweite Aspekt besteht darin, dass eine solche theoretisch-
systematische Perspektive mit einem moralischen Anspruch der Kritik gekoppelt
wird. Die Kritik erfolgt vom Standpunkt der Diskriminierten, der systematisch
70Benachteiligten aus und sie lässt – aufgrund der universalisierten Diskriminierung
– keine andere Position gelten bzw. sie stellt kritische Rückfragen an die Kritik
selbst unter den Verdacht, die Diskriminierung zu legitimieren oder zu ver-
harmlosen. Dies gilt auch und vor allem dann, wenn jemand aus der Gruppe der
systematischen Diskriminierer (Männer, Weiße, Vertreter des Westens) versucht,
andere Perspektiven stark zu machen.
Es ist nun diese Verbindung von systematisch ansetzender Sozialkritik und de-
ren moralischer Befestigung, die nicht nur als raffinierte Strategie der moralischen
Abwertung jeder Gegenposition interessant ist – als moralische Besetzung und
Neutralisierung eines politischen Terrains. Sie wirft gerade vor dem Hintergrund
einer Moralisierung des Politischen auch die Frage auf, wer in diesem Rahmen
legitim das Wort ergreifen darf. Und diese Frage selbst wiederum ist – mit Blick auf
das systematisch vermessene Terrain – immer auch eine danach, wer mit welchem
Recht für die Diskriminierten sprechen darf. Dass es illegitim oder beschämend
ist, für die Position der Diskriminierer zu sprechen, ist dabei schon vorausgesetzt.
Wenn man aber die Frage aufwirft, wer mit welchem Recht für die Diskriminierten
sprechen darf, entstehen daraus spezifische Probleme der Repräsentation. Selbst
jene, die die eigene Diskriminierungserfahrung artikulieren, betten diese immer
schon in den allgemeinen Diskriminierungsdiskurs ein und konfigurieren sich da-
mit als Repräsentanten eines allgemeinen Unrechts. Es erscheint daher naheliegend,
sich zunächst mit dem Problem der (politischen) Repräsentation zu beschäftigen.
Der Rückgriff auf die nichtauflösbaren Probleme der Repräsentation, die jede
politische Artikulation heimsuchen, dient dabei nicht zuletzt dazu, eine analytische
Distanz zu gewinnen. Aus dieser sollen die Probleme der angedeuteten Morali-
sierungsstrategie der Diskriminierung und des (hegemonialen) Schulddiskurses
deutlich werden. Zugleich soll diese analytische Distanz zumindest andeuten, dass
diese Figur der Diskriminierungskritik nur eine unter anderen Möglichkeiten ist, in
denen sich eine solche Kritik artikulieren kann. Andere – eher politisch ansetzende
und notwendige – Kritiken an der (geschlechtlichen, rassistischen) Diskriminierung
werden vielleicht die Probleme der politischen Artikulation nicht dadurch weg-
definieren, dass sie die mit der Repräsentationsproblematik verbundenen Fragen
einfach durch eine mit einem moralischen Schuldkonzept verbundene Aufteilung
der Welt zu neutralisieren versuchen.
Probleme der Repräsentation
Folgt man der Repräsentationsdebatte, die vor allem in der Ethnologie ihren
Ausgangspunkt hatte (vgl. Berg/Fuchs 1993), dann ist es sinnvoll, zwei Ebenen
des Repräsentationsproblems zu unterscheiden. Da ist zum einen die sprach- und
71zeichentheoretische Frage, inwiefern es überhaupt möglich ist, mittels sprachli-
cher Formen dem, was mit ihnen bezeichnet werden soll, gerecht zu werden. Und
da ist zum Zweiten die Frage, inwiefern jemand (als Ethnologe von außen oder
als Informant von innen) überhaupt beanspruchen kann, für eine soziale Gruppe
zu sprechen. In der Repräsentation kommen auf diese Weise mit dem Bestim-
mungs- bzw. Identifizierungsaspekt und mit dem Autorisierungsanspruch zwei
Dimensionen zusammen, die beide auf einen ihnen inhärenten Machtanspruch
verweisen. Beide Dimensionen sollen hier zunächst betrachtet werden, bevor
dann in einem nächsten Schritt gefragt werden soll, wie jemand, der als Kritiker
oder Kritikerin der Diskriminierung spricht, genau diese Machtimplikationen der
eigenen Repräsentationsfunktion ignorieren kann.
Die Kritik an den Herrschaftsaspekten des identifizierenden Denkens, wie sie
Adorno und Horkheimer in der ‚Dialektik der Aufklärung’ (1947) entwickeln,
richtet sich primär auf die behauptete Wirklichkeitsreferenz der Begriffe. Diese
beanspruchen eine eindeutige Bestimmung der von ihnen signifizierten Wirklich-
keit – und genau damit auch das Versprechen einer Verfügung über diese. Doch
schon Adornos Konzept des konstellativen Denkens (vgl. Adorno 1966) verwies
nicht nur auf die Grenzen der Übereinstimmung der begrifflichen Identifikation
mit der Wirklichkeit, sondern zugleich darauf, dass begriffliche Repräsentationen
ihre eigenen Wirklichkeiten erzeugen. Es ist dann die Re-Lektüre Saussures, wie
sie vor allem Derrida unternommen hat (vgl. Derrida 1974), die darüber hinaus
deutlich macht, dass das Verhältnis von begrifflicher/sprachlicher Repräsentation
und hervorgebrachter Wirklichkeit nicht stabil ist. Nicht nur wird die signifizierte
Wirklichkeit (mit Saussure) zu einem innersprachlichen Problem differenzieller
Unterscheidungen; zugleich zeigen sich (gegen Saussure) diese Verbindungen
sprachlicher Zeichen als instabil. Deren Bedeutung verschiebt sich in den sprach-
lichen Artikulationen; sie erscheint kontextabhängig und damit nicht fixierbar.
Den sprachlichen Signifizierungspraxen entspricht keine stabile Bedeutung, kein
eindeutiges Signifikat. Jeweilige Bedeutungen sprachlicher Zeichen werden in
bestimmten Kontexten hervorgebracht, die selbst zwischen den Akteuren nicht
eindeutig bestimmbar sind; zugleich verschieben sie sich mit der Transformation
der Kontexte. Als Fazit dieser Diskussion kann hier festgehalten werden, dass ein
identifizierendes Denken nicht nur nicht beanspruchen kann, mit dem angespro-
chenen Gegenstand übereinzustimmen, sondern auch nicht, dass die artikulierten
Worte immer die gleiche Bedeutung haben. Auf diese Weise wird der Macht- und
Verfügungsanspruch, der mit einem identifizierenden Denken verbunden ist, deut-
lich: Dieser hängt an der behaupteten und für verbindlich erklärten Referenz und
Eindeutigkeit von Bedeutungszuschreibungen. Am Herrschaftsgestus dieser dop-
pelten Eindeutigkeit wird sich eine Kritik der Repräsentation abarbeiten müssen.
72Die zweite Dimension des mit dem Konzept der Repräsentation verbundenen
Machtanspruchs kommt in den Blick, wenn man sich fragt, wer mit welchem
Recht eben jene Bedeutungen fixiert, wer sagen kann, um was es sich handelt
und wie dies im Zusammenhang mit anderen Sachverhalten zu verstehen ist.
Diese Frage bezeichnet nicht nur ein Problem wissenschaftlicher Autorisierung,
sondern immer auch ein politisches Problem: Repräsentanten gewinnen ihre
Legitimation und Autorität nicht aus sich heraus, sondern indem sie für etwas
stehen – für etwas, das nicht mit ihnen identisch ist. Demokratietheoretisch
– und diese Ebene soll hier im Vordergrund stehen – spricht man davon, dass
die Repräsentanten durch das Volk als Souverän legitimiert sind. Diese Vor-
stellung birgt nun ihrerseits Probleme. So konstituiert sich ‚das’ Volk als ein-
heitlicher Souverän erst durch die Wahl von Repräsentanten, die als solche dann
nachträglich aus einer amorphen und heterogenen Masse ‚ein Volk’ machen.
Die Repräsentanten stehen damit für etwas, das sie selbst nicht sind und das es
doch ohne sie nicht gäbe. Dadurch wird zugleich die Repräsentation zu jenem
souveränen Ort, der auf einer anderen Souveränität basiert, der allerdings die
Repräsentanten wiederum erst ihre Form geben (vgl. Lefort 1990). Sie können
dies, indem sie sich auf die Repräsentation des Allgemeinen beziehen, die mit
Blick auf konkrete Entscheidungen (und die verfassungsmäßig verbürgten
Rechte der Einzelnen) immer in Frage gestellt werden kann. Daher – um das
politische Spannungsverhältnis von Souverän und Repräsentation, von All-
gemeinwohldefinitionen und konkreten Entscheidungen zu überbrücken – be-
darf es immer auch eines politischen ‚mise en scène’ (vgl. Lefort 1999, S. 39).
Politische Entscheidungen bedürfen der Inszenierung, um die Abgründe und
Paradoxien der Repräsentation zu verdecken. Sie müssen den Souverän (etwa
mit Hilfe dramatischer Inszenierungen oder leerer Signifikanten – vgl. Laclau
2002) anrufen, um ihm (nun dadurch selbst autorisiert) souverän eine Form zu
geben, ihn zu regieren. Es kann hier nur darauf hingewiesen werden, dass –
unter demokratischen Bedingungen – das Spannungsfeld von Souveränität und
Repräsentation nicht aufgelöst werden kann.
In diesem Spannungsfeld können Repräsentanten (auf allen Ebenen der poli-
tischen Repräsentation) in Frage gestellt werden; diejenigen, die nicht repräsen-
tiert werden, können ihre Stimme erheben (vgl. Rancière 2002); man kann – seit
Rousseau (1962) – die Repräsentation im Namen einer direkten Selbstregierung
in Frage stellen; man kann umgekehrt auf die Notwendigkeit der Repräsentation
verweisen, weil ohne sie ein Ort der Souveränität in komplexen Gesellschaften
kaum anzugeben ist; man kann sagen, dass die Unmöglichkeit einer gelingenden
Repräsentation das Politische als Streit um die Souveränität eröffnet; man kann für
sie plädieren, weil sie es zugleich erlaubt, heterogenen gesellschaftlichen Gruppen
eine Plattform im Rahmen gesellschaftlicher Konflikte zu geben. Im Folgenden
73möchte ich nun zeigen, dass sich auch herrschafts- und diskriminierungskritische
Positionen im Spannungsfeld von Souveränität und Repräsentation bewegen.
Das Politische und die Repräsentation
Die Probleme der Repräsentation resultieren daraus, dass ein Gemeinsames
zwischen Repräsentierten und Repräsentanten nur eine problematische und
umstrittene Unterstellung bildet. Immer können Repräsentanten – auch jene, die
im politischen Raum die eigenen Interessen zu vertreten beanspruchen – kritisiert
werden. Das Problem der Repräsentation scheint sogar schon zu entstehen, wenn
überhaupt der Anspruch erhoben wird, etwas Gemeinsames zu artikulieren. Wenn
man also etwa versucht, die Problematik der Repräsentation dadurch zu vermei-
den, indem man beispielsweise für eine bestimmte Protestbewegung annimmt,
dass alle Teilnehmenden auf ihre je eigene Weise das Anliegen der Bewegung
vertreten werden, dann ist die legitimierte Differenz der Positionen doch letztlich
darauf zurückzuführen, dass sie ein (zumindest umgrenztes) Gemeinsames auf
je spezifische Weise repräsentieren. Und man muss dann wohl eine Harmonie
unterstellen, die keine – das Gemeinsame sprengenden – Auseinandersetzungen
zulässt. Dann aber wäre man bei aller Betonung der Singularität verschiedener
Artikulationen doch wieder in der Nähe einer Disziplinierung der Differenzen –
es sei denn, man schließt sie von vorne herein (etwa durch die Unterstellung ge-
meinsamer Interessen oder Betroffenheiten) aus.
Sobald man sich von einer – wie immer postulierten, vorausgesetzten und
begründeten – Gemeinsamkeit verabschiedet und auch noch für solche Protestbe-
wegungen die Frage zulässt, wer denn nun das Gemeinsame am ehesten trifft, wird
das Problem der Repräsentation unabweisbar. Dann stellt sich die Frage, wer mit
welchem Recht im Namen aller (des Souveräns) sprechen kann, wer die kritisierten
Probleme aus der Sicht der Gruppe adäquat zu fassen vermag und wer von daher
geeignet erscheint, das Gemeinsame (nach innen und außen) zu vertreten. Spätestens
hier tritt dann die Frage nach dem Verhältnis von Souveränität und Repräsentation
auf: einem Souverän, dessen legitimierende Vorgängigkeit nachträglich geschaffen
wird und einer Repräsentation, die sich nur inszenierend und rhetorisch auf das
von ihr Repräsentierte beziehen kann, ohne dies zweifelsfrei einlösen zu können.
Wer eine kritische Position gegenüber dem politischen System im Namen
der konstituierenden Macht einer ungerecht behandelten oder diskriminierten
Gruppe einnimmt, muss – wenn nicht einfach die Identität seiner Position mit der
betroffenen Gruppe unterstellt werden soll – die Lücke schließen, die in seiner
Artikulation zwischen Souveränität und Repräsentation klafft. Er muss den mit
seiner Artikulation verbundenen doppelten Machtanspruch bearbeiten: jenen,
74das Problem so auf den Begriff zu bringen, dass es repräsentativ für die seine
Position autorisierende Gruppe ist. Zu bestimmen ist die Ungerechtigkeit, die
einen selbst als Mitglied einer bestimmten Gruppierung trifft: In diesem Fall muss
die Authentizität der eigenen Bekundung als Repräsentation der benachteiligten
Gruppierung ausgewiesen werden. Man kann aber auch die Ungerechtigkeit und
Diskriminierung anprangern, die andere betrifft. In diesem Fall wird das in der
ersten Version noch kaschierte Problem des Paternalismus offenkundig. Zugleich
muss man in beiden Fällen darauf insistieren, die adäquate Problembestimmung
und Kritik formuliert zu haben. Das ist keine einfache Konstellation, weil sie auf
zwei Probleme mit zwei unterschiedlichen und gegenläufigen Strategien reagieren
muss. Das erste Problem: Man muss die falsche Sichtweise der Herrschenden, des
Systems der Politik und den daraus resultierenden Entscheidungen zurückweisen.
Man muss sie – anders formuliert – als Signifizierungen dekonstruieren, die den
falschen Anspruch erheben, ein ‚alternativloses’ Signifikat zu liefern. Mag dieses
Problem noch relativ leicht zu lösen sein, so handelt man sich für die eigene Posi-
tionierung allerdings das zweite Problem ein: Man muss für diese einen Anspruch
erheben, der von der Gegenseite nicht wiederum selbst zu dekonstruieren ist. Es
geht um die Bestimmtheit, mit der der Geltungs- und Verbindlichkeitsanspruch
der eigenen Position behauptet werden kann, wenn man in der Kritik zugleich die
Performativität der kritisierten Position in den Vordergrund gerückt hat.
Die These, die im Folgenden vertreten werden soll, geht der Vermutung
nach, dass sich zumindest Teile des prominenten Diskriminierungsdiskurses als
Bearbeitungsformen dieses doppelten Repräsentationsproblems verstehen lassen.
Diskriminierungsdiskurse selbst lassen sich dabei (in der Folge der antiautoritären
und antikapitalistischen Proteste der 1960er und 1970er Jahre und im Kontext der
sich daraus entwickelnden sozialen Bewegungen) als eine Form der Kritik begreifen,
in der sich identitätspolitische Einsätze und postmaterialistische Gerechtigkeits-
ansprüche verzahnen. Dabei versuche ich anzudeuten, wie sich in diesem Rahmen
eine Diskursstrategie einsehen lässt, die sich dadurch eine Bestimmtheit und eine
autorisierte Vertretungsposition zu sichern versucht, dass sie den politischen Diskurs
im Spannungsfeld von Souveränität und Repräsentation moralisch rekodiert. Und dies
geschieht nicht zuletzt über eine Befestigung von Täter- und Opferfraktionen, die sich
gegen (dekonstruierende) Rückfragen immunisiert. Zugleich wirft die auf diese Weise
beanspruchte Rede von einer identifizierbaren ‚Schuld‘ die Frage von Alternativen auf,
in denen politische Regelungen und die pädagogische Bearbeitung (rechtlich nicht zu
disziplinierender) moralischer Überzeugungen kaum zu trennen sind.
75Schuld: Die moralische Immunisierung der politischen Kritik
Man kann den politisch-demokratischen Raum als einen verstehen, in dem
niemand über eine definitive Wahrheit verfügt. In diesem Fall ist die Durchsetzung
von Positionen eine Machtfrage, die sich argumentativer Einsätze, rhetorischer
Kniffe, dramatischer Inszenierungen oder auch des Rückgriffs auf moralische
Überzeugungen bedient. Moral wird man (seit Machiavelli) als strategischen Ein-
satz und nicht als unbezweifelbares normatives Fundament jeder Politik begreifen
müssen. Und man wird auch davon ausgehen müssen, dass moralische Einsätze,
das Bekunden bestimmter normativer Überzeugungen oder gar die Berufung auf
Werte, auch dann, wenn sie als Kritik an der wahrgenommenen Politik formuliert
werden, nicht von einer übergeordneten Wahrheitsposition aus formuliert sind.
Von hier aus betrachtet, müssten auch Diskriminierungsdiskurse, die etwa Se-
xismus oder Rassismus anprangern, als moralische Einsätze, d.h. als strategische
Artikulationen ohne einen dem politischen Streit vorausliegenden Wahrheits-
anspruch, verstanden werden. Und man wird an dieser Stelle festhalten müssen,
dass sich gerade die differenztheoretisch argumentierenden feministischen und
postkolonialistischen Diskurse sich den Problemen der politischen Artikulation,
d.h. auch: der doppelten Problematik der Repräsentation gestellt haben. Gerade
vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie die hier untersuchten moralischen
Interventionen, die die Problematik der politischen Artikulation – und damit die
Logik agonaler Auseinandersetzungen im politischen Raum und die Aporien der
politischen Artikulation – unterlaufen, eine politische Verbindlichkeit erhalten
können, die rechtliche Konsequenzen zeitigt und den öffentlichen Raum als Re-
gime des Sagbaren dominiert. Zur Beantwortung dieser (systematischen) Frage
ist es vielleicht hilfreich, sich eine Verbindungsebene von moralischen Statements
und politischer Begründung zu verdeutlichen: Beide zielen auf Generalisierung
und Universalisierung. Die (wie auch immer berechtigte) moralische Empörung
muss deutlich machen, dass es sich hier nicht um Sonderfälle oder Ausnahmen
handelt, sondern um ein allgemeines Problem. Die Universalisierung des Problems
bedeutet dann gleichzeitig die moralische Legitimation der Empörung im Einzel-
fall, da dieser ja nur ein (typisches) Beispiel für das ist, was moralisch abzulehnen,
aber überall zu finden ist. Genau diese Bestätigungsschleife fehlt der politischen
Generalisierung oder Universalisierung. Hier geht es vor dem Hintergrund des
Repräsentationsproblems darum, dass – folgt man Laclau und Mouffe (2000) – alle
Positionierungen partikular sind und die politische Inszenierung darauf zielt, sie
als allgemeine plausibel zu machen – was sie grundsätzlich nicht sein können. Eine
moralische Universalisierung, die von der Verteilung von Schuld und Unschuld
auf Trägergruppen ausgeht und die Partikularität situativer Kontexte von hier
her einordnet, wird hingegen genau diese unmögliche Universalität immer schon
76unterstellen und letztlich gegen jede Relativierung durch andere Sichtweisen, die
analytisch auf der Unterscheidung von allgemeiner Regel und Einzelfall insistieren,
behaupten müssen.
Untersucht man den politischen Einsatz moralischer Empörung unter diesen
Voraussetzungen, so kann man vielleicht zwei Schritte unterscheiden. Der erste
Schritt besteht in der Berufung auf die Gleichheit der Menschen, die Moral und
demokratischer Politik gemeinsam ist. Einen Unterschied kann man hier darin
sehen, dass das, was jeweils unter Gleichheit zu verstehen ist, im politischen Raum
umstritten ist und den Einsatz unterschiedlicher Positionierungen ausmacht (vgl.
Rancière 2002; Menke 2005). Politische Auseinandersetzungen tragen damit dem,
was man mit Wieland (1989) die Aporien der praktischen Vernunft nennen könnte,
Rechnung: der unüberbrückbaren Differenz zwischen Kriterien und Grundsätzen
auf der einen und der komplexen Wirklichkeit auf der anderen Seite. Eine morali-
sche Positionierung wird sich demgegenüber eher dadurch auszeichnen, dass sie
das Verhältnis von Prinzip und Wirklichkeit in seinem aporetischen Charakter in
Frage stellt. Eine Verbindung von Prinzip und Wirklichkeit muss als möglich unter-
stellt werden. Daraus folgt nun ein zweiter Schritt, der für politische Auseinander-
setzungen eher als strategischer Zug Sinn macht, der aber für eine Moralisierung
der Wirklichkeit entscheidend zu sein scheint. Dieser besteht in der Frage, was
denn nun die Wirklichkeit daran hindert, moralisch zu sein – was also der Reali-
sierung der Gleichheit entgegensteht. Diese Frage ist scheinbar empirisch, aber sie
wird von vorneherein moralisch konnotiert. Obwohl unter der Voraussetzung der
Gleichheit niemand ein moralisches Recht dazu hat, gibt es doch Gruppierungen,
die der Realisierung der Gleichheit entgegenstehen und die sich damit moralisch
ins Unrecht setzen. Diesen Gruppen kann man dann gleichzeitig ein (politisches)
Machtinteresse und ein moralisches Unrecht, eine Schuld zuschreiben.
Im Folgenden sollen nun die Implikationen einer solchen Herangehensweise
im Lichte des doppelten Repräsentationsproblems (Identifikation und Stellvertre-
tung) betrachtet werden. Was die Dimension der Identifikation der Ungleichheit
betrifft, so ist diese in der politischen Auseinandersetzung ein umkämpftes Terrain,
in dem Kritiker und Apologeten aufeinandertreffen und die unterschiedlichsten
Begründungs-, Rechtfertigungs- und Kontextualisierungsfiguren artikulieren.
Eine moralische Perspektive verlangt hier eine Vereindeutigung, die – folgt man
den obigen Überlegungen – gleichzeitig empirisch und moralisch wertend sowie
darüber hinaus auch noch mit einem (unter beiden Aspekten) generellen An-
spruch auftreten muss. Die Mächtigen und Herrschenden müssen identifiziert,
in ihrer Schuld als Gleiche unterdrückend angegeben werden und zwar so, dass
es sich hier nicht nur um eine individuelle Willkür oder eine persönliche Schuld,
sondern um ein allgemeines Problem handelt. Drei ineinandergreifende und auf-
einander verweisende Operationen scheinen demnach notwendig zu sein, um
77einen moralisierenden Repräsentationsanspruch zu vertreten. Auf einer ersten
(analytischen) Ebene ist die Kritik einer systematischen Herrschaft notwendig,
die die eine über die andere Gruppe (die Männer über die Frauen, die Weißen
über die Schwarzen) aufrechterhält und mittels der unterschiedlichsten Strategien
(Gewalt, Recht, Ausschließungen usw.) zu stabilisieren versucht. Auf einer zweiten
(moralischen) Ebene wird dies mit Bezug auf das Gleichheitsprinzip mit einer
moralischen Schuld in Verbindung gebracht: Die analysierte Unterdrückung und
Benachteiligung ist nicht nur eine zu kritisierende Herrschaft, sondern moralisch zu
verurteilen. Die Verschiebung der politischen Herrschaft auf die moralische Schuld
hat eine (mindestens) doppelte Implikation. Zunächst bedeutet sie eine Dramatisie-
rung insofern, als die herrschenden Gruppen nicht nur an den Unterworfenen und
Unterdrückten etwa aus zumindest rationalisierbaren Interessen ein Unrecht be-
gehen, sondern dabei zugleich ein universales Recht verletzen und daher moralisch
zu verurteilen sind. Dann aber stellt sich (als zweite Implikation) die Frage, ob die
Verbindung von politischer Herrschaft mit moralischer Schuld nicht dazu führt,
dass solche Vergehen nur individuell zuzurechnen sind. Während man politische
Unterdrückungsverhältnisse eher sozialen Kategorien zurechnen kann, scheinen
moralische Schuldzuweisungen vor allem auf individuelle Übertretungen zu
verweisen. In anderen Worten: Es drohen die Aporien der praktischen Vernunft, die
eine direkte Verbindung von konkretem Fall und allgemeinem Prinzip fragwürdig
erscheinen lassen. Und hier lässt sich eine dritte operative Ebene ausmachen: Bei
ihr geht es um die Generalisierung der individuell zurechenbaren Schuld zu einer
allgemeinen Schuld, die als solche einer sozialen Kategorie zugeordnet werden
kann. Die moralische Schuld der einen Kategorie (Männer, Weiße usw.) gegenüber
der anderen (Frauen, Schwarze usw.) ist als solche dann nicht nur die konkreter
politischer Akte, sondern eine moralische Schuld, die diese Kategorie als solche
betrifft (die Männer sind als Männer gegenüber den Frauen schuldig usw.).
Aus dieser vereindeutigenden und generalisierenden Identifikation folgt nun
potentiell eine eigentümliche Konstellation, die mit dem empirisch-moralischen
Doppelcharakter zu tun hat. Auf der einen Seite kann auf diese Weise eine ge-
neralisierte Schuld zugewiesen werden, die mit der sozialen Kategorie und nicht
mit konkreten Einzelfällen zu tun hat. Die Beweislast, dass man (etwa als Mann
oder Weißer) nicht schuldig ist, verschiebt sich in einem solchen Fall auf den Ein-
zelnen. Er muss nachweisen, dass er nicht unter die allgemeine Kategorie fällt,
wogegen letztlich immer eingewendet werden kann, dass es sich entweder um eine
durchsichtige Rechtfertigung oder eine Ausnahme handele, die auch für ihn (als
Repräsentanten der Kategorie) allenfalls eine Ausnahme darstelle. Auf der anderen
Seite wird gerade von der Moralisierung und dem korrespondierenden Schuld-
vorwurf unterstellt, dass doch der Einzelne (als moralisch zurechnungsfähige
Subjektfigur) sich aus der Schuld befreien könne und dies auch müsse.
78Diese Figur einer gleichzeitigen Unmöglichkeit und postulierten Notwendig-
keit, sich von der Schuld zu befreien, spielt mit der Differenz von universeller
Schuld und individueller moralischer Ansprache, die den Schuldigen auffordert,
sich doch von seiner Schuld zu lösen. Die Konstellation erinnert an die auf Augus-
tinus zurückgehende Erbsündenlehre, von der zu befreien auch ein gottgefälliges
Leben niemals hinreichen konnte. Ihre Säkularisierung erfuhr diese Erbsünden-
lehre in der Kombination von gesellschaftlicher Vermittlung und Entfremdung
bei Rousseau (1981). Die Vergesellschaftung erklärte, warum der Mensch nicht
zu sich kommen kann: Sie geht davon aus, dass er es müsste, aber dass letztlich
jeder Versuch, sich unter gesellschaftlichen Bedingungen von deren Verformung
zu befreien, scheitern muss. In Anlehnung an Foucault könnte man sagen, dass die
Schuld dieses vergesellschafteten Menschen immer schon tiefer anzusiedeln ist als
jeder Versuch, sich von ihr zu befreien (vgl. Foucault 1977, S. 42). Die Schuld ist
dann eine, die auch vorhanden ist, wenn man sich ihrer nicht bewusst ist – und auch
dann, wenn man versucht, sie zu überwinden. Und auch pädagogische Maßnahmen
oder Exerzitien der Selbsterziehung helfen hier kaum weiter – zumindest schließen
sie nicht aus, dass von jenen, vor denen man sich schuldig macht, Zweifel (an der
Aufrichtigkeit, der Konsistenz und Verbindlichkeit usw.) geäußert werden können.
Damit rückt die zweite Dimension der Repräsentation in den Blick: die Fra-
ge, wer mit welchem Recht im Namen der Unterdrückten und Diskriminierten
sprechen darf. Wer repräsentiert die Unterdrückten und Ausgegrenzten und kann
in ihrem Namen und mit moralischem Recht Schuldaufteilungen vornehmen,
die ganze soziale Kategorien betreffen, deren Schuldvorwurf also die Trennung
von politischer, d.h. rechtlich zu verfolgender und moralischer Schuld aufhebt?
Es wurde schon deutlich, dass die Authentizität der Betroffenen hier nicht hin-
reicht: Sie könnten nur für sich selbst sprechen, aber könnten dann weder ihren
Fall als Ausdruck einer allgemeinen Diskriminierung ausweisen noch für andere
Betroffene sprechen. Sie könnten sich – anders gesagt – nur politisch (aber eben
nicht moralisch) artikulieren in dem Sinne, dass sie im umkämpften politischen
Feld versuchen würden, eine partikulare Erfahrung zu universalisieren. Aber das
würde schon heißen, einen repräsentativen Anspruch zu erheben. Als moralische
Artikulation, die sich immer schon auf Schuldverhältnisse bezieht, die empirisch
überall zwischen den betreffenden sozialen Kategorien anzutreffen sind, würde
sie nicht nur einen politischen Universalisierbarkeitsanspruch behaupten, sondern
zugleich ihren Repräsentationsanspruch an die Autorisierung durch die un-
terdrückte soziale Kategorie binden. Diese fungiert in der weiter oben skizzierten
Logik dann als Souverän, der in der Repräsentation durch autorisierte Sprecher
eine Gestalt annimmt – eine Gestalt als soziale Kategorie, die erst im Nachhin-
ein, also in der Repräsentation eine Form gewinnt. Damit stehen die moralischen
Repräsentanten vor einem Dilemma. Was in der politischen Logik funktioniert,
79weil das Verhältnis von Souverän und Repräsentanten, von konstituierender
und konstituierter Macht beweglich bleibt, ist hier gerade ausgeschlossen.
Beweglich bleibt dieses Verhältnis im politischen Bereich, weil es kritisch bleibt:
weil Repräsentanten wechseln können, weil die Repräsentanten zumindest auf
symbolischer Ebene unterschiedliche Fraktionen des Souveräns aufrufen können,
weil es politische Bewegungen gibt, die das politische System herausfordern usw.
Inwieweit solche Beweglichkeiten ausreichen, ob sie gesellschaftliche Gegensätze
eher verschleiern als wiedergeben, ob man in einen Zustand der Postdemokratie
eingetreten ist oder nicht – all dies sind Fragen, in denen sich das kritische und
umkämpfte Potential der politischen Repräsentationsproblematik andeutet.
Eine moralische (und gerade nicht mehr differenztheoretisch reflektierte)
Repräsentation scheint hingegen solange (relativ) unproblematisch zu funktionie-
ren, wie sie auf einer prinzipiellen Ebene (etwa der Gleichheits- oder Freiheitsfor-
derung) bleibt und nicht in ihrem Namen die (politische) Wirklichkeit zu sortieren
beansprucht. Wenn sie dies aber reklamiert, kommt es nicht nur darauf an, dass die
soziale Wirklichkeit (und damit die politischen Aufgabenbestimmungen) eindeutig
sind, sondern dass das Spannungsverhältnis von Souveränität und Repräsentation
geschlossen wird. Die Repräsentation darf also in einem doppelten Sinne kein
Problem mehr darstellen: Die Repräsentierenden müssen mit den Repräsentierten
identisch sein. Und die Repräsentierenden dürfen die Repräsentierten nicht erst
in der Repräsentation als Souverän hervorbringen, weil daraus all die politischen
Inszenierungs- und Legitimationsprobleme entstehen würden. In diesem Fall
müssten also die Kritikerinnen einer universalen sexuellen Diskriminierung mit
den Frauen, in deren Namen sie sprechen, identisch sein. (Auch weiße) Vertreter
und Vertreterinnen einer antirassistischen Diskriminierungskritik müssten – was
hier schon schwieriger ist – mit den moralischen Ansprüchen rassisch diskrimi-
nierter Menschen identisch sein. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass in
solchen Fällen die Repräsentierenden jene, in deren Namen sie mit moralischem
Anspruch zu sprechen beanspruchen, als (sie autorisierende) Gruppe erst durch ihr
Auftreten hervorbringen. Beide Probleme lassen sich also nicht politisch, sondern
nur moralisch bearbeiten. Mit Blick auf die Identitätsunterstellung von Souverän
und Repräsentation muss dann immer eine Gemeinsamkeit der Diskriminierungs-
erfahrungen und deren unhintergehbare Bedeutsamkeit nicht nur für individuelle,
sondern auch sozial-kategoriale Identitäten behauptet werden. Das ist ein gewagtes
Unternehmen, da hier prinzipiell bestimmte Täter- und Opferkategorien mit ent-
sprechenden Schuldvorwürfen als ubiquitäre Lebenserfahrung der Individuen im
Namen der entsprechenden sozialen Kategorien behauptet werden. An dieser Stelle
kann dann der Rückgriff auf die Logik der Erbsünde weiterhelfen. Auf der einen
Seite kann man dann die Urgeschichte einer unvordenklichen Schuld erzählen, die
auf der anderen Seite dazu führt, dass die wirklichen Opfer ihren eigenen Status
80nicht mehr erkennen und sich etwa für gleich und frei halten. Solche Geschichten
haben bei aller moralischen Kraft dennoch den Nachteil, dass sie die Repräsentie-
renden in eine gouvernementale Aufklärungsposition bringen – und damit erneut
Fragen einer adäquaten Repräsentation eines Souveräns heraufbeschwören, der
als Souverän weder rational noch aufgeklärt sein muss.
Das vorstehende Modell ging davon aus, dass die Repräsentierenden das
Repräsentationsproblem dadurch zu bearbeiten versuchen, dass sie eine Identität im
Rahmen der gleichen sozialen Kategorie unterstellen, an der die Diskriminierungs-
erfahrungen festgemacht werden. Noch schwieriger wird die Situation, wenn sich
Mitglieder der schuldbeladenen Kategorie als Repräsentanten der Bearbeitung der
eigenen Schuld und damit als Repräsentanten der Gleichheit gegenüber den von
ihrer sozialen Kategorie Diskriminierten artikulieren: wenn Männer beanspruchen,
für die zu sprechen, die sexuelle Diskriminierung ablehnen und die daher von den
diskriminierten Frauen entschuldet werden wollen; wenn Weiße sich zu Anwälten/
Akteuren eines Antirassismus machen, der den Rassismus etwa gegenüber
Schwarzen durch eine Kritik des Weiß-Seins zu überwinden versucht. Ein solcher
Repräsentationsanspruch ist nicht – wie im ersten Fall – deshalb problematisch,
weil er die Identität mit den Repräsentierten unterstellen muss, sondern weil er dies
gerade nicht kann. Die Anerkennung der eigenen Schuld und damit der moralisch zu
verurteilenden Gegenposition zu den Diskriminierten und Unterdrückten ist hier die
Grundlage eines Repräsentationsanspruchs. Dabei gilt zunächst die Anerkennung
der eigenen Schuld als eine moralische Operation mit politischem Anspruch. Auch
wenn man sich vielleicht individuell keiner rassistischen oder sexistischen Verfeh-
lung bewusst ist, so bleibt man als Vertreter einer Kategorie, die historisch an dieser
Stelle eine unvordenkliche Schuld auf sich geladen hat, immer schon schuldig. Die
Arbeit an der adäquaten Repräsentation gerät hier in eine tragische Situation. Sie
muss sich als Repräsentation einer Souveränität begreifen, die es auf der Grundlage
der eigenen moralischen Kritik gar nicht geben kann. Und gleichzeitig muss sie zum
Sprachrohr der Unterdrückten und Diskriminierten werden, was sie als Teil der
unterdrückenden Kategorie niemals sein kann. Man kann sich zwar fragen, ob mit
solchen tragischen Konstellationen nicht genau das fortgeschrieben wird, was man
gerade bekämpfen möchte: die moralische Aufteilung der Welt in Schuldige und
Opfer. Aber hier mag der Hinweis genügen, dass auch an dieser Stelle der Rückgriff
auf die analytische Kraft einer säkularisierten Erbsündenlehre nicht uninteressant
ist. Die gewissenhafte Arbeit an der eigenen Erbschuld verbindet sich dann nicht
zuletzt über die problematisch bleibende Repräsentation der (vielleicht immer noch
von einem selbst) Diskriminierten mit einem missionarisch-pädagogischen Pathos,
das weit über den Anspruch politischer Regelungen hinaus in die Korrektheit des
moralischen Selbstverständnisses seiner Adressaten einzugreifen beabsichtigt.
81Nachbemerkung Die vorstehenden Überlegungen und polemischen Abgrenzungen von einer hegemonialen Moralisierungsstrategie des politischen Raums verstehen sich als ein Plädoyer für eine Rückkehr zu einem differenztheoretisch informierten Um- gang mit dem Problem der politischen Artikulation. Der Rückverweis auf die demokratietheoretisch situierte doppelte Problematik der Repräsentation wirft jedoch zugleich Fragen auf, die allenfalls angedeutet werden können. Es handelt sich dabei nicht nur um die Frage der Repräsentation, d.h. die Frage nach den Implikationen der politischen Artikulation, der Formierung politischer Akteu- re und der Form politischer Strategien. Offensichtlich bildet die Konstitution politischer Akteure ein Problem, bei dem es nicht zuletzt auch um Fragen der Autorisierung geht, in denen das Verhältnis von Souveränität und Repräsentation nicht unproblematisch ist. Die sich damit andeutenden Probleme sind nicht un- erheblich für das, was sich als politische Strategie verstehen lässt: Diese dürfte sich dann weder rational noch moralisch zweifelsfrei begründen lassen. Es ergibt sich die Perspektive auf einen politischen Raum, der sich dann nicht mehr einfach vor scheinbar universalen Vernunft- oder Moralansprüchen zu rechtfertigen hat, sondern der sich als solcher gerade in der Verselbständigung gegenüber solchen Ansprüchen einsehen lässt. Zu berücksichtigen wäre so jene Ausdifferenzierung von Wissen und Macht, von der Lefort (1990) spricht. Dies betrifft wiederum direkt die Frage nach dem Ort der Kritik, die im vorliegenden Text anhand des Verhältnisses von politischer Artikulation und moralischen Universalisierungs- ansprüchen verhandelt wurde. Es ist dies nicht nur theoretisch die Frage nach den Kriterien ihrer Geltung, nach dem Verhältnis von (moralischer) Empörung und theoretischer Begründung der analytischen Perspektive. Es ist dies vor allem auch eine praktische Problematik, wenn man sie im Rahmen einer politischen Artikulation betrachtet, in der Wahrheits- und Universalisierungsansprüche im- mer partikular bzw. strategisch bleiben. Diese Fragen nach dem, was man unter einer politischen Artikulation verstehen könnte, und was dies wiederum für ein Verständnis von Kritik: auch von Diskriminierungskritik bedeuten könnte, bilden den Hintergrund der hier vorgelegten Auseinandersetzung mit einer Moralisie- rungsfigur, die gerade diese Probleme zu unterlaufen beansprucht. Es deuten sich damit Untersuchungsperspektiven und Fragehorizonte an, auf die hier allenfalls verwiesen werden kann. 82
Literatur
Adorno, Theodor W. (1996): Negative Dialektik. Frankfurt/M.
Berg, Eberhard/Fuchs, Martin (Hrsg.) (1993): Kultur, soziale Praxis, Text. Die Krise der
ethnographischen Repräsentation. Frankfurt/M.
Derrida, Jacques (1974): Die Schrift und die Differenz. Frankfurt/M.
Foucault, Michel (1977): Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses.
Frankfurt/M.
Horkheimer, Max/Adorno, Theodor W. (1983): Dialektik der Aufklärung. Frankfurt/M.
Laclau, Ernesto (2002): Emanzipation und Differenz. Wien.
Laclau, Ernesto/Mouffe, Chantal (2002): Hegemonie und radikale Demokratie. Zur De-
konstruktiondes Marxismus. Wien.
Lefort, Claude (1990): Die Frage der Demokratie. In: Rödel, Ulrich (Hrsg.): Autonome
Gesellschaft und libertäre Demokratie. Frankfurt/M., S. 281–297.
Lefort, Claude (1999): Fortdauer des Theologisch-Politischen? Wien.
Menke, Christoph (2005): Spiegelungen der Gleichheit. Politische Philosophie nach
Adorno und Derrida. Frankfurt/M.
Rancière, Jacques (2002): Das Unvernehmen. Frankfurt/M.
Rousseau, Jean-Jacques (1962): Der Gesellschaftsvertrag. Stuttgart.
Rousseau, Jean-Jacques (1981): Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der
Ungleichheit. In: ders.: Schriften (herausgegeben von Henning Ritter), Band 1, Frank-
furt/M., S. 165–302.
Wieland, Wolfgang (1989): Aporien der praktischen Vernunft. Frankfurt/M.
83Sie können auch lesen