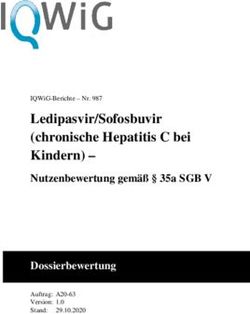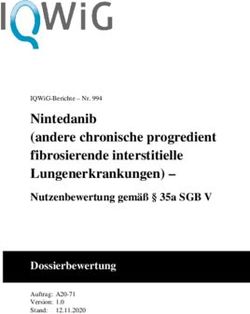Sportklinik Stuttgart - OPARU
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Sportklinik Stuttgart Department Obere Extremität Chefarzt Priv. Doz. Dr. Frieder Mauch Klinische Untersuchung nach Refixation der distalen Bizepssehne mittels Single- Inzisionstechnik und Fadenanker Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Medizin der Medizinischen Fakultät der Universität Ulm Julia Zenner geb. in Saarbrücken 2019
Amtierender Dekan: Prof. Dr. Thomas Wirth 1. Berichterstatter: PD Dr. Frieder Mauch 2. Berichterstatter: PD Dr. Stefan Schmidt Tag der Promotion: 14.02.2020
Teile dieser Dissertation wurden bereits in folgendem Fachartikel veröffentlicht: Krickl, V. und Zenner, J. und Huth, J. und Mauch F. „Distale Bizepssehnenruptur.“ Obere Extremität (2020), https://doi.org/10.1007/s11678-019-00552-1
I Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis II 1.Einleitung 1 1.1 Anatomie 1 1.2 Die distale Bizepssehnenruptur 4 1.3 Therapie der distalen Bizepssehnenruptur 7 2. Material und Methodik 11 2.1 Patientenkollektiv 11 2.2 Behandlungsmethode 12 2.3 Auswertung der Krankenakten 16 2.4 Anamnese 16 2.5 Körperliche Untersuchung 18 2.6 Fragebögen 21 2.7 Statistische Auswertung 25 3. Ergebnis 26 3.1 Auswertung der Patientendaten 26 3.2 Kraft 29 3.3 Sport 31 3.3.1 Sportart 31 3.3.2 Aktivitätslevel 31 3.3.3 Rückkehr zum sportlichen Niveau 32 2.3.4 Sport-Modul des Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Score 33 3.4 Alltag 35 3.4.1 Score von Broberg und Morrey 35 3.4.2 Mayo Elbow Performance Score 36 3.4.3 Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH)-Score 36 3.4.4 Patientenzufriedenheit 38 3.5 Komplikationen 40 4. Diskussion 49 5. Zusammenfassung 63 6.Literaturverzeichnis 65 Danksagung 73 Lebenslauf 74
II Abkürzüngsverzeichnis A. Arteria Abb. Abbildung DASH- Score Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand – Score et al. lateinisch: und andere FABS-Position (Flexion/Abduktion/Supination) - Position M. Musculus Meps Mayo Elbow Performance Score Mrt Magnetresonanztomographie N. Nervus N. cut. antebrachii lat. Nervus cutaneus anterbrachii lateralis Proc. Processus R. Ramus ROM Range of motion Tub. rad. Tuberositas radii V. Vena Z.n. Zustand nach
EINLEITUNG 1 1.Einleitung „Die distale Bizepssehnenruptur […] wird mit zunehmender Inzidenz beobachtet.“ (Krickl und Zenner et. al 2020). Während 2002 die Anzahl der Erkrankungen auf 1,2 pro 100.000 Einwohner pro Jahr geschätzt wurde (Safran u. Graham 2002), berichtete Kelly 2015 von einem deutlich höheren Aufkommen von 2,55 pro 100.000 Einwohner pro Jahr (Kelly et al. 2015). Mehrheitlich sind aktive Männer zwischen 40 und 60 Jahren betroffen (Kelly et al. 2015). In der Regel reißt die Sehne traumatisch im Rahmen einer exzentrischen Kraft von etwa 40 kg, die entgegen der Zugrichtung des gebeugten M. biceps brachii wirkt. Die Ruptur geschieht am häufigsten im Sehnenansatzbereich an der Tuberositas radii (Hughes und Morrey 2009). Ein frühzeitiges operatives Vorgehen, führt in der Regel zu einem funktionell besseren Outcome (Haverstock 2017). An der Sportklinik Stuttgart erfolgt die operative Refixierung der Sehne an die Tuberositas radii mittels zweier Fadenanker. In Rahmen dieser Arbeit wurden 29 Patienten im Mittel 36 Monate nach der Operation nachuntersucht (Erstveröffentlichung in Krickl und Zenner et. al 2020). Das funktionelle postinterventionelle Ergebnis sollte anschließend in Hinblick auf die Alltagsfunktionen und Sportfähigkeit untersucht, diskutiert und bewertet werden. 1.1 Anatomie Der lange Kopf des M. biceps brachii entspringt am Tuberculum supraglenoidale der Scapula und verläuft nach Passage des Schultergelenks im Sulcus intertubercularis des Humerus nach distal. Auf seinem Weg schließt sich ihm von medial das vom Proc. coracoideus kommende Caput breve an. Gemeinsam ziehen sie als M. biceps brachii zu ihrem Ansatzpunkt, der Tuberositas radii. Dort inserieren distal vorwiegend die vom Caput breve kommenden Fasern und proximal eher die Fasern des Caput longum. Vor der gemeinsamen Insertionsstelle zweigt ein Teil vom Caput breve als Aponeurosis bicipitalis in die Unterarmfaszie ab (Athwal 2007et al., Wurzinger 2010). Im Mittel ist die Ansatzfläche an der Tuberositas radii 21 mm lang und 7 mm breit. Das Caput breve nimmt davon den größeren Anteil ein (ungefähr 56 %) (Athwal et al. 2007).
EINLEITUNG 2 Abb. 1: Ansatzstelle des M. biceps brachii an der Tuberositas radii Hier zeigt sich die distale Bizepssehne auseinanderpräpariert in ihre zwei Anteile: dem Caput breve und Caput longum. Das Caput breve inseriert sichtbar distal des Caput longum (Reprinted from Journal of Shoulder and Elbow Surgery Vol. 21, Jarrett, C. D. and Weir, D. M. and Stuffmann, E. S. and Jain, S. and Miller, M. C. and Schmidt, C. C., „Anatomic and biomechanical analysis of the short and long head components of the distal biceps tendon“, P. 942-948, Copyright (2012), with permission from Elsevier.) Diese Tatsachen wurden in einer Studie von Jarrett et al. 2012 biomechanisch näher untersucht. Es zeigte sich bezüglich ihrer Funktion Folgendes: Bei proniertem Unterarm ist das Caput breve der effizientere Supinator. Mit steigender Supination wird das Caput longum stetig effektiver. Ebenso ist die Höhe der Supinationskraft insgesamt abhängig von der Ellbogenhaltung. Mit zunehmender Pronationshaltung und steigendem Grad der Ellenbogenbeugung in Richtung 90° nimmt die Kraft zu. Je mehr der Unterarm proniert, desto mehr bewegt sich die Tuberositas radii zusammen mit der distalen Bizepssehne nach dorsal und desto stärker dreht sich die Sehne um den Radius ein. Dies ermöglicht eine deutliche Vorspannung des Bizepses und nachfolgend eine gesteigerte Kraftentwicklung. Wird der Ellenbogen nun zusätzlich um 90° gebeugt, gelangt die Rotationsachse des Unterarms senkrecht zum Verlauf des Bizepses und die Kontraktionskraft kann optimal in eine Supinationsbewegung umgesetzt werden. In gestreckter Ellenbogenhaltung bewirkt hautsächlich der M. supinator die Supination. Insgesamt ist eine maximale Supination von 80-90° des Ellebogens möglich (Elser 2010). Die wichtigsten Gegenspieler der Supination sind der M. pronator teres und M. pronator quatratus. Sie können den Unterarm um 80-90° pronieren.
EINLEITUNG 3 Abb. 2: Lage der distalen Bizepssehne nach vollständiger Pronation Dieses Schema zeigt, wie sich die Bizepssehne bei 90° Ellenbogenbeugung und vollständiger Pronation um den Radius wickelt und nach dorsal gelangt. SH steht für das Caput breve und LH für das Caput longum (Reprinted from The Journal of Hand Surgery Vol. 38, Schmidt, C. C. and Jarrett, C. D. and Brown, B. T., „The distal biceps tendon“, P. 811-821, Copyright (2013), with permission from Elsevier.) Neben der Ellbogensupination kommt dem M. biceps brachii eine wichtige Rolle als einer der Hauptbeugemuskeln zu. Zusammen mit dem M. brachialis und M. brachioradialis erlaubt er eine Flexion von bis zu 150° (Elser 2010). Die Beugekraft der einzelnen Muskeln unterliegt der Supinations- bzw. Pronationsstellung des Unterarms. In Pronationshaltung ist der M. brachialis stärkster Flexor. Bei maximaler Supination entwickelt der M.biceps brachii das höchste Drehmoment und somit die stärkste Beugekraft (Elser 2010).
EINLEITUNG 4 1.2 Die distale Bizepssehnenruptur Bei 3-10% aller Bizepssehnenrupturen reißt die distale Bizepssehne (Hughes u. Morrey 2009). Die restlichen sind proximale Sehnenrisse. Am häufigsten rupturiert die distale Sehne bei Männern im mittleren Alter von 40-60 Jahren (Kelly 2015). Die Sehne des dominaten Arms reißt tendentiell häufiger. In der Studie von Kelly et al. war sie zu 52,1% und in der Arbeit von Safran und Graham zu 85,7% betroffen. Das Verletzungsrisiko wird besonders durch körperliche Arbeit und sportliche Betätigung, insbesondere Gewichtheben, erhöht (Keener 2011). Die Inzidenz wird auf ungefähr 1,2 (Safran u. Graham 2002) bis 2,55 (Kelly et al. 2015) pro 100.000 Einwohner pro Jahr geschätzt. Der zugrundeliegende pathophysiologische Prozess ist bisher nicht ausreichend erforscht und wird im Allgemeinen auf einen degenerativen Prozess der Bizepssehne zurückgeführt. Als Risikofaktoren wurden u.a. der Gebrauch von anabolischen Steroiden und Nikotinabusus identifiziert (Hughes u. Morrey 2009). Zum Abriss führt schließlich ein Trauma in Form einer exzentrisch, entgegen der Zugrichtung des kontrahierten Bizepses, wirkenden Kraft (Sutton et al. 2010, Hughes u. Morrey 2009). In den meisten Fällen reißt die Sehne am Ansatzbereich an der Tuberositas radii. Dabei werden vollständige Rupturen häufiger beobachtet als Teilrupturen. Reißt neben der Bizepssehne die Aponeurosis bicipitalis, so kommt es zu einer sichtbaren Proximalisierung des Muskelbauchs und Beuge- und Supinations- schwäche nehmen deutlich zu (Hughes u. Morrey 2009). Betroffene berichten teilweise von einem initialen Knall und einem danach einsetzenden Schmerz in der Ellenbeuge (Hughes u. Morrey 2009). Im Verlauf bildet sich dort eine Schwellung. „Dem Untersucher gelingt es im sog. Hook-Test nicht, die Bizepssehne von lateral mit dem Zeigefinger im Bereich der Ellenbeuge zu unterfahren.“ (Krickl ünd Zenner et. al 2020) (s. Abb. 3, S. 5). Dieses Testergebnis ist pathognomonisch für eine distale Bizepssehnenruptur. In einer Studie von O’Driscoll et al. mit 45 Teilnehmern konnten mit ihm die 33 vollständigen Rupturen erfolgreich von den partiellen Rupturen unterschieden werden (O’Driscoll et al. 2007).
EINLEITUNG 5 Abb. 3: Der Hook-Test Der Zeigefinger hakt sich von lateral unter die intakte Bizepssehne des linken Oberarms. Zum Frakturausschluss wird initial ein Röntgenbild des Ellbogens in zwei Ebenen angefertigt. Die distale Bizepssehne kann anschließend sonographisch und kernspin- tomographisch begutachtet werden. Im Ultraschall ist häufig ein Hämatom nachweisbar. Teilweise kann hier schon zwischen einer partiellen und kompletten Ruptur unterschieden werden (Da Gama Lobo et al. 2013). A B Abb. 4: Ultraschallbild einer partiellen (A) und vollständigen (B) Bizepssehnen- ruptur (De la Fuente et al. 2018) A zeigt den Längsschnitt einer partiellen Ruptur von proximal (P) nach distal (D), erkennbar an der Hypoechogenität und Unregelmäßigkeit des Sehnenrandes (s. Pfeile). B zeigt den Längsschnitt einer vollständigen Ruptur. Man sieht die gerissene Sehne (weiße Pfeilspitzen) retrahiert oberhalb des M. brachialis und echoarme Flüssigkeit und Hämatombildung in ihrem ursprünglichen Verlaufsweg (Stern). (De La Fuente, J and Blasi, M. and Martínez, S. and Barcélo, S. and Cachán, K and Miguel, M. and Pedret, C. „Ultrasoünd classification of traümatic distal biceps brachii tendon injüries.“ Skeletal Radiol 47 (2018): 519-532. The figure is reprinted under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 Internationel License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
EINLEITUNG 6 Die sichere Abgrenzung gelingt allerdings nur mit Hilfe der Kernspintomographie als Mittel der Wahl. In der sog. FABS (Flexion/Abduktion/Supination)-Position lässt sich der Sehnenansatz optimal darstellen. Abb. 5: FABS (Flexion/Abduktion/Supination)-Position Die Abbildung zeigt die FABS (Flexion/Abduktion/Supination)-Position. Durch Flexion im Ellenbogen- gelenk und Abduktion im Schultergelenk mit Supination des Unterarms gelangt der Arm in die FABS- Position. Typische MRT-Befunde einer Ruptur sind (Festa et al. 2010): • Sehnendiskontinuität • Peritendinöse Signalanhebung • Erhöhte Signalintensität intratendinös im Bizepsmuskel oder umgebenden Gewebe • Ödembildung im Bereich der Tuberositas radii
EINLEITUNG 7 A B Abb. 6: Mrt-Bilder in FABS-Position einer gesunden (A) und vollständig rupturierten (B) distalen Bizepssehne (Chew u. Guiffrè 2005) A zeigt den geraden Verlauf einer gesunden Sehne vom muskulotendineusen Übergang (kleiner Pfeil) zur Tuberositas radii (großer Pfeil). B zeigt den kompletten Abriss einer Bizepssehne mit entsprechender Sehnendiskontinuität (kurzer Pfeil), der peri- und intratendinösen Signalanhebung und dem abnormal verdickten proximalen Teil der Sehne (langer Pfeil). (Reprinted from Radiographics Vol. 25, Chew, M. L. and Guiffrè, B. M., „Disorders of the distal biceps brachii tendon“, P. 1227-1237, Copyright (2005), with permission from Radiological Society of North America.) 1.3 Therapie der distalen Bizepssehnenruptur Die distale Bizepssehnenruptur kann sowohl konservativ, als auch operativ mit unterschiedlichen Operationsverfahren behandelt werden. Die konservativen Konzepte setzen sich aus körperlicher Schonung, analgetischer Therapie und Physiotherapie zusammen. Obwohl sich die Flexionskraft um 10-40% und die Supinationskraft um 37 bis 44% am betroffenen Arm verringert (Hansen et al. 2014), sind die Patienten häufig zufrieden mit dem Ergebnis (Hetsroni et al. 2008). Ein operatives Vorgehen liefert dagegen funktionell bessere Ergebnisse. Es resultiert lediglich eine um ca. 1- 13% geminderte Flexionskraft und eine um etwa 7-20% reduzierte Supinationskraft (Hansen et al. 2014, Haverstock et al. 2017, McGee et al. 2015, McKee et al. 2005, Schmidt et al. 2016, Suda et al. 2017). Die Entscheidung, ob eine konservative oder operative Behandlung erfolgen sollte, ist in Abhängigkeit des
EINLEITUNG 8 Patientenalters und körperlichen Aktivität im Sinne einer Risiko-Nutzen Abwägung zu treffen. Während bei jüngeren Patienten der Nutzen in Form einer besseren Funktionalität überwiegt, dominiert bei älteren Patienten das steigenden Narkose- und Komplikationsrisiko. Dies hat zur Folge, dass mit zunehmendem Patientenalter vordringlich die konservative Behandlung bevorzugt wird. In der Regel sind aber jüngere, körperlich aktive Personen von einer Ruptur betroffen, so dass eine operative Refixation favorisiert wird. Diese sollte möglichst frühzeitig erfolgen. Wird verspätet operiert, erschwert Narbengewebe die Mobilisierung der Bizepssehne und die Komplikationsrate steigt (Bisson et al. 2008, Cain et al. 2012, Kelly et al. 2000). „Welche Operationsmethode zu bevorzugen ist, wird […] kontrovers diskutiert. Mit dem Ziel, die Sehne möglichst minimalinvasiv, komplikationslos und anatomisch korrekt zu reinserieren, sind im Verlauf zahlreiche Operationsmethoden entstanden.“ (Krickl und Zenner et. al 2020) Als gängige Operationsverfahren haben sich zwei Methoden durchgesetzt: • Die in dieser Studie verwendete Single-Inzisionstechnik mit Fadenanker, welche im Material und Methoden Teil S.12 näher erläutert wird. • Die von der Mayo Klinik modifizierte Zwei-Inzisionstechnik nach Boyd- Anderson (1961) In der Zwei-Inzisionstechnik erfolgt der erste operative Zugang gleich der Single- Inzisions-Technik, über eine s-förmige Inzision in der Ellenbeuge. Nachdem unter Schonung des N. cutaneus antebrachii lateralis in die Tiefe zur Tub. radii präpariert wurde, beginnt die Vorbereitung des zweiten dorsalen Zugangswegs. Der Operateur ertastet die Tub. radii und führt eine nach radial ausgerichtete, gebogene Kocherklemme zwischen Elle und Speiche hinter diese. Auf der Gegenseite kann anschließend die Spitze der Klemme palpiert werden. Hier wird bei maximal proniertem Unterarm dorsolateral inzidiert. Nach Spaltung des Musculus supinator und extensor carpi ulnaris erreicht man die Kocherklemme an der Tuberositas radii.
EINLEITUNG 9 Die Tuberositas radii wird dargestellt und der Knochen für die Aufnahme der Sehne präpariert. A B C D Abb. 7: Die Doppel-Inzisionstechnik Diese Abbildung zeigt den zeitlichen Ablauf der Doppelinzisionstechnik. A Die dorsolaterale Inzision erfolgt oberhalb der von ventral eingeführten Kocherklemme bei maximaler Pronation. B Die Tuberositas radii wird über den dorsalen Zugang dargestellt und nach Einlassen einer Knochensenke mit drei transossären Löchern versehen. C Die Bizepssehne wird über den ventralen Zugang am Radius vorbei nach dorsal geführt und D an der Tuberositas radii fixiert (Source: AO Surgery Reference, www.aosurgery.org, Copyright by AO Foundation, Switzerland, https://surgeryreference.aofoundation.org/orthopedic-trauma/adult-trauma/proximal- forearm/radius-extraarticular-avulsion-of-bicipital-tuberosity/biceps-reinsertion#option-1-tendon- through-bone-tunnel-two-incision-approach- 13.05.2020) 1.4 Ziele der Studie „Unabhängig von der Operationstechnik und deren Komplikationen ist bisher kein Verfahren in der Lage, die Supinationskraft wieder vollständig herzustellen.“ (Krickl und Zenner et. al 2020). Typischerweise ist die Kraft auf 80% bis 90 % reduziert. In einer Studie von Siebenlist et al. 2014 mit 49 Patienten wurde sogar ein durchschnittlicher Kraftverlust von 36,4% gemessen (Siebenlist et al. 2014). Dennoch waren 86% der Patienten zufrieden mit dem Operationsergebnis.
EINLEITUNG 10 „Die Patientenzufriedenheit scheint trotz der Komplikationen und Krafteinschränkung sehr hoch zu sein.“ (Krickl und Zenner et. al 2020). Es stellt sich die Frage, ob das Kraftdefizit in der Supination für den Patienten relevant ist. Erwarten den Betroffenen daraus wirklich Nachteile in seiner normalen Alltagsbewältigung? Eine Möglichkeit, die Einschränkungen im Alltag zu quantifizieren, ist der Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) Fragebogen. Da Sport zunehmend zum Alltag vieler Personen gehört, sollte die Sportfähigkeit zusätzlich berücksichtigt werden. Aus diesen Gegebenheiten ließen sich folgende Studienziele ableiten: • Messung der Supinationskraft in der Neutral-Null-Supinationsstellung • Erhebung klinischer Scores, inbesondere des DASH-Scores, zur Einschätzung der Alltagsbewältigung • Bestimmung der wöchentlichen sportlichen Aktivität und Beantwortung der Frage, inwieweit das ursprüngliche Sportniveau wieder erreicht wurde. • Erfassung der Komplikationen Wir stellten die Hypothese auf, dass es zwar zu einem signifikanten Verlust an Supinationskraft kommt, die Patientenzufriedenheit davon aber unbeeinflusst sehr hoch bleibt. Wir postulierten zudem, dass in den Scores zur Alltagsbewältigung und zur Sportfähigkeit gute bis sehr gute Ergebnisse erreicht werden und die Single- Inzisiontechnik mit Verwendung zweier Fadenanker ein sicheres Operationsverfahren mit einem geringen Risiko für schwerwiegende Komplikationen ist.
MATERIAL UND METHODIK 11 2. Material und Methodik Der erforderliche Ethikantrag (Aktenzeichen F–2015.090) wurde an die Landes- ärztekammer Baden-Württemberg gestellt und das erteilte Ethikvotum den Vorgaben entsprechend umgesetzt. 2.1 Patientenkollektiv Zwischen 2011 und 2013 wurden 63 distale Bizepssehnenrupturen von 62 Patienten an der Sportklinik Stuttgart operiert (Erstveröffentlichung in Krickl und Zenner et. al 2020). Nach Prüfung der Ein- und Ausschlusskriterien konnten, von den 60 verbliebenen Patienten, 29 (48,5%) in die Studie eingeschlossen und an der Sportklinik untersucht werden. 18 Patienten (30%) hatten, trotz Zufriedenheit über das Operationsergebnis, kein Interesse an einer Studienteilnahme. Bei acht Patienten gelang keine telefonische Kontaktaufnahme. Fünf Patienten lehnten die Teilnahme aufgrund der großen Entfernung von Stuttgart zu ihrem Wohnort ab (Erstveröffentlichung in Krickl und Zenner et. al 2020). Sobald ein Patient sich zur Teilnahme bereit erklärte, wurde mit ihm ein Untersuchungstermin an der Sportklinik Stuttgart vereinbart. Am Tag der Untersuchung wurde der Patient erneut über den genauen Ablauf der Studie aufgeklärt und die Freiwilligkeit der Studienteilnahme betont. Im Anschluss erhielt er ein Informationsblatt über die Studie, eine Einwilligungserklärung und eine Datenschutzerklärung zur Unterschrift. Nachdem der Patient diese unterschriftlich akzeptierte, wurden die Ein- und Ausschlusskriterien der Studie vom Untersucher überprüft. Einschlusskriterien: • männliche Patienten mit refixierter distaler Bizepssehne mittels Ein-Inzisionstechnik und Fadenanker • Die Operation erfolgte in den Jahren 2011, 2012 oder 2013 an der Sportklinik Stuttgart. Ausschlusskriterien: • Alter unter 18 Jahren • Alter über 80 Jahre
MATERIAL UND METHODIK 12 Die Problematik einer distalen Bizepssehnenruptur betrifft fast ausschließlich Männer. Bei Safran and Graham waren 92,8% (Safran and Graham 2002) und bei Kelly et al. 95,7% (Kelly et. al 2015) der Betroffenen männlichen Geschlechts. Daher wurde die Studie auf dieses Patientenkollektiv ausgerichtet und nur männliche Patienten eingeschlossen. Schließlich wurden 29 Patienten im durchschnittlichen Alter von 53 Jahren (Altersspanne von 36 bis 75 Jahren) und 30 reinserierte distale Bizepssehnen eingeschlossen (Erstveröffentlichung in Krickl und Zenner et. al 2020). Bei zwei Patienten gab es eine zweite Operation nach Reruptur. 2.2 Behandlungsmethode Alle Patienten wurden mit Hilfe der Single-Inzisionstechnik unter der Verwendung von zwei Mitek-G2 Fadenankern operiert (Erstveröffentlichung in Krickl und Zenner et. al 2020). Der operative Zugang erfolgt bei dieser Methode mit einer s-förmigen Inzision in der Ellenbeuge. Der N. cutaneus antebrachii lateralis wird aufgesucht und im weiteren Verlauf geschont. Abb. 8: Der operative Zugang Links dargestellt ist die s-förmige Schnittführung in der Ellenbeuge. Im rechten Bild wurde bereits weiter in die Tiefe präpariert. Die hier zur Darstellung kommenden nervalen Bahnen mit dem N. cutaneus antebrachii lateralis (oben im Bild) werden im Folgenden vorsichtig zur Seite gehalten, während mittig die Tuberositas radii aufgesucht wird. Anschließend wird der Arm maximal supiniert, die Tuberositas radii gelangt möglichst weit nach ventral und die umliegenden Strukturen werden freigelegt. Auf diese Weise kommt die Tub. radii bestmöglichst zur Darstellung. Es ist darauf zu achten, den N. radialis, insbesondere den R. profundus, die A. radialis und den N. medianus zu
MATERIAL UND METHODIK 13 schonen. Die Tuberositas radii wird von degenerativem Material befreit und zwei Löcher für die Fadenanker vorgebohrt. Ein Anker wird proximal, einer distal an der Tuberositas radii eingebracht. Abb.9: Einbringen der Fadenanker Nachdem in A die Tuberositas radii angeraut wurde, werden in B Bohrlöcher für Fadenanker eingelassen. Abbildung C zeigt das Einbringen des ersten Ankers. In D sind links die Fäden des proximalen und rechts die Fäden des versenkten distalen Fadenankers zu sehen. Reprinted by permission from Springer Nature Customer Service Centre GmbH: Springer Obere Extremität „Distale Bizepssehnenrüptür“, Krickl, V., Zenner, J., Huth, J. und Mauch F., Copyright 2020, advance online publication, 19. März 2020 (doi: 10.1007/s11678-019-00552-1 Obere Extrem) Anschließend wird der Sehnenstumpf der Bizepssehne aufgesucht, der bei einer Komplettruptur oft nach proximal retrahiert ist. Je früher die Erkrankung diagnostiziert und operiert wird, umso leichter lässt sich die Sehne vom umliegenden Gewebe mobilisieren. Vorliegende Adhäsionen werden gelöst und degenerative Areale entfernt. Mit Hilfe der Krackow-Naht wird das Sehnenende fest durchflochten. Die vom Caput longum stammenden Fasern werden mit dem proximalen Anker verbunden. Der
MATERIAL UND METHODIK 14 Sehnenanteil des Caput breve wird am distalen Fadenanker befestigt. Auf diese Weise wird die Sehne entsprechend ihres ursprünglichen Verlaufs reinseriert. A B C D Abb.10: Single Inzisionstechnik Darstellung der Single-Inzisionstechnik, nachdem bereits zwei Fadenanker in die Tuberositas radii eingelassen wurden. Abbildung A zeigt die frei mobilisierte distale Bizepsehne. Sie wird in Bild B mit der Krakownaht durchflochten und in C mit den Fadenankern verbunden. D stellt schließlich die refixierte Bizepssehne dar. Postoperativ wurden alle Patienten entsprechend des Nachbehandlungsschemas der Sportklinik Stuttgart therapiert, welches in den ersten sechs Wochen eine Ruhigstellung des Ellenbogengelenks in einer Oberarmgipsschiene beinhaltet. In dieser Zeit erfolgt eine assistierte Mobilisation aus der Schiene heraus. Anschließend wird es aktiv, mit langsam zunehmender Intensität, mobilisiert. Bis drei Monate nach der Operation ist eine sportliche Belastung unbedingt zu vermeiden.
MATERIAL UND METHODIK 15 Tabelle 1: Nachbehandlungsschema der Sportklinik Stuttgart nach Operation einer distalen Bizepssehnenruptur © Sportklinik Stuttgart, Abt. Physiotherapie, Taubenheimstraße 8, 70372 Stuttgart, Tel.: 0711/5535-135 Phase I Phase II Phase III Phase IV 1. –3. Woche 4. – 6. Woche 7. – 12.Woche ab der 12.Woche Ziele Ziele Ziele Ziele Mobilisation Mobilisation Mobilisation Mobilisation aus Gips heraus aus Gips heraus schmerzadaptiert Schmerzadaptiert assistiv Schmerz- und assistiv Schmerz- und Übergang zur aktiven Übergang zur spannungsfrei spannungsfrei Mobilisation aktiven Mobilisation Pro/ Supi 45-0-45 Pro/ Supi 45-0-45 Ext/ Flex 0-30-100 Ext/ Flex 0-10-120 Belastung Belastung Belastung Belastung keine Belastung keine Belastung Aktive Belastung bis 5 Erarbeiten einer Ossifikations- kg reizfreien, vollen prophylaxe für 2 Belastbarkeit unter Wochen Vermeidung größerer sportlicher Belastung für 3 Monate auf Wettkampfniveau für 6 Monate Maßnahmen Maßnahmen Maßnahmen Maßnahmen 1. –3. Woche 4. – 6. Woche 7. – 12.Woche ab der 12.Woche OA- Gipsschale für 6 Wochen Physiotherapie Physiotherapie Physiotherapie Physiotherapie 1. post – OP – Tag - heisse Rolle - aktive Mobilisation - Manuelle Therapie - Hochlagerung / Eis Schulter / Ellenbogen/ - Kompression - bei Bedarf man. - PNF – direktes Hand - Isometrie Lymphdrainage Scapula- Pattern - Prophylaxen - PNF – direktes - aktive Mobilisation - Zugapparat und/oder Pattern mit ab d. 2. post. OP – Tag über Antagonisten Theraband zur angemessenen - man. Lymphdrainage unter Kräftigung der Widerstand - assist. Mobilis. aus Berücksichtigung der Antagonisten dem Gips heraus, Belastbarkeit → absolüte Schmerz – - Elektrotherapie Pro/ Supi 45-0-45 u. Spannungsfreiheit Ext/ Flex 0-30-100 - PNF indirektes der Bizepssehne - Elektrotherapie Pattern über gesunde - aktive Mobilisation Seite - Elektrotherapie der angrenzenden Gelenke im Gips - Elektrotherapie Trainingstherapie - Training zunächst im Achtung aeroben Bereich Wundheilung anschließend kein Alkohol u. Belastung Nikotin für 2 Wochen angemessen steigern keine direkte → ü.a. Crosstrainer, Sonnen- Zugapparat, therapeut. einstrahlung oder Kletterwand, Sauna für 6 Wochen Kurzhantel
MATERIAL UND METHODIK 16 2.3 Auswertung der Krankenakten Die Aktensichtung lieferte folgende Daten: • Unfalldatum • Unfallhergang • Zeit bis zur Operation • Operationsverlauf • Krankenhausliegezeit 2.4 Anamnese Erhebung allgemeiner Patientendaten: • Alter • Händigkeit • Erkrankung an der Gegenseite, welche nicht von der Ruptur betroffen war • Fragen zu den Risikofaktoren (u.a. der Gebrauch von Tabak, Cortison oder Anabolika) für die Bizepssehnenruptur. Nachfolgend sollte sich der Patient über mögliche Langzeitfolgen, wie z.B. Schmerz, Empfindungsstörungen oder Kraftverlust äußern: Tabelle 2: Schmerzmerkmale Schmerz Lokalisation Häufigkeit Schmerzstärke in Vas Analog Skala Qualität In Ruhe/ unter Belastung Tabelle 3: Sensibiliät Parästhesien Lokalisation Häufigkeit Qualität Insbesondere war auch das Auftreten von objektivierbaren Komplikationen von Interesse. Vor diesem Hintergrund wurden Röntgenbilder aus der Nachbehandlungs- zeit betrachtet und auf das Vorliegen von heterotopen Ossifikationen untersucht.
MATERIAL UND METHODIK 17 Tabelle 4: Graham und Hastings Klassifikation für heterotope Ossifikation (Hastings u. Graham 1994, Hong et al. 2015) Klasse Beschreibung I Radiologische Evidenz für heterotope Ossifikation ohne funktionelle Einschränkung II A Einschränkung in Ellbogenflexion/-extension B Einschränkung in Unterarmpronation/-supination C Einschränkung in Flexion/Extension und Pronation/Supination III Ankolyse im Unterarm, Ellbogen oder beidem Die Zufriedenheit des Patienten mit dem Operationsergebnis wurde in „zufrieden“, „eher zufrieden“, „eher unzufrieden“ und „unzufrieden“ unterteilt. Abschließend wurde der Patient näher zu seinen sportlichen Interessen befragt. Von Bedeutung waren: • Sportart • Gesamtdauer der wöchentlichen Aktivität • Vergleich des aktuellen mit dem früheren Aktivitätsniveau Mit Hilfe der Gesamtdauer der wöchentlichen Aktivität konnte der Aktivitätslevel nach Valderrabano (Valderrabano et al. 2006) festgestellt werden. Dieser wird in Aktivitätsniveaus von 0-4 unterteilt. Tabelle 5: Sportlevel nach Valderrabano et al. (Valderrabano et al. 2006) 0 Keine sportliche Aktivität 1 Geringe sportliche Aktivität in der Freizeit (< 1h/Woche) 2 Normale sportliche Aktivität in der Freizeit (< 1-5h/Woche) 3 Hohe sportliche Aktivität in der Freizeit (> 5h/Woche) 4 Leistungssport Von Bedeutung war zusätzlich die Frage, in welchem Maß der Patient zu seinem ursprünglichen sportlichen Aktivitätsniveau zurückkehren konnte. Rhee et al. teilt diese Rückkehr in 5 Level ein (Rhee et al. 2006).
MATERIAL UND METHODIK 18 Tabelle 6: Rückkehr zum Aktivitätsniveau nach Rhee et al. (Rhee et al. 2006) 1 Sportfähigkeit wird komplett wiedererreicht 2 90% der Sportfähigkeit wird wiedererlangt 3 70% moderate Einschränkung der Sportfähigkeit 4 50% Sportfähigkeit stark eingeschränkt 5 Kein Wiedererlangen der Sportfähigkeit, Probleme bei alltägl. Belastungen 2.5 Körperliche Untersuchung Die klinische Untersuchung des Ellenbogens begann an der Rupturseite mit Inspektion der Hautfarbe, der Hautbeschaffenheit und der Narbe. Bei 90 Grad gebeugtem und supiniertem Arm wurde die distale Bizepssehne mit Hilfe des Zeigefingers ertastet und unterfahren (siehe Abbildung 3). Dieser sog. Hook-Test (O’Driscoll et al. 2007) identifizierte die Sehne als intakt. Der Test wurde an beiden Extremitäten durchgeführt. Im weiteren Verlauf folgte die Beurteilung der Ellenbogenstabilität beider Arme mit Valgus- und Varusstresstest. Abb. 11: Valgusstresstest – Stabilität der medialen Kollateralbänder Die Pfeile zeigen die Kraftrichtung an. Der zu untersuchende Arm wird vollständig gestreckt und supiniert. Anschließend drückt der Untersucher den Oberarm nach medial und den Unterarm nach lateral.
MATERIAL UND METHODIK 19 Abb. 12: Varusstresstest – Stabilität der lateralen Kollateralbänder Die Pfeile zeigen die Kraftrichtung an. Der zu untersuchende Arm wird vollständig gestreckt und supiniert. Anschließend drückt der Untersucher den Oberarm nach lateral und den Unterarm nach medial. Die körperliche Untersuchung beinhaltete anschließend die Messung des Bewegungs- umfangs beider Ellenbogengelenke mit der Neutral-0-Methode. Mit Hilfe eines Goniometers wurde die aktive Beweglichkeit der Supination, Pronation, Flexion und Extension gemessen. Anschließend folgte die Einschätzung der Flexions-, Extensions-, Supinations- und Pronationskraft beider Arme mit Hilfe der Pareseskala des Medical Research Council (MRC) in Kraftgraden von 0-5 (Medical Research Council 1976). Die Pareseskala des Medical Research Council (MRC) ist in sechs Stufen (von 0 bis 5) eingeteilt [2]: Tabelle 7: Die Pareseskala des Medical Research Council (MRC) (Medical Research Council 1976) 0 keine Kontraktion sicht- oder fühlbar 1 sicht- oder tastbare Kontraktion 2 Bewegung ohne Einfluss der Schwerkraft möglich 3 Bewegung gegen Schwerkraft möglich 4 Bewegung gegen Schwerkraft und Widerstand möglich 5 normale Muskelkraft
MATERIAL UND METHODIK 20 Messung der Supinationskraft mit Hilfe des IsoForceControl V1.1 Bei dem IsoforceControl V1.1 handelt es sich um ein Dynamometer der Herkules Kunststoff Oberburg AG aus der Schweiz (Herkules Kunststoff Oberburg AG 13.05.2020). Er wurde entwickelt, um Muskelkräfte während eines Zeitraums von drei bis fünf Sekunden zu messen und ist in der Lage, Kräfte bis 400 N zu bestimmen. Innerhalb der gewählten Zeitspanne wird die Kraft zehn Mal pro Sekunde gemessen. Aus allen Messungen werden die Anfangskraft, Endkraft, Durchschnittskraft und Maximalkraft bestimmt. Die Supinationskraft wurde dreimal pro Arm gemessen. Aus den Messungen wurde jeweils die Maximalkraft notiert und der Mittelwert gebildet. So erhielt man für die betroffene und die gesunde Seite je drei Werte für die Maximalkraft und daraus je einen Mittelwert. Vor jeder Messung führte das Gerät eine Kalibrierung durch. In Abbildung 14 ist der Messaufbau dargestellt. Zuerst wurde die ursprünglich von der Ruptur betroffene Seite untersucht. Das Gerät wurde in Ellenbogenhöhe des Patienten an der Wand befestigt. Anschließend stellte der Patient sich seitlich mit der gesunden Seite zur Wand hinter das Gerät. Mit der Hand des zu untersuchenden Arms umfasste er mittig den kleinen Holzstab, der am Gerät befestigten Schlaufe. Nun beugte der Patient den Arm aus der Neutral-Null-Position um 90 und legte den Ellenbogen fest an den Körper an. Zusätzlich wurde dieser mit einem Band fest am Körper fixiert, um eine Abduktionsbewegung im Schultergelenk zu verhindern. Auf diese Weise befand sich die Handfläche des zu untersuchenden Arms parallel zur Wand und die Schlaufe führte senkrecht vom Gerät zur Hand des Patienten. Abb. 13: Der Isoforce Control V1.1 Dynamometer zur Messung der Muskelkraft (Mit Erlaubnis der Herstellungsfirma: Herkules Kunststoff Oberburg AG / Switzerland, http://www.isoforcecontrol.ch/de/produkt1.asp 13.05.2020)
MATERIAL UND METHODIK 21 Abb. 14: Versuchsaufbau zur Messung der Supinationskraft a. Foto, b. schematische Darstellung von oben Reprinted by permission from Springer Nature Customer Service Centre GmbH: Springer Obere Extremität „Distale Bizepssehnenrüptür“, Krickl, V., Zenner, J., Huth, J. und Mauch F., Copyright 2020, advance online publication, 19. März 2020 (doi: 10.1007/s11678-019-00552-1 Obere Extrem) Sobald das Dynamometer die Kalibrierung durchgeführt hatte, wurde der Patient gebeten diese Grundhaltung einzunehmen und den Unterarm nach außen zu drehen. Nach drei Wiederholungen erfolgte die Messung der Gegenseite zum Vergleich. Der statische Aufbau ließ lediglich eine isometrische Kraftmessung aus der Neutral- Nullstellung von Pro- und Supination zu. Konnte der Patient die Bewegung nicht wie gewünscht ausführen, wurde er aus der Kraftmessung ausgeschlossen. 2.6 Fragebögen Score von Broberg und Morrey Der Score von Broberg und Morrey (Broberg u. Morrey 1987) setzt sich aus der Selbsteinschätzung des Patienten, einer körperlichen Untersuchung und einer biomechanischen Krafttestung zusammen. Aus der Summe der vier Bereiche Schmerz (35 Punkte), Stabilität (5 Punkte), Beweglichkeit (40 Punkte) und Kraft (20 Punkte) ergibt sich ein maximaler Punktwert von 100. Ein hoher Punktwert bedeutet ein gutes Operationsergebnis. Die Stabilität im Ellenbogen wurde mit Hilfe des Valgusstresstest und des Varusstresstest, wie bereits auf Seite 18 beschrieben, untersucht. Anschließend verwendete der Untersucher ein
MATERIAL UND METHODIK 22 Goniometer, um das Bewegungsausmaß der Flexion (max. 27 Punkte), der Pronation (max. 6 Punkte) und der Supination (max. 7 Punkte.) zu bestimmen. Daraus wurde der Punktwert für die Beweglichkeit (max. 40 Punkte) wie folgt berechnet: (∢Flexionswinkel x 0,2) + (∢Pronationswinkel x 0,1) + (∢Süpinationswinkel x 0,1) Tabelle 8: Score nach Broberg und Morrey (Broberg u. Morrey 1987) Punkte Schmerz Keiner 35 Mild 28 Mäßig 15 Stark 0 Stabilität Normal 5 Leicht vermindert (geschätzt durch den Patienten, keine Einschränkung) 3 Mäßig vermindert (Einschränkung bei gewissen Tätigkeiten) 2 Starker Verlust (Einschränkungen bei alltäglichen Tätigkeiten) 0 Bewegung Grad der Flexion (0,2 x arc) max 27 Grad der Pronation (0,1 x arc) max 6 Grad der Supination (0,1 x arc) max 7 Stärke Normal 20 Leicht vermindert (geschätzt, nicht einschränkend, 80% der Gegenseite) 13 Mäßig vermindert (beschränkt manche Tätigkeiten, 50% der Gegenseite) 5 Stark vermindert (beschränkt alltägliche Tätigkeiten) 0 Gesamt 100 Tabelle 9: Auswertung der Score nach Broberg und Morrey 95 -100 Sehr gut 80 – 94 Gut 60 – 79 Mittelmäßig 0 – 59 Schlecht
MATERIAL UND METHODIK 23 Mayo Elbow Performance Score Die Mayo Elbow Perfomance Score (Morrey u. An 2009) ist ein häufig verwendetes Instrument, um die Ellenbogenfunktion zu evaluieren. Es handelt sich um ein 100- Punkte Bewertungssystem, bestehend aus vier Domänen. Diese Domänen gliedern sich in die zwei subjektiven Bereiche Schmerz und Funktion und die zwei objektiv erfassbaren Kriterien Bewegungsumfang und Stabilität. Die Gelenkstabilität (Valgus- und Varusstresstest) ist graduiert in stabil (10 Punkte), leicht instabil (5 Punkte) und instabil (0 Punkte). Zur Messung des Bewegungsumfangs wurde ein Goniometer verwendet. Während der Patientenbefragung beschrieb der Patient, ob er keine (45 Punkte), leichte (30 Punkte), mittelschwere (15 Punkte) oder starke (0 Punkte) Schmerzen hat. Im Unterpunkt Funktion wurde er nach der Fähigkeit befragt fünf bestimmte Tätigkeiten des alltäglichen Lebens auszuführen (Haare kämmen, selbstständiges Essen, die Körperpflege, die Fähigkeit sich ein Shirt und Schuhe anzuziehen). Für jede Fähigkeit wurden fünf Punkte vergeben. Auf diese Weise waren maximal 25 Punkte im Bereich Funktion möglich. Die Punkte der vier Domänen wurden summiert und man erhielt als Ergebnis Score-Werte zwischen 5 und 100. Tabelle 10: Mayo Elbow Performance Score Punkte Schmerz Kein 45 Geringer 30 Moderater 15 Starker 0 Stabilität Stabil 10 Etwas instabil 5 Völlig instabil 0 Bewegungs- ROM > 100 Grad 20 umfang ROM 50 – 100 Grad 15 (sagittal) ROM < 50 Grad 5 Funktion Fähig, Haare zu kämmen 5 Fähig, sich zu ernähren 5 Fähig, die persönliche Hygiene auszuüben 5 Fähig, Shirt anzuziehen 5 Fähig, Schuhe anzuziehen 5 Gesamt 100
MATERIAL UND METHODIK 24 Tabelle 11: Auswertung der Mayo Elbow Performance Score 90 – 100 Hervorragend 75 - 89 Gut 60 – 74 Mittelmäßig 0 – 59 Mangelhaft Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) Score Der DASH-Fragebogen wurde 1996 entwickelt (Hudak et al. 1996) und ist seitdem ein häufig verwendetes Mittel, um den Einfluss einer Verletzung oder einer bestimmten Therapie an der oberen Extremität auf das alltägliche Leben des Patienten einzuschätzen. Zu dem Hauptmodul des DASH-Fragebogen, bestehend aus 30 Fragen, gehören zusätzlich die zwei optionalen Module Sport/Musik und Arbeit/Beruf aus je vier Fragen. In den Fragen des Hauptmoduls werden neben den Einschränkungen bestimmter Fähigkeiten, Beschwerden der oberen Extremität berücksichtigt. Für jede Frage stehen die Zahlen 1 bis 5 als Ankreuzmöglichkeiten zur Verfügung. Tabelle 12: Ankreuzoptionen des DASH-Score (Hudak et al. 1996) 1 keine Schwierigkeiten/Symptome bzw. überhaupt nicht 2 geringe Schwierigkeiten/Symptome bzw. ein wenig 3 mäßigen Schwierigkeiten/Symptomen bzw. für mäßig 4 erhebliche Schwierigkeiten/Symptome bzw. ziemlich 5 nicht möglich bzw. sehr Der Patient sollte den Fragebogen eigenständig gemäß seinem Zustand der vergangenen Woche ausfüllen. Wurde eine Tätigkeit in der vergangenen Woche nicht ausgeübt, sollte er die am ehesten zutreffende Antwort auswählen. Mit folgender Formel wurde der DASH-Score berechnet, wobei n der Anzahl beantworteten Fragen entspricht: Summe der n Antworten DASH-Score = [( ) − 1] × 25 Wurden mehr als drei Fragen nicht beantwortet, so durfte ein DASH-Wert nicht berechnet werden.
MATERIAL UND METHODIK 25 Die optionalen Module Sport/Musik und Arbeit/Beruf wurden wie folgt berechnet: Summe der n Antworten Modul-Score = [( ) − 1] × 25 4 Für die Auswertung eines optionalen Moduls durften keine Antworten fehlen. Die berechnete Gesamtscore des jeweiligen Moduls kann zwischen 0 und 100 einnehmen. Ein Ergebnis von 0 bezeichnet geringste Einschränkungen und der Wert 100 ist verbunden mit stärksten Einschränkungen. 2.7 Statistische Auswertung Die gesammelten Patientendaten und Ergebnisse wurden in Excel-Tabellen gesammelt und ausgewertet. Es handelte sich um eine nicht-normalverteilte Stichprobe, so dass nicht-parametrische Tests angewandt wurden. Zur Berechnung der Signifikanz einer Aussage bei einem p-Wert unter 0,05 wurde der Mann-Whitney-U-Test genutzt. Die Korrelation zweier Merkmale wurde mit Hilfe des Rangkorrelationskoeffizienten nach Spearman bewertet. Die mittels Excel erstellten Balken- und Kreisdiagramme dienten der graphischen Darstellung der Resultate.
ERGEBNIS 26 3. Ergebnis 3.1 Auswertung der Patientendaten Alter Am Untersuchungstag waren die Patienten durchschnittlich 53,7± 9,4 Jahre alt (Altersspanne von 36 bis 75 Jahre). Das mittlere Patientenalter am Operations- und Verletzungstag betrug 50,7± 9,4 Jahre. (Erstveröffentlichung in Krickl und Zenner et. al 2020). 20 Patienten (66,6%) waren im typischen Erkrankungsalter von 40 bis 60 Jahren. Je fünf Patienten (16,6%) waren jünger als 40 Jahre und älter als 60 Jahre. 14 12 12 10 10 10 8 8 Anzahl 6 5 5 4 4 3 2 1 1 0 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 Alter am Op-/Verletzungstag Alter am Untersuchungstag Abb. 15: Die distale Bizepssehnenruptur in Altersgruppen (Sportklinik Stutt- gart, 2015) n=29 Händigkeit Es wurden 4 (14%) Linkshänder und 25 (86%) Rechtshänder in der Studie untersucht. In 16 Fällen (55%) war der rechte, in 12 Fällen (41%) der linke und in einem Fall waren beide Arme (3%) betroffen. Insgesamt war in 62% die dominante Seite (Erstveröffentlichung in Krickl und Zenner et al. 2020) und in 34,5% die nicht- dominante Seite von der Ruptur betroffen.
ERGEBNIS 27 20 18 18 16 14 12 10 Anzahl 10 8 6 4 2 1 0 dominanter Arm undominanter Arm beide Arme Abb. 16: Von der distalen Bizepssehnenruptur betroffene Seite (Sportklinik Stuttgart, 2015) n=29 Weitere Bizepserkrankungen und Risikofaktoren Zwei Patienten hatten in ihrer Vorgeschichte eine Ruptur der distalen Bizepssehne der gleichen Seite. Ein Patient hatte einen beidseitigen Sehnenabriss. Zur Gewährleistung einer weiterhin ausreichend großen Studienpopulation, wurden die Patienten nicht ausgeschlossen. Zudem gehört die Reruptur der Bizepssehne zu den schweren Komplikationen einer Bizepsehenenruptur. Der entsprechende klinische Outcome nach erneuter Refixierung ist kaum untersucht und deshalb von Interesse. Sonstige relevante Nebenerkrankungen lagen nicht vor. Der Gebrauch von Cortison oder Anabolika wurde von allen Patienten verneint. 16 15 14 12 10 9 Anzahl 8 6 4 4 2 1 0 Raucher Ex-Raucher Gelegenheitsraucher Nichtraucher Abb. 17: Tabakkonsum im Rahmen einer distalen Bizepssehnenruptur (Sportklinik Stuttgart, 2015) n=29
ERGEBNIS 28 Etwa die Hälfte der Patienten konsumierte in unterschiedlichem Maße Nikotin. Im Mittel lag ihr Konsum bei 28,4±22,9 pack years (2 - 68 pack years). Ursache des Sehnenabrisses anderes 2 Drehen 7% 2 7% Heben Abfangen 10 2 33% 7% Sturz 3 10% Sport 4 13% Ziehen 7 23% Abb. 18: Kreisdiagramm zur Abrissursache der Bizepssehenruptur (Sportklinik Stuttgart, 2015) Bei 29 Studienpatienten kam es einmalig zu einer bilateralen Ruptur und somit zu insgesamt 30 Abrissen. Am häufigsten führte das Heben (30%) und Ziehen (27%) eines schweren Gegenstandes oder Sport (13%; Skifahren, Boxen, Fußball) zum Abriss der Bizeps- sehne. Bei dem restlichen Drittel waren u.a. Stürze, Dreh- und Abfangbewegungen ursächlich für die Verletzung. Die zwei Rerupturen der Bizepssehne geschahen jeweils bei einer Bagatellbewegung (Reißverschluss zuziehen, Drehung des Unterarms).
ERGEBNIS 29 Präoperative und postoperative Zeitintervalle Das Intervall präoperativ zwischen Unfall und Operation betrug im Mittel 12,5± 18,5 Tage bei einem Median von 7 Tagen. 100% 17% Anteil der nachuntersuchten 90% 80% 70% 23% Patienten 60% 50% 30% 40% 30% 20% 30% 10% 0% Zeitraum zwischen Sehnenriss und Operation bis 4 Tage bis 7 Tage bis 11 Tage später Abb. 19: Säulendiagramm über die präoperative Zeitdauer einer distalen Bizepssehnenruptur (Sportklinik Stuttgart, 2015) n=29 Insgesamt wurden 60% der Sehnen innerhalb von sieben Tagen, 23% innerhalb elf Tage und die restlichen 17% nach mehr als zwei Wochen operiert (Erstveröffentlichung in Krickl und Zenner et al. 2020). Der Zeitraum zwischen Operation und Nachuntersuchung betrug im Mittel 36±18,7 Monaten (16 - 117 Monate). 26,7% der Bizepssehnen wurden ein bis zwei Jahre, 30% zwei bis drei Jahre, 30% drei bis vier Jahre und 13,3% nach vier Jahren postoperativ untersucht. Die Behandlung im Krankenhaus dauerte zwischen zwei und vier Tage und betrug durchschnittlich 2,6 ±0,7 Tage. Der Entlassungstag wurde, wie in der Berechnung üblich, nicht mitgezählt. 3.2 Kraft Die Untersuchungen erfolgten im Seitenvergleich. Der Messwert des gesunden Arms sollte die ursprüngliche Kraft vor dem Bizepssehnenabriss repräsentieren. Daher wurde der Studienteilnehmer mit beidseitiger Ruptur von diesen Messungen ausgeschlossen.
ERGEBNIS 30 Mit Ausnahme eines Patienten erreichten alle Studienteilnehmer in der körperlichen Untersuchung den Kraftgrad 5, d.h. volle Muskelkraft, in allen Bewegungsachsen. Ein Patient zeigte den Kraftgrad 4 am operierten Arm in der Flexions- und Supinationsbewegung. Kraftmessung der Supination mit einem Dynamometer „Die Kraft des nicht-betroffenen Arms betrug im Mittel 61±13,7 N und die des betroffenen Arms 50,5N±15,5. Mit einem p-Wert von 0,005 war dieser Kraftunterschied signifikant.“ (Erstveröffentlichung in Krickl und Zenner et al. 2020) Betrachtet man die Kraft des gesunden Arms, als die ursprüngliche Kraft des von der Ruptur betroffenen Arms, so wurde mit Hilfe der Operation durchschnittlich 83% der ursprünglichen Kraft zurückerlangt. Fünf Patienten (18%) erreichten ihre ursprüngliche Kraft im Seitenvergleich vollständig zurück (Erstveröffentlichung in Krickl und Zenner et al. 2020). 70 p=0,005 61 60 50,5 Supinationskraft in Newton 50 40 30 20 10 0 nicht-betroffener Arm betroffener Arm Abb. 20: Supinationskraft nach refixierter distaler Bizepssehnenruptur im Seitenvergleich (Sportklinik Stuttgart, 2015) n=29 Basierend auf einer Abbildung aus Springer Obere Extremität „Distale Bizepssehnenrüptür“, Krickl, V., Zenner, J., Huth, J. und Mauch F., Copyright 2020, advance online publication, 19. März 2020 (doi: 10.1007/s11678-019-00552-1 Obere Extrem)
ERGEBNIS 31 3.3 Sport Die Mehrheit der Studienteilnehmer (83%, 24 Patienten) waren in den Wochen vor der Untersuchung sportlich aktiv. Fünf Patienten (17%) betrieben gar keinen Sport. Ihre Angaben zu den folgenden Stichpunkten wurden daher nicht berücksichtigt. 3.3.1 Sportart Es konnten mehrere Sportarten gleichzeitig genannt werden (maximal 3). 18 16 16 14 12 Anzahl 10 8 6 5 5 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 Abb. 21: Übersicht aller postoperativ nach distaler Bizepssehnenruptur ausgeübten Sportarten (Sportklinik Stuttgart, 2015) n=29 Eine Mehrfachnennung verschiedener Sportarten war möglich. Die größten Defizite sind in Sportdisziplinen zu erwarten, welche mit den Armen ausgeübt werden. Sie sind in dieser Studienpopulation gut repräsentiert: 15 von 24 sportlich tätigen Studienteilnehmern (62,5%) nannten eine solche Disziplin. 3.3.2 Aktivitätslevel Die meisten Patienten (15 Patienten, 52%) trieben 1-5 Stunden pro Woche Sport und zeigten somit eine mittlere sportliche Aktivität nach Valderrabano. 21% der Patienten trieben geringfügig Sport. Nur 2 Teilnehmer (7%) waren sportlich gering aktiv. Der Mittelwert des Sportgrades war 1,9±0,9.
ERGEBNIS 32 1 3% 5 6 17% 21% 2 7% 15 52% Grad 0 = keine sportliche Aktivität Grad 1 = geringe sportliche Aktivität (< 1h/Woche) Grad 2 = mittlere sportliche Aktivität (1-5h/Woche) Grad 3 = hohe sportliche Aktivität (>5h/Woche) keine Angabe Abb. 22: Sportlicher Aktivitätsgrad postoperativ nach distaler Bizepssehnenruptur enstprechend der Einteilung von Valderrabano, gemessen an der sportlichen Aktivität in Stunden pro Woche (Sportklinik Stuttgart, 2015) n=29 3.3.3 Rückkehr zum sportlichen Niveau 2 1 8% 4% 7 29% 14 59% Sportfähigkeit wird zu 100% wiedererlangt= Stufe 1 Sportfähigkeit wird > 90% wiedererlangt = Stufe 2 Sportfähigkeit wird > 70% wiedererlangt = Stufe 3 keine Angabe Abb. 23: Rückkehr zur Sportfähigkeit nach Rhee postoperativ nach distaler Bizepssehnenruptur (Sportklinik Stuttgart, 2015) Von 29 Studienpatienten, waren 24 Teilnehmer sportlich aktiv.
ERGEBNIS 33 88 %, d.h. 21 Patienten erreichten mehr als 90% ihres ursprünglichen Niveaus. 59% erreichten die komplette Sportfähigkeit zurück (Erstveröffentlichung in Krickl und Zenner et al. 2020). 16 14 12 10 7 Anzahl 8 6 3 4 7 2 4 0 1 Sportfähigkeit wird zu 100% Sportfähigkeit wird > 90% Sportfähigkeit wird > 90% wiedererlangt = Stufe 1 wiedererlangt = Stufe 2 wiedererlangt = Stufe 2 armbetonte Sportart genannt nur beinbetonte Sportart genannt Abb. 24: Rückkehr zur Sportfähigkeit nach Rhee mit Angabe der Sportart postoperativ nach distaler Bizepssehnenruptur (Sportklinik Stuttgart, 2015) Die Abbildung stellt dar, in welchem Maße 22 von 29 Studienteilnehmern ihre Sportfähigkeit wiedererlangten. Im Mittel hatten die Patienten den Wert 1,4±0,6 in der Sportstufe. Auch Teilnehmer, welche Disziplinen mit Armgebrauch angaben, hatten ein ähnliches Ergebnis. Ihr Mittelwert betrug 1,5±0,7. 2.3.4 Sport-Modul des Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Score Das Ergebnis des DASH-Score befindet sich in Kapitel 3.4.3 auf Seite 36. Im Sportmodul des DASH-Score gaben die Patienten die vordringlich ausgeübte Sportart an und füllten den Fragebogen dann in Bezug dazu aus. Insgesamt füllten 21 Patienten (72%) den Fragebogen korrekt aus.
ERGEBNIS 34 6 5 4 Anzahl 3 5 1 2 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 Sport-DASH = 0 Sport-DASH ≥ 0 Abb. 25: Übersicht der bevorzugten Sportarten mit Sport-DASH-Wertung des Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH)-Score nach distaler Bizepssehnenruptur postoperativ (Sportklinik Stuttgart, 2015) n=29 18 Patienten (86%) konnten ihre bevorzugte Disziplin in gewohnter Art und Weise, ohne Schmerzen, mit gleicher Leistung und in gleichem Umfang wie vor ihrer Verletzung ausüben. Die anderen drei hatten diesbezüglich Einschränkungen. Sie betrieben Sportarten, in denen eine überdurchschnittliche Belastbarkeit und Funktionstüchtigkeit der Arme wichtige Voraussetzung sind. Es erreichte je einer den Wert 18,75 bei Boxen; 31,3 im Fitnesstraining und maximal 37,5 bei Tennis (Insgesamt Mittelwert= 4,2, SD=10,9, Median=0). Je höher das Ergebnis, desto mehr Schwierigkeiten gab es bei der jeweiligen Sportausübung. „Betrachtet man nur die Sportarten, welche auch einen Armgebrauch voraussetzen (wie Fitness, Tennis, Boxen, Schwimmen, Tischtennis, Golf und Handball), so konnten 70 % dieser Patienten ohne Einschränkungen ihren Sport betreiben.“ (Erstveröffentlichung in Krickl und Zenner et al. 2020). Sportarten ohne Armgebrauch sind von einer Bizepssehnenruptur vollständig unbeeinträchtigt.
ERGEBNIS 35 3.4 Alltag 3.4.1 Score von Broberg und Morrey 120 97 100 100 80 Score-Wert 60 40 20 0 betroffener Arm gesunder Arm Abb. 26: Mittelwerte des Broberg und Morrey Score beider Arme postoperativ nach distaler Bizepssehnenruptur (Sportklinik Stuttgart, 2015) n=29 Der Fragebogen, untergliedert in Schmerz, Stabilität, Bewegung und Stärke, bewertet das Operationsergebnis und konnte höchstens 100 Punkte erreichen. Der Broberg und Morrey Score betrug am operierten Arm im Mittel 97±4,7 und am gesunden 100±0 (Werteintervall 84-100). Es gab keinen signifikanten Unterschied (p=0,3) (Erstveröffentlichung in Krickl und Zenner et al. 2020). 9 32% 19 68% sehr gut (95-100 Punkte) gut (80-94 Punkte) Abb. 27: Ergebnis des Broberg und Morrey Score des betroffenen Arms postoperativ nach distaler Bizepssehnenruptur (Sportklinik Stuttgart, 2015) n=29 Somit hatten 68% der Studienteilnehmer ein sehr gutes und 32% ein gutes Ergebnis
ERGEBNIS 36 3.4.2 Mayo Elbow Performance Score Der Score erfasst dauerhafte Schmerzen in Ruhe, den Flexionswinkel, die Ellbogenstabilität und bestimmte alltägliche Fähigkeiten (Haare kämmen, sich ernähren, sich waschen, Shirt anzuziehen, Schuhe anzuziehen). Kein Patient hatte in diesen Bewertungskriterien Einschränkungen, so dass alle Patienten im Mayo Elbow Performance Score am nicht-operierten und operierten Arm den Wert 100 (Mittelwert 100±0) erreichten. Dies ist das bestmögliche Resultat. 3.4.3 Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH)-Score 28 DASH-Fragebögen wurden korrekt bearbeitet und anschließend ausgewertet. 39% der Patienten hatten den Wert Null, 50% Werte von null bis fünf und 11% Werte zwischen 10 und 20 als Ergebnis. Die Ergebnisse lagen zwischen 0 und 17,1. Der Mittelwert betrug 2,81±4,39 (Erstveröffentlichung in Krickl und Zenner et al. 2020). Dash-Wert > 10 3 5 < Dash-Wert ≤ 10 0 0 < Dash-Wert ≤ 5 14 Dash-Wert = 0 11 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Anzahl Abb. 28: Ergebnis des Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH)-Score postoperativ nach distaler Bizepssehnenruptur (Sportklinik Stuttgart, 2015) n=29
Sie können auch lesen