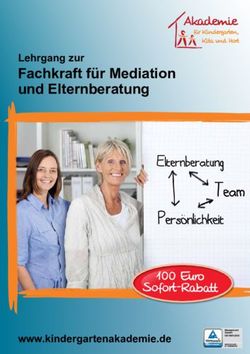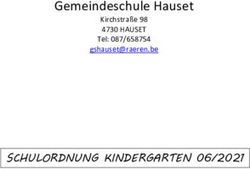Strukturelle Barrieren und Schwellen der Inanspruchnahme
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Strukturelle Barrieren
Nicole Rosenbauer
Strukturelle Barrieren
und Schwellen der
Inanspruchnahme
Risikofaktoren für produktive
Aneignungsprozesse von Hilfen zur Erziehung
Freepik
S
chwellen und Barrieren kön- den jeweils institutionalisierten Relevanzen, den jeweiligen insti-
nen im Rahmen der Inan- und professionalisierten Formen tutionellen Kontexten sowie von
spruchnahme von Hilfen zur der Gewährung und Erbringung situativen Konstellationen abhän-
Erziehung als Risikofaktoren für von Hilfen zur Erziehung entste- gig. Sie ist daher nicht statisch,
produktive Aneignungsprozesse zu hen, die typischerweise produk- sondern notwendigerweise pro-
allen Prozesszeitpunkten wirksam tive Aneignungsprozesse im Sinne zessural und relational. Gleichwohl
sein und werden: vor, am Anfang, eines ‚Gebrauchswerts‘ für junge können sich jenseits der vielschich-
während und bei Beendigung von Menschen und Eltern erschweren, tigen Deutungs- und Wahrneh-
Hilfen zur Erziehung (vgl. Oelerich begrenzen oder verhindern kön- mungsweisen von Adressat*innen
u. a. 2019, S. 6). nen (vgl. ebd., S. 7). Damit spricht andererseits spezifische Aspekte
die Thematik einerseits die Pers- eben durchaus zu strukturell wir-
Die dienstleistungstheoretisch ge- pektive der Adressat*innen und kenden Schwellen und Barrieren
rahmte Nutzerforschung hat die die aus ihrer Sicht erschweren- der Inanspruchnahme verdichten
Frage von Barrieren und Schwel- den oder hinderlichen Aspekte ei- (vgl. ebd., S. II).
len der Inanspruchnahme jüngst ner für sie selbst produktiven An-
wieder aufgegriffen. Unter struk- eignung von Hilfen zur Erziehung
turellen Barrieren der Inanspruch- an. Diese Wahrnehmung der jun- Reflexive Professionalität
nahme werden Aspekte und Me- gen Menschen und Eltern ist von
chanismen verstanden, die aus den den subjektiv-individuellen und Für die Rekonstruktion von struk-
sozialstaatlichen Bedingungen und lebensgeschichtlich-biografischen turellen Barrieren reicht eine An-
13Strukturelle Barrieren
eignungsperspektive nicht aus, sowie die Einhaltung und Umset- geln in stationären Hilfen als deut-
sondern bedeutsam sind zudem zung der je einrichtungsbezoge- lich nicht nachvollziehbar und ge-
die normativ-fachlichen und pro- nen Normen und Regularien. Kin- recht empfindet (vgl. Hartig/Wolff
fessionellen Ansprüche an das Feld der und Jugendliche müssen sich 2008, S. 59).
der Hilfen zur Erziehung, die es zu in Wohngruppen einer Grundbe-
wahren gilt. Das ist auf dingung unterwerfen und anpas-
• Ebene der Adressat*innen, dass sen, die alle Organisationen kenn- Strafen und Belohnen
sie sich als Subjekte des Gesche- zeichnet und für alle Mitglieder gilt:
hens erfahren können und dass die Akzeptanz von Statusfunktio- An den Aspekt ‚Regeln‘ anschlie-
ihre Rechte in der Praxis gewahrt nen und Regeln (vgl. Duschek et al. ßend, kommt dem Komplex ‚Strafen
werden; 2012, S. 7). und Belohnen‘ eine offensichtlich
• professioneller Ebene die Reali- wichtige Funktion für die instituti-
sierung einer reflexiven Profes- Während Studien bis dato durch- onell geforderten Anpassungsleis-
sionalität, die sich materialisiert gängig resümieren, dass sich Kin- tungen zu. Wenn ihre eigene Po-
„in einer spezifischen Qualität der und Jugendliche tendenziell sition von der der Betreuer*innen
sozialpädagogischer Handlungs- eher unsicher und uninformiert abweicht oder sie missliebiges Ver-
praxis, die eine Erhöhung von über ihre Partizipationsrechte in halten an den Tag legen, lernen bis
Handlungsoptionen, Chancenver- der Gruppe zeigen, nehmen Re- zu zwei Drittel der Kinder und Ju-
vielfältigung und die Steigerung geln demgegenüber eine expli- gendlichen auch den Rechte-Entzug
von Partizipations- und Zugangs- zite Orientierungsfunktion in WG als pädagogisches Erziehungsmittel
möglichkeiten aufseiten der Kli- ein: „So berichteten alle Jugendli- im WG-Alltag kennen: Taschen
enten zu Folge hat“ (Dewe/Otto chen über gut sichtbare Regeltafeln geldentzug, Ausschluss von Aktivi-
2001, S. 1400); oder visualisierte Verstärkerpläne täten in der Freizeit, Smartphone-
• struktureller Ebene die Reali- in Form von Punktesystemen, die Entzug oder Aberkennung des
sierung des Subjektstatus von erwünschtes Verhalten belohnen Zugangs zu den Medien und In-
Adressat*innen, von größtmög- und unerwünschtes Verhalten sank- formationsfreiheit, Streichung von
licher Partizipation und der Be- tionieren: „Wer hat dir Fragen be- Besuchskontakten oder Heimfahr-
darfsgerechtigkeit von Hilfen. antworten können, als du in die ten zu ihren Eltern (vgl. Marmier
Gruppe gekommen bist? – Die Er- u. a. 2002, S. 67; Gragert u. a. 2005,
Exemplarisch wird ein Schlaglicht zieher und die Regeltafel. Da vorne S. 3f.).
auf Barrieren und Schwellen der diese Karteikarten, wo die ganzen
Inanspruchnahme von stationä- Regeln hängen“ (Caumanns 2013, Regeln sind im Wesentlichen an
ren Wohngruppen (WG) geworfen, S. 72). Diese Anpassungserforder Organisationszwecken und Funk-
die im Horizont der Anforderungen nisse erscheinen in der Praxis ge- tionserfordernissen ausgerichtet;
dieses Arrangements rekonstruiert meinhin als fraglose Selbstver- sprich: institutionellen Interessen.
werden können. ständlichkeit der Inanspruchnah- Ein korrigierendes Schlüsselele-
me. Wie konflikthaft sich jedoch ment der Ermöglichung von pro-
die Aneignung aus Sicht der Kin- duktiven Aneignungsprozessen von
Gruppe und Regeln der und Jugendlichen darstellen Kindern und Jugendlichen ist ent-
kann, zeigen Ergebnisse von Be- sprechend eine reflexiv-individuelle
Für die Aneignungsprozesse des schwerdeverfahren. In der Stu- Aushandlung über die Bedingun-
Lebensorts stationäre Wohngruppe die ‚Beteiligung leben‘ belegen Be- gen an ihrem Lebensort WG; wie
(WG) durch Kinder und Jugendliche schwerden über das Verhalten von eben insbesondere der Regeln. Und
kommen den Aspekten ‚Gruppe‘ Mitbewohner*innen den 1. Platz das ist auch das Bedürfnis und In-
und ‚Regeln‘ zentrale Bedeutung zu. (mit 56,5 %), gefolgt von Beschwer- teresse von Kindern und Jugend-
Zwei wesentliche Anforderungen den über die Regeln mit 53,5 % auf lichen: Die „Erstellung von Grup-
sind die Akzeptanz der Gruppe als Platz 2 (vgl. Müller u. a. 2016, S. 74). penregeln“ und „Ausgestaltung von
Bestandteil des neuen Lebensorts, Damit dürfte das Ergebnis einer äl- Strafen“ sind zwei Aspekte der Top
das Finden eines Umgangs mit ih- teren Studie weiterhin gelten, wo- 3, in denen sie sich mehr Mitbe-
rer Zusammensetzung, mit Grup- nach ein Drittel der Kinder und Ju- stimmung wünschen (vgl. Müller
penprozessen und -dynamiken; gendlichen die existierenden Re- u. a. 2016, S. 68).
14Strukturelle Barrieren
Elternbeteiligung
Pixelio
Hansbauer/Gies (2016) resümie-
ren ihre Studie im Hinblick auf
die Frage (kollektiver) Partizipation
als eher ernüchternd. Im Übergang
von ambulanter in eine stationäre
Hilfe werde eine beträchtliche Be-
schneidung der elterlichen Ein-
flussmöglichkeiten sichtbar, die
in den allermeisten Fällen schein-
bar selbstverständlich und wohl
auch unreflektiert erfolge (vgl. ebd.
344f.). Es fände eine Umkehrung
der Verhältnisse statt: „Mit der Ver-
lagerung des Lebensortes des Kin-
des verändern sich offenbar über-
gangslos, und ohne dass dies von Triadisches Partizipationsverhältnis
den beteiligten Akteuren ernsthaft
in Frage gestellt wird, die Rollen
zwischen Eltern und Fachkräften Eltern dann häufig en passant (vgl. nächst versuchen, das ‚Erziehungs-
samt ihren Aufgaben und Einfluss- ebd., S. 365). verhältnis‘ zwischen Fachkräften
möglichkeiten“ (ebd., S. 350) „Es und Kind ‚unter Kontrolle‘ zu be-
läge nahe anzunehmen, dass die Im Übergang zu stationären Hil- kommen, d. h. den Kontakt zu den
Fachkräfte das „faktisch noch im- fen sind also auch Eltern gefordert, Eltern anfänglich ganz zu unter-
mer triadische Partizipationsver- sich den institutionell vorgefunde- binden oder ihn stark zu beschrän-
hältnis in ein dyadisches“ umdeu- nen Regeln und Statusfunktionen ken, um ihn dann wieder sukzessive
ten, „um nunmehr in die Rolle der zu unterwerfen. Diese Anpassung zu ermöglichen, wenn sich die El-
Eltern einzutreten“ (ebd., S. 350f.). wird u. a. durch zu Beginn einer Un- tern als ‚kooperationswillig‘ erwei-
terbringung verlangten Phasen von sen. Auf diese Weise wird der El-
De facto entschieden die Fachkräfte Kontakt- und Besuchsverboten ge- tern-Kind-Kontakt zum Gegenstand
über Regularien wie bspw. Kontakt- stützt. Regelwerke von Wohngrup- eines impliziten Belohnungssys-
häufigkeiten und Rahmenbedin- pen mit Vorgaben zu Tagesablauf, tems, durch das Eltern und Kinder
gungen, ohne dass die Eltern ihre Telefon- und Besuchszeiten, Haus- gleichermaßen ‚erzogen‘ werden“
formal noch vorhandenen Kontroll- aufgabenzeiten usw. enthalten zu- (ebd. 2016, S. 359). Das institutio-
rechte zur Geltung bringen könn- dem in der Regel keine einzelfall- nelle Wohngruppensetting führt
ten. Exemplarisch sagt eine Mutter: bezogenen Differenzierungen bspw. dergestalt zu Ausschlussprozessen
„Es wurde im Heim so festgelegt, nach dem rechtlichen Status der El- der Eltern aus dem alltäglichen Er-
dass die Ausgangszeiten so sind. tern (vgl. ebd., S. 351). Die Eltern ziehungsverhältnis zu ihren Kin-
Ich muss das erst einmal so hin- würden zwar bei allen wichtigen dern und adressiert sie gleichzei-
nehmen“ (ebd., S. 356). Fachkräfte Entscheidungen angehört, ihre Be- tig auf der Hinterbühne ebenfalls
nehmen insbesondere Einfluss auf teiligungsstufe gehe „jedoch in den als Objekte einer Erziehung. Von
die Aspekte ‚Kommunikation‘ und seltensten Fällen über die bloße In- Eltern ist gefordert, diese Umkeh-
‚Kontakt‘ zwischen Eltern und Kin- formation hinaus“ (Hansbauer/Gies rung der Verhältnisse und den ih-
dern, wobei die aufgestellten Regu- 2017, S. 234). nen zugewiesenen Status zu ak-
larien kaum Gegenstand von Aus- zeptieren, sich anzupassen und so
handlungsprozessen mit den Eltern ‚mit zu tun‘, dass ihnen die Fach-
oder Gegenstand von Diskussionen Kontrolle über Erziehung kräfte wieder Chancen gegenüber
seien. Regeln und Abläufe perpetu- ihren Kindern eröffnen. Eltern ha-
ierten sich bei fehlendem explizitem Bei aller Varianz zeichne sich ein ben bis dato kaum Zugang zu in-
Widerspruch oder Widerstand der Muster ab, dass „Einrichtungen zu- ternen Beschwerdeverfahren, je-
15Strukturelle Barrieren
tribute“ (Oelerich u. a. 2019) eine
Freepik / pressfoto
produktive Aneignung bzw. diese
provozieren und legitimieren auch
Ausschluss- und Abbruchprozesse
von Hilfen. Solche Attribute sind
Zuschreibungen gegenüber jungen
Menschen als ‚nicht-gruppenfähig‘,
als ‚nicht haltbar‘ oder ‚kooperati-
onsunwillig‘ gegenüber Eltern. Ge-
tragen kann dies sein von einer
verhaltens-, regel- und disziplino-
rientierten pädagogischen Grund-
haltung. Eine solche Grundhal-
tung erzeugt in der Alltagspraxis
in vorhersehbarer Weise Konflikte,
Eskalationsdynamiken und Steige-
rungslogiken immer rigiderer Sank-
tionsdrohungen oder Eingriffe.
Beteiligungsrechte Hohe Alltags-Regulierung und zu-
nehmende Verhaltensauffälligkeiten
von Kindern und Jugendlichen kön-
doch geben die Anliegen, mit denen pationsmöglichkeiten benennen, nen sich in destruktiven Zirkeln ver-
im Sinne einer „Missachtung und
sie sich an die in jüngerer Zeit ent- dichten (vgl. AGJ 2015, S. 8f.); eine
standenen unabhängigen Ombuds- Verwehrung von Beteiligungsrech- hohe Kontroll- und Moralisierungs-
stellen wenden, Hinweise auf kon- ten“ und dem „Ausschluss von El- neigung in einer Einrichtungskultur
flikthafte Aneignungsprozesse. Hier ternrechten“. Hier wirken teilweise korreliert mit der Wahrscheinlich-
thematisieren Eltern bspw. als An- „Inkompetenzunterstellungen ge- keit von Hilfeabbrüchen (vgl. Tor-
liegen „Umgangs-/Besuchskontakte genüber den Adressat*innen“ be- now u. a. 2012, S. 101).
und -regelungen“ sowie „Probleme zogen auf die Realisierbarkeit von
in der Kommunikation mit der Ein- Partizipation (Messmer 2018). Zu
richtung“ (Straus u. a. 2020, S. 44).
betonen und zu berücksichtigen Vertrauen vs. Beschämung
ist jedoch, dass Barrieren nicht
notwendigerweise auf bewusstem Als sehr fragile, aber zentrale
Strukturelle Barrieren und absichtsvollem Handeln von Grundlage für produktive Aneig-
Akteur*innen des Hilfesystems ba- nungsprozesse der Interaktions-
‚Regeln‘ und ‚Gruppe‘ stellen für sieren, sondern diese Risiken sind und Kommunikationsprozesse mit
sich keine Barrieren dar. Ihre Ge- eingelagert in die Grundbedin- der öffentlichen Jugendhilfe er-
staltung müsste in der Praxis da- gungen der Inanspruchnahme von weist sich immer wieder das Ver-
raufhin hinterfragt werden, in - Hilfen und entstehen aus Grund- trauen (BRJ 2018, S. 18ff.). Entwer-
wiefern sie einzelfallbezogen pro- widersprüchen öffentlich institu- tungen der ‚subjektiven Hilfepläne‘
duktive Aneignungsprozesse für tionalisierter Erziehung. Entspre- von jungen Menschen und Eltern
Kinder und Jugendliche sowie El- chend bedeutsam sind als weitere und die Nichtberücksichtigung
tern entweder ermöglichen oder Schwellen oder Barrieren die der individuellen Besonderheit
erschweren und verhindern. Als „Überbewertung institutioneller In- der Adressat*innen sind Aspekte,
strukturelle Barrieren lassen sich teressen“ (Ader 2002) und „institu- durch die Vertrauen als zentrale
auf Basis der empirischen For- tionelle Zwänge“ in Organisations- Ressource in der Praxis und in
schungen vielmehr die „Zuweisung kontexten (Messmer 2018). der Hilfeplanung angegriffen wird.
eines Objektstatus“ (Oelerich u. a. Misstrauen kann zudem entstehen
2019) sowohl mit Blick auf Kinder Im Kontext von Regeln und Regu- durch Prozesse der Beschämung,
und Jugendliche als auch die Eltern larien blockiert schließlich die „Zu- auch durch verletzende, entwürdi-
sowie die Blockierung von Partizi- schreibung stigmatisierender At- gende Kommunikation; durch Ge-
16Strukturelle Barrieren
dort auch bearbeitet bzw. qualifi- ist untrennbar verbunden mit dem
ziert werden können, genutzt wer- Thema ,Macht und Machtverhält-
den, um Weiterentwicklungspro- nisse‘. Für die Existenz und Auf-
zesse im Interesse von produktiven rechterhaltung von Barrieren und
Aneignungsprozessen der Kinder, Schwellen spielen strukturelle
Jugendlichen und Eltern zu initi- Machtasymmetrien eine zentrale
ieren. Alles andere wäre prekär: Rolle. Über die Themen Macht und
Prof. Dr. Nicole Rosenbauer ,Partizipation‘ und ,Passung des Ohnmacht in Erziehungs- und Bil-
Jg. 1975; Studium der Psychologie und Hilfesettings‘ sind zentrale Wirk- dungsfeldern wird jedoch trotz ih-
Erziehungswissenschaften, NLP-Mas faktoren für gelingende Hilfen. Die rer hohen Bedeutung nach wie vor
ter; u. a. wissenschaftliche Mitarbei empfundene Gerechtigkeit von Re- vielfach geschwiegen (vgl. Geiss/
terin am Institut für Sozialpädagogik, geln, die Information und Verfügung Magyar-Haas 2015). Das Thema
Erwachsenenbildung und Pädagogik über Rechte sowie hohe Beteiligung Macht ist nach wie vor weitgehend
der frühen Kindheit an der Universität sind zudem verknüpft mit Selbst- tabuisiert und erzeugt bei Thema-
Dortmund, Berufstätigkeiten u. a. als wirksamkeitserleben und Wohlbe- tisierung Abwehrreaktionen – ins-
Sozialpädagogin in einer betreuten finden junger Menschen am stati- besondere bei den durch sie Privi-
Wohngruppe für junge Menschen mit onären Lebensort (vgl. Hartwig/ legierten (Reher 2018, S. 105).
Essstörungen, selbständige Tätigkeit Wolff 2008). Ausschließungsdyna-
im Bereich Coaching, Wissenschaft miken und Blockaden produktiver Ein erster Schritt auch zum Abbau
und Beratung für Einzelpersonen, Aneignungsprozesse durch profes- von Barrieren und Schwellen wäre
Gruppen und Einrichtungen, seit sionelle und organisationskulturelle entsprechend die Bereitschaft von
2017 Professorin für Wissenschaft der Routinen führen nicht notwendiger- Fachkräften, sich unter dem Fokus
Sozialen Arbeit und Studiengangs weise zu einem Abbruch von Hilfen der ‚Macht‘ der eigenen Praxis zu-
leitung BA Soziale Arbeit an der oder zu wahrnehmbaren Eskalatio- zuwenden, und ein entsprechender
Evangelischen Hochschule Dresden. nen, jedoch ggfs. zur Wahrnehmung Sensibilisierungs- und Reflexions-
der „Inanspruchnahme als Angriff prozess in Einrichtungen, Teams,
auf die eigene Integrität“ (Herzog Supervisionen und der Ausbildung.
ringschätzung von Gutachten oder u. a. 2018, S. 99) und müssten sehr Eine Bewusstwerdung ist auch die
Empfehlungen, die die Perspektive viel radikaler analysiert werden, um erste Voraussetzung, Machtressour-
der Adressat*innen unterstützen Beteiligungsansprüchen und De- cen gezielt einsetzen und auch ab-
oder durch Verweigerung von Ak- mokratisierungsimpulsen deutlich geben bzw. teilen zu können (ebd.,
teneinsicht und fehlende Transpa gerecht(er) zu werden. S. 116). Ein konkreter Schritt weg
renz von Entscheidungsprozessen vom ‚Schweigen‘ in Richtung des
(vgl. BRJ 2018, S. 24ff.). Für den Hansbauer und Gies (2016, S. 343) ‚Sprechens‘ und ‚Hörens‘ der Stim-
Zugang zu adäquaten Unterstüt- verweisen bspw. auf skandinavi- men der Adressat*innen wäre, ih-
zungsleistungen kann schließlich sche Ansätze kollektiver Partizipa- nen Rückmeldungen und Beurtei-
„hochschwelliges Verwaltungshan tion, in denen Eltern zuallererst als lungen zu ihren Aneignungspro-
deln“ als Barriere wirken bspw. Träger*innen von Bürgerrechten be- zessen zu ermöglichen bspw. im
durch die Gestaltung des Umgangs griffen werden mit Anspruch nicht Rahmen von Beschwerdeverfah-
mit (Nicht-)Erreichbarkeiten, War- nur auf Nutzung, sondern auch Ge- ren, und diese Hinweise professi-
tezeiten, mit Antragstellungen und staltung sozialer Dienstleistungen. onell selbstbewusst aufzunehmen
Anträgen oder mit Bearbeitungs- Im professionellen Fokus steht das und für die Qualitäts- und Weiter-
zeiten (BRJ 2018: 13ff.). Ziel von Befähigungsprozessen, die entwicklung innerhalb des eigenen
eigenen elterlichen Rechte ausüben Systems produktiv zu nutzen.
und durchsetzen zu können.
Passung des Hilfesettings
LITERATUR
Im Horizont einer reflexiven Pro- Geteilte Macht
fessionalität kann das Wissen um Ausführliche Literaturliste
Barrieren und um Risikofaktoren, Die Perspektive auf Barrieren und unter www.sp-impulse.at
die im System selbst liegen und Schwellen der Inanspruchnahme
17Sie können auch lesen