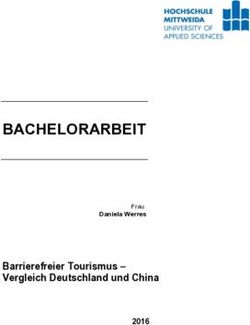Untersuchungen zur Qualität von Informationsangeboten zu Sonnenschutz und Hautkrebsprävention im Internet
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Untersuchungen zur Qualität von
Informationsangeboten zu
Sonnenschutz und Hautkrebsprävention
im Internet
Institut für Medizininformatik, Biometrie und Epidemiologie
(IMBE)
Dissertation
der Medizinischen Fakultät
der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg
zur
Erlangung des Doktorgrades
der Humanmedizin (Dr.med.)
vorgelegt von
Christina Eversbusch
2021Als Dissertation genehmigt
von der Medizinischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Tag/-e der mündlichen Prüfung/-en: 06.08.2021, 15.09.2021, 19.10.2021
Vorsitzender des Promotionsorgans: Prof. Dr. med. Markus Neurath
Gutachter/in:
1. Prof. Dr. Wolfgang Uter, Professur für Epidemiologie
2. Prof. Dr. Annette Pfahlberg, Lehrstuhl für Biometrie und Epidemiologie
2Inhaltsverzeichnis
Zusammenfassung ..................................................................................................... 5
Abstract ....................................................................................................................... 6
1. Einleitung ................................................................................................................ 7
1.1 Malignes Melanom – Epidemiologie .................................................................... 7
1.2 Malignes Melanom – Krankheitsbild und Verlauf ................................................. 8
1.3 NMSC – Epidemiologie ....................................................................................... 9
1.4 NMSC – Krankheitsbild und Verlauf .................................................................. 10
1.4.1 Basalzellkarzinom ....................................................................................... 10
1.4.2 Plattenepithelkarzinom ................................................................................ 10
1.5 Risikofaktoren ................................................................................................... 11
1.6 Hintergrund und Ziel der Dissertation ................................................................ 14
2. Methoden............................................................................................................... 16
2.1 Vorstudie ........................................................................................................... 16
2.2 Suchanfragen .................................................................................................... 17
2.3 Inhaltliche Kriterien ............................................................................................ 18
2.4 DISCERN .......................................................................................................... 20
2.5 HONcode .......................................................................................................... 20
2.6 Ergebnisdarstellung........................................................................................... 21
3. Ergebnisse ............................................................................................................ 23
3.1 „Hautkrebs Sonnenschutz“ (A) .......................................................................... 23
3.1.1 Inhaltliche Kriterien ..................................................................................... 23
3.1.2 DISCERN ................................................................................................... 32
3.1.3 HONcode .................................................................................................... 34
3.1.4 Vergleich der Instrumente ........................................................................... 36
3.1.4.1 Korrelation zwischen DISCERN und HONcode .................................... 36
3.1.4.2 Korrelation zwischen DISCERN und Inhalt ........................................... 36
3.1.4.3 Korrelation zwischen Inhalt und HONcode ........................................... 36
3.1.4.4 Korrelation zwischen Inhalt und Rang (Reihenfolge in der Trefferliste) . 37
3.2 „Wie schützt man sich vor Sonne?“ (B) ............................................................. 42
3.2.1 Inhaltliche Kriterien ..................................................................................... 42
3.2.2 DISCERN ................................................................................................... 46
3.2.3 HONcode .................................................................................................... 47
3.2.4 Vergleich der Instrumente ........................................................................... 50
3.2.4.1 Korrelation zwischen DISCERN und HONcode .................................... 50
3.2.4.2 Korrelation zwischen DISCERN und Inhalt ........................................... 50
3.2.4.3 Korrelation zwischen Inhalt und HONcode ........................................... 50
33.2.4.4 Korrelation zwischen Inhalt und Rang (Reihenfolge in der Trefferliste) . 50
3.3 „Sonnenschutz Kinder“ (C) ................................................................................ 52
3.3.1 Inhaltliche Kriterien ..................................................................................... 52
3.3.2 DISCERN ................................................................................................... 55
3.3.3 HONcode .................................................................................................... 56
3.3.4 Vergleich der Instrumente ........................................................................... 60
3.3.4.1 Korrelation zwischen DISCERN und HONcode .................................... 60
3.3.4.2 Korrelation zwischen DISCERN und Inhalt ........................................... 60
3.3.4.3 Korrelation zwischen Inhalt und HONcode ........................................... 60
3.3.4.4 Korrelation zwischen Inhalt und Rang (Reihenfolge in der Trefferliste) . 60
3.4 „Sonnenbrand vorbeugen“ (D) ........................................................................... 62
3.4.1 Inhaltliche Kriterien ..................................................................................... 62
3.4.2 DISCERN ................................................................................................... 65
3.4.3 HONcode .................................................................................................... 68
3.4.4 Vergleich der Instrumente ........................................................................... 69
3.4.4.1 Korrelation zwischen DISCERN und HONcode .................................... 69
3.4.4.2 Korrelation zwischen DISCERN und Inhalt ........................................... 69
3.4.4.3 Korrelation zwischen Inhalt und HONcode ........................................... 69
3.4.4.4 Korrelation zwischen Inhalt und Rang (Reihenfolge in der Trefferliste) . 69
3.5 Vergleich der Suchanfragen .............................................................................. 71
4. Diskussion ............................................................................................................ 74
4.1 Das Internet und COVID-19 .............................................................................. 77
5. Literaturverzeichnis .............................................................................................. 78
6. Abkürzungsverzeichnis ........................................................................................ 81
7. Tabellenverzeichnis .............................................................................................. 82
8. Abbildungsverzeichnis ......................................................................................... 83
Danksagung .............................................................................................................. 86
4Zusammenfassung
Hintergrund: Hautkrebs gehört auch heute noch zu einer der häufigsten
Krebsneuerkrankungen in Deutschland. Die Präventionsmöglichkeiten sind zahlreich und
können evidenzbasiert zu einer Risikoreduktion des malignen Melanoms und der nicht-
melanozytären Hautkrebsformen führen. Dennoch ist das Wissen der deutschsprachigen
Bevölkerung, die sich im Internet informiert, bezüglich dieser Prävention nicht gut. Das Ziel
dieser Untersuchung war es, die Qualität der von Internetnutzern gelesenen Webseiten zum
Thema Sonnenschutz und Hautkrebsprävention inhaltlich und generisch-methodisch zu
bewerten.
Methoden: Es wurden vier unterschiedliche GoogleTM basierte Suchanfragen durchgeführt, von
denen jeweils die ersten 200 Treffer identifiziert und anschließend inhaltlich und generisch
analysiert wurden. Die inhaltlichen Kriterien wurden der aktuellen S3-Leitlinie zur Prävention
von Hautkrebs entnommen. Zur Prüfung der Allgemeingültigkeit und Vollständigkeit wurden
zwei generische Instrumente ausgewählt, das DISCERN-Instrument und die HONcode-
Kriterien. Die erste Suchanfrage wurde doppelt und gegenseitig verblindet erfasst, um eine
Reproduzierbarkeit der Ergebnisse zu schätzen. Ein Experte (W.U.) bearbeitete neben der
Autorin der Arbeit (C.E.) den Inhalt und den HONcode, während ein „Laie“ (P.E.) die DISCERN-
Kriterien zusätzlich beurteilte.
Ergebnisse: Von allen vier Anfragen war der Anteil der verwertbaren Internetseiten nie größer
als 64%. Inhaltlich wurden größtenteils geringe Punktzahlen von den möglichen 47 Punkten
erzielt. Der Median betrug bei Suche A 11 Punkte, bei B 10 Punkte, bei C und bei Suche D 9
Punkte. Die Bewertung der generischen Instrumente befand sich bei allen vier Suchanfragen im
mittleren Punktbereich. Die DISCERN-Kriterien wurden überwiegend mit 24 von 40 Punkten
bewertet und die HONcode-Kriterien mit 20 von 40 Punkten. Drei der vier Suchanfragen zeigten
eine negative Korrelation zwischen dem Rang einer Internetseite und ihrem inhaltlichen Score,
je weiter hinten in der Trefferliste die jeweilige Seite also stand, desto schlechter war ihr
inhaltlicher Score und desto qualitativ schlechtere Informationen wurden vermittelt. Die
inhaltliche Korrelation zwischen C.E. und W.U., quantifiziert mittels Pearson
Korrelationskoeffizienten, betrug 0,8.
Schlussfolgerung: Online zur freien Verfügung stehende Informationen entsprechen
mehrheitlich nicht dem vollständigen Wissen der S3-Leitlinie und den Anforderungen der
generischen Instrumente, DISCERN und HONcode. Patienten sowie alle Nicht-Mediziner, die
sich mithilfe des Internets Kenntnisse aneignen, erlangen somit gehäuft eine fehlerhafte
Vorstellung von Hautkrebsprävention und Sonnenschutz. Da das Internet jedoch weiterhin
einen großen und weiterhin zunehmenden Teil der Bezugsquellen von Informationen darstellt,
sollte das gezielte und richtige Suchen nach korrekten Auskünften verbessert und die
Bevölkerung darüber aufgeklärt werden, welche Seiten seriöser Herkunft sind und sich zur
Vermittlung medizinischen Wissens eignen.
5Abstract
Background: Today, skin cancer is still one of the cancers with the highest incidence in
Germany. There are many possibilities of prevention, based on strong evidence, which can
reduce the risk of malignant melanoma or non-melanoma skin cancer. However, still there is a
lack of knowledge regarding prevention within the German population, who are using the
Internet to obtain information. The aim of this study was to evaluate the quality of skin cancer
and sun protection online resources, based on both their specific content and generic
properties.
Methods: Four web searches with the search engine GoogleTM were performed and the top 200
websites were identified and analysed concercing content and generic aspects. The content
criteria were based on the current S3-guideline for skin cancer prevention. Two generic
instruments were chosen to check the completeness and general validity, namely the
DISCERN-instrument and the HONcode-criteria (Health on the Net). The first search was
assessed by two independent evaluators to achieve reproducibility, one expert (W.U.) for the
content and HONcode and one layman (P.E.) for the DISCERN-criteria, who evaluated in
addition to the author of this study (C.E.).
Results: The percentage of useful websites never exceeded 64%. With 47 maximum
achievable points, most of the rated pages got a low content-based score. The median of
search A was 11 points, of search B 10 points and of search C and D 9 points. The evaluation
of the generic instruments yielded an average score for each of the four web searches. The
DISCERN-criteria mostly got 24 of 40 possible points, while the HONcode-criteria only got 20 of
40 possible points. Three of the four web searches showed a negative correlation between the
rank of a website and its content score, the higher the rank of the website the lower was the
content score and the quality of the information. The content-wise Pearson correlation
coefficient between C.E. and W.U. regarding content scores was 0.8
Conclusion: Most of the available online skin cancer resources do fall short of the evidence
compiled in the S3-guideline for skin cancer prevention and the requirements of the generic
instruments (DISCERN and HONcode), respectively. Patients and non-medical people who
search the internet thus get limited, partly false, information on skin cancer prevention and sun
protection. As patients still use the internet as a primary source for health information, the
correctness of references has to be improved and reliability of medical information be certified
for the assurance of the public.
61. Einleitung
1.1 Malignes Melanom – Epidemiologie
Hautkrebs ist in Deutschland keine Seltenheit. Noch immer ist z.B. das maligne
Melanom die fünft-häufigste Krebsneuerkrankung bei Männern und Frauen (siehe
Abbildung 1). Laut Robert-Koch-Institut erkrankten 2012 in Deutschland etwa 20.800
Menschen am malignen Melanom, Männer im Mittel mit 67 Jahren und Frauen mit 59
Jahren. [1] Da jedoch 2008 die Früherkennung von Hautkrebs in Form eines
Hautkrebsscreenings für Personen ab dem 35. Lebensjahr eingeführt worden ist,
werden mittlerweile zwei Drittel aller Tumoren in sehr frühen Stadien (T1) entdeckt. Die
dadurch rapide ansteigende Inzidenz (siehe Abb.2) ermöglicht eine frühere Therapie,
ein längeres Überleben und somit eine hohe 5-Jahres-Überlebensrate. 2012 betrug
diese bei Frauen 94% und bei Männern 91%. Dennoch sterben jährlich ca. 3000
Menschen an den Folgen des malignen Melanoms. [1]
Abbildung 1 Prozentualer Anteil der häufigsten Tumorlokalisationen an allen
Krebsneuerkrankungen in Deutschland 2012 (ohne nicht-melanozytären Hautkrebs) [1]
7Abbildung 2 Absolute Zahl der Neuerkrankungs- und Sterbefälle, nach Geschlecht, ICD-10 C43
(=bösartiges Melanom der Haut), Deutschland 1999-2012 [1]
1.2 Malignes Melanom – Krankheitsbild und Verlauf
Das maligne Melanom („schwarzer Hautkrebs“) ist die am häufigsten tödlich
verlaufende Hauterkrankung. [2] Es handelt sich um einen malignen Tumor, der von
den Melanozyten ausgeht und metastasieren kann. 90% aller Melanome sind auf der
Haut zu finden, 10% an Schleimhäuten, am Auge, im zentralen Nervensystem oder an
inneren Organen. [3]
Das Aussehen kann sehr stark variieren. Oftmals handelt es sich um asymmetrische,
unregelmäßig geformte und begrenzte, sowie inhomogen gefärbte Plaques oder
Knoten, die sowohl erodiert als auch ulzeriert, krustig belegt oder blutend sein können.
[3]
Es werden vier Typen unterschieden, die sich in Aussehen, Wachstum und Therapie
differenzieren:
- Das superfiziell spreitende Melanom ist häufig am Stamm lokalisiert und die
häufigste Variante des malignen Melanoms. Es ist morphologisch sehr vielfältig
und wächst sehr schnell in horizontaler Richtung.
- Das noduläre Melanom ist die aggressivste Wachstumsform, da es sehr schnell
infiltrierend („vertikal“) wächst. Oft ist es ein Knoten von einigen Zentimetern
8Größe mit einer bräunlich-schwarzen Färbung, der eine hohe Blutungsneigung
aufweist. Nekrosen sind nicht selten.
- Das Lentigo-maligna-Melanom findet sich vorwiegend in sonnenexponierten
Regionen. Es handelt sich um einen großen nicht-tastbaren Fleck mit scheckiger
Farbe und unregelmäßiger, scharfer Begrenzung
- Das akral-lentiginöse Melanom entsteht an den Akren (Hände, Füße) und
erscheint als dunkelbraun bis schwarzer Fleck, der sich auch in der Nagelmatrix
manifestieren kann. [2]
Kommt es zu einer Metastasierung, kann diese sowohl lymphogen als auch
hämatogen erfolgen: Kutane Metastasen entstehen meist durch lymphogene Streuung,
während subkutane durch jegliche Aussaat hervorgerufen werden können. Die
Metastasen finden sich vorwiegend in der Haut und Subkutis, können jedoch auch in
Lymphknoten oder als Fernmetastasen in anderen Organen wie in Lunge, Leber, ZNS,
Nieren, Nebennieren, Knochen u.a. auftreten. Da die Metastasierung bei
fortgeschrittenen Tumorstadien sehr schnell auftritt, erliegen viele Patienten den
Folgen des malignen Melanoms.
Die frühere Diagnostik durch das Hautkrebsscreening der gesetzlichen Krankenkassen
hat die Prognose jedoch drastisch verbessert, da eine rechtzeitigere Exzision als
kurative Therapie häufiger möglich ist. [2]
1.3 NMSC – Epidemiologie
An den Folgen der nicht-melanozytären Hautkrebsformen („non-melanoma skin
cancer“, NMSC), die auch mit dem Überbegriff „weißer Hautkrebs“ betitelt werden,
starben im Jahr 2012 in Deutschland - verglichen mit dem malignen Melanom - nur 688
Menschen bei einer gesamten Inzidenz von 206.500. Von diesen Neuerkrankungen
waren 159.200 Basaliome und 44.300 Plattenepithelkarzinome [1]. Sie treten häufiger
auf, sind jedoch nicht so maligne wie das Melanom. Die häufigsten Formen des weißen
Hautkrebses sind die oben genannten Formen, das Basaliom und das
Plattenepithelkarzinom. Beide besitzen eine eher positive Prognose, können aber in
seltenen Fällen auch metastasieren. Im Gegensatz zum malignen Melanom erkranken
eher Personen im höheren Lebensalter an diesen Hautkrebsformen; das
durchschnittliche Erkrankungsalter liegt sowohl bei Männern als auch bei Frauen bei
ca. 70 Jahren. [1]
91.4 NMSC – Krankheitsbild und Verlauf
1.4.1 Basalzellkarzinom
Der häufigste Hauttumor ist das Basaliom (Basalzellkarzinom, BZK), eine maligne
Neoplasie der follikulären Stammzellen, die nur an Haarfollikel-tragenden
Körperregionen auftritt. Dadurch erklärt sich das bevorzugte Vorkommen im
Kopfbereich mit bis zu 90%. Symptomatisch zeigt sich eine glatte, prall wirkende
Papel, auch Basaliomknötchen genannt, mit umgebenden Teleangiektasien. Das
Wachstum ist sehr langsam, wodurch es über einen längeren Zeitraum auch zur
Atrophie des Zentrums kommen kann. [2] Morphologisch existiert eine große
Bandbreite an Basalzellkarzinom-Formen, weshalb eine Unterscheidung anhand von
Wachstum und Pigmentierung und eine Klassifizierung in vier Typen erfolgt:
- Das noduläre BZK ist die häufigste Form und tritt vor allem in UV-exponierten
Regionen auf. Zunächst als kleine, scharf begrenzte und breitbasige Papel mit
derber Konsistenz und Teleangiektasien kann sie bei längerem Wachstum
schließlich zu Ulzerationen und tiefen Infiltrationen führen.
- Das pigmentierte BZK entspricht klinisch dem nodulären BZK, ist jedoch
aufgrund seiner erhöhten Melanineinlagerung oft differentialdiagnostisch
schwierig vom malignen Melanom zu unterscheiden.
- Das superfizielle (oberflächliche) BZK tritt häufig am Rumpf auf. Es ist
unregelmäßig begrenzt, rötlich bis bräunlich und sehr flach, ähnelt
morphologisch einem Ekzem oder einem Morbus Bowen, jedoch treten bei
diesem Erscheinungstyp keine Ulzerationen auf.
- Das sklerodermiforme BZK ähnelt einer derben Narbe, weshalb es häufig
übersehen wird. Es neigt zu einer schnellen Infiltration tiefer gelegener
Strukturen. [4]
Die Gefahr des Basalioms besteht in der Infiltration, die bei fehlender Therapie zu
Ulzera und Arrosionen großer Gefäße führen kann, welche unter Umständen zum Tod
führen. [2]
1.4.2 Plattenepithelkarzinom
Das Plattenepithelkarzinom (PEK) ist mit einer Inzidenz von 44.300 der zweithäufigste
Hauttumor. [1] Es handelt sich um eine maligne Neoplasie der Epidermis, die meist im
Kopf-Hals-Bereich, sowie in der Genital- und Anusregion auftreten kann und in erster
Linie aus In-situ-Karzinomen, vor allem aktinischen Keratosen entsteht. [2, 3]
10Die aktinische Keratose tritt als schwache Rötung mit scharfer Begrenzung und
Schuppung auf. Im Verlauf bildet sich eine starke Hyperkeratose bis hin zu einem
Cornu cutaneum, einer gelblich-braunen und festen Verhornung. Dieses tritt häufig als
Ursprungsort eines Plattenepithelkarzinoms auf, welches durch sein schnelles
Wachstum gekennzeichnet ist.
Kommt es wie in seltenen Fällen tatsächlich zu einer Metastasierung, so erfolgt diese
lymphogen mit Befall der regionären Lymphknoten und Infiltration benachbarter
Strukturen. Die Diagnose ist histologisch zu sichern. Eine komplette Exzision ist der
Goldstandard - in bestimmten Fällen ist allerdings auch eine zusätzliche Radiotherapie
empfehlenswert. [2]
Auf weitere maligne Hauttumoren wie bspw. das Merkelzellkarzinom wird an dieser
Stelle nicht weiter eingegangen.
1.5 Risikofaktoren
Das Risiko an Hautkrebs zu erkranken ist von unterschiedlichen Faktoren abhängig. Im
Folgenden werden die Risikofaktoren für das Basaliom und das Plattenepithelkarzinom
gemeinsam unter dem Überbegriff des nicht-melanozytären Hautkrebses genannt.
Zunächst muss zwischen endogenen und exogenen Risikofaktoren unterschieden
werden.
Einer der wichtigsten endogenen Risikofaktoren ist der Hauttyp. Er ist sowohl für den
NMSC als auch für das maligne Melanom ein entscheidendes Element und lässt sich
anhand von einigen phänotypischen Merkmalen bestimmen (siehe Tabelle 1). In zwei
Studien wurde von Gallagher et al. gezeigt, dass das Risiko für ein BZK bei Hauttyp I
und II im Vergleich zu Hauttyp IV mit einer Odds Ratio (OR) von 5,1 (95%
Konfidenzintervall [KI]: 1,4-11,3) bzw. 5,3 (95% KI: 1,7-10,6) stark erhöht ist. Das
Auftreten eines PEK bei Hauttyp I oder II wird mit einer OR von 1,4 (95% KI: 0,5-3,0)
und 2,2 (95% KI: 0,7-3,8) ebenfalls begünstigt. [5, 6] Das Risiko eines malignen
Melanoms steigt bei Personen mit dem Hauttyp I, II oder III signifikant an: Das relative
Risiko (RR) im Vergleich zu Hauttyp IV liegt für den Hauttyp I bei 2,09 (95% KI: 1,67-
2,58), für II bei 1,87 (95% KI: 1,43-2,36) und für III bei 1,77 (95% KI: 1,23-2,56). [7]
Ein weiterer für das maligne Melanom wichtiger Risikofaktor ist das Auftreten von
kongenitalen melanozytären Nävi. Die bei der Geburt vorhandenen („kongenitalen“)
Nävi weisen ein Risiko der malignen Entartung auf, das mit steigender Größe wächst.
So ist das Risiko bei sog. „Riesennävi“, welche einen Durchmesser von >40 cm haben
erhöht. [8-10] In einer prospektiven Studie von Kinsler et al. wurde gezeigt, dass bei
11Patienten mit kongenitalen melanozytären Nävi (KMN) mit einer adulten Größe von
>60cm das Risiko eines malignen Melanoms 14% betrug, in der gesamten Kohorte von
Patienten mit Nävi jeglicher Größe lag das Gesamtrisiko bei 1,4%. [9]
Tabelle 1 – Hauttypen nach Fitzpatrick [4, 11]
Hauttyp I II III IV V VI
Beschreibung
Natürliche Hautfarbe: sehr hell hell hell bis Hellbraun, dunkel- dunkel-
hellbraun oliv braun braun bis
schwarz
Sommersprossen/ sehr häufig selten keine keine keine
Sonnenbrandflecken: häufig
Natürliche Haarfarbe: rötlich bis blond bis dunkel- dunkel- dunkel- schwarz
rötlich- braun blond bis braun braun bis
blond braun schwarz
Augenfarbe: blau, blau, grau, braun bis dunkel- dunkel-
grau grün, braun dunkel- braun braun
grau, braun
braun
Reaktion auf die Sonne
Sonnenbrand: Immer, fast selten bis selten sehr extrem
schmerz- immer, mäßig selten selten
haft schmerz-
haft
Bräunung: keine kaum bis fort- Schnell, keine keine
mäßige schreitend tief
Die exogenen Risikofaktoren von Hautkrebs, die im Laufe des Lebens erworben
werden, also nicht zu den konstitutionellen Faktoren gezählt werden können, sind bei
den nicht-melanozytären Hautkrebsformen:
- die aktinische Keratose
- der NMSC in der Eigenanamnese
- die Immunsuppression
- der Röntgenkombinationsschaden [4]
Die aktinische Keratose ist einer der Hauptrisikofaktoren für das PEK und bildet die
Basis für das schnelle Wachstum des Karzinoms (s.o.). Treten über einen 10-
Jahresabschnitt multiple aktinische Keratosen auf, so liegt das Lebenszeitrisiko eines
PEKs bei 6-10%. [2, 3, 12] Die Gefahr des Auftretens eines BZKs oder PEKs ist
deutlich erhöht bei nicht-melanozytärem Hautkrebs in der Vorgeschichte. Eine erneute
Erkrankung in den nächsten fünf Jahren bei einem PEK in der Eigenanamnese tritt mit
30% Wahrscheinlichkeit für ein PEK und mit 40% für ein BZK auf. Bei einem BZK in
der Vorgeschichte liegt die Wahrscheinlichkeit eines PEKs innerhalb von 3 Jahren bei
ca. 6%, während ein weiteres BZK mit einer Häufigkeit von 44% deutlich öfter auftritt.
[13] Durch immunsuppressiv wirkende Medikamente wird ein Karzinom ebenfalls
12begünstigt mit einem deutlich erhöhten Risiko bei Organtransplantations-Patienten,
alleine PEK entstehen bis zu 65-mal häufiger nach einer Transplantation. [14-20]
Ein Röntgenkombinationsschaden (chronic radiation keratosis) ist eine keratotische
Hautläsion, die nach jahrelanger Exposition der Haut mit ionisierender Strahlung oder
radioaktivem Material auftreten kann. Dies ist besonders häufig bei Strahlentherapie-
Patienten oder klinischem Personal zu sehen. Die Läsion bildet die Grundlage für die
Entstehung eines PEKs oder BZKs, bei andauernder ionisierender Strahlung kommt es
jedoch häufiger zur Bildung eines Basalzellkarzinoms und weniger der eines
Plattenepithelkarzinoms. [21, 22]
Die erworbenen Risikofaktoren für das maligne Melanom sind:
- das maligne Melanom in der Eigenanamnese
- das maligne Melanom in der Familienanamnese
- die Anzahl erworbener Nävi
- die klinisch atypischen Pigmentmale
Das wiederholte Auftreten eines malignen Melanoms ist nach einer Erkrankung in der
Eigenanamnese deutlich erhöht mit einem RR von 8,5. Im Vergleich dazu liegt das RR
nur bei 2,2 bei einem Verwandten 1. Grades mit einem malignen Melanom. [23-25]
Man geht davon aus, dass das maligne Melanom dazu neigt, autosomal-dominant
vererbt zu werden, da häufig eine familiäre Disposition festzustellen ist und in 5-12%
der Fälle die Patienten Verwandte 1.Grades haben, die ebenfalls an Hautkrebs
erkrankt sind. [26-29]
Das Vorkommen multipler erworbener melanozytärer Nävi geht mit einem erhöhten
Risiko eines malignen Melanoms einher. Sie entstehen durch das Einwirken von UV-
Licht, Sexualhormonen und genetischer Disposition, doch nur 20% der Melanome
entwickeln sich aus erworbenen Nävi. [2] Das RR für das maligne Melanom liegt z.B.
bei einer Anzahl von 101-120 erworbenen Nävi bei 6,89 (95% KI: 4,63-10,25) im
Vergleich zu einer Anzahl < 15. Bei atypischen Nävi, die sich durch unscharfe und
unregelmäßige Begrenzung, Farbe und Lokalisation definieren, reicht bereits eine sehr
geringe Anzahl für das erhöhte Risiko eines malignen Melanoms. Schon bei fünf
atypischen Nävi liegt das RR bei 6,36 (95% KI: 3,80-10,33) in Relation zu nicht
vorhandenen atypischen Nävi. [7, 30, 31]
Der wichtigste Risikofaktor für Hautkrebs ist jedoch die UV-Exposition. [32] Dabei muss
man allerdings zwischen Expositions-Mustern unterscheiden, die für die
unterschiedlichen Hautkrebsarten mehr oder weniger spezifisch sind. Armstrong et al.
stellten 2001 heraus, dass das Basalzellkarzinom vor allem mit Sonnenbränden bei
einem RR von 1,40 (95% KI: 1,29-1,51) und intermittierender Exposition bei einem RR
13von 1,38 (95% KI:1,24-1,54) assoziiert ist. Bei beruflicher Exposition steigt das Risiko
hingegen nur geringfügiger an (RR: 1,19 [95% KI: 1,07-1,32]).
Das Risiko an einem Plattenepithelkarzinom zu erkranken sinkt sogar durch
intermittierende Exposition (RR: 0,91 [95% KI: 0,68-1,22]) und steigt stärker durch
beruflich-bedingte, eher chronische Exposition (RR: 1,64 [95% KI: 1,26-2,13]) als durch
Sonnenbrände (RR: 1,23 [95% KI: 0,90-1,69]). Das Risiko eines malignen Melanoms
sinkt durch berufliche UV-Exposition (RR: 0,86 [95% KI: 0,77-0,96]), steigt jedoch sehr
stark durch nicht-berufliche Exposition (RR: 1,71 [95% KI: 1,54-1,90]) und
Sonnenbrände (RR: 1,91 [95% KI: 1,69-2,17]). Diese relativen Risiken wurden jeweils
im Vergleich zu einer Kontrollgruppe mit möglichst niedriger Exposition berechnet. [33]
In einer gepoolten Meta-Analyse von Gandini et al. wurden die relativen Risiken für die
unterschiedlichen Expositionsmuster in Bezug auf das maligne Melanom angegeben
und erneut zeigte sich eine deutliche Assoziation mit intermittierender Exposition,
sowie mit Sonnenbränden. [31]
Zusätzlich zur natürlichen UV-Strahlung muss auch die mittlerweile immer häufiger
gewordene künstliche UV-Exposition in Sonnenstudios und Solarien ihre
Berücksichtigung finden. Die International Agency for Research on Cancer (IARC)
zeigte in einer Meta-Analyse, dass Personen, die vor ihrem 35. Lebensjahr mindestens
einmal pro Monat das Solarium aufsuchen ein um 75% erhöhtes Risiko hatten in ihrem
späteren Leben an einem malignen Melanom zu erkranken. [34] Deshalb wurde neben
der natürlichen auch die künstliche UV-Strahlung im Jahr 2009 in die Gruppe-1-
Karzinogene eingestuft. [35] Diese expositionsbedingten Risikofaktoren gilt es zu
vermeiden, um die Gefahr eines späteren Hautkrebses zu minimieren. Die dafür
erforderliche primäre Prävention spielt hierbei den Schlüssel für das Verhindern
schwerwiegender Hautschäden. Sie zielt darauf ab die Exposition auf ein Minimum zu
reduzieren, da jegliche Sonneneinstrahlung eine Gefahr für die Haut darstellen kann.
1.6 Hintergrund und Ziel der Dissertation
Wie bekannt sind der deutschen Bevölkerung die Möglichkeiten der Prävention? In
einer von Uter et al. publizierten Analyse des Wissensstandes in Bezug auf Hautkrebs
bei Eltern von 3- bis 6-jährigen Kindern wurde festgestellt, dass der Großteil der
Erwachsenen Informationen aus Print-Medien sowie aus audio-visuellen-persönlichen
Medien bezieht, das Internet jedoch trotz seiner immer weiter steigenden Popularität
seltener genutzt wird. Die Ergebnisse zeigten, dass persönliche Beratungen und auch
das Lesen bestimmter Informationsmaterialien und Printmedien mit gutem
Schutzverhalten und des Weiteren ausgezeichnetem Wissen assoziiert sind. Dem
gegenüber ist die Nutzung des Internets im Vergleich mit der völligen Nicht-Nutzung
14von Informationsquellen sogar negativ mit adäquatem Verhalten assoziiert. [36] In der
heutigen Gesellschaft, in der beinahe alles über das Internet durchgeführt wird und so
gut wie jedem ein Internetzugang zur Verfügung steht, erschrecken solche Ergebnisse.
Sie lassen die Vermutung zu, dass eine Verbreitung falschen Wissens durch das
Internet erfolgt, erleichtert durch die globale Vernetzung, während Printmedien durch
stetige redaktionelle Kontrollen eher ihren inhaltlichen Wert erhalten konnten.
In der Vergangenheit wurden bereits mehrere gesundheitsbezogene Internetseiten
analysiert, wobei durchgängig eine starke Variation oder sogar eine sehr schlechte
Qualität von Inhalt und Allgemeingültigkeit dokumentiert wurde. [37, 38] Bisherige
Analysen bezogen sich immer auf themenspezifische Seiten, wie etwa zur Periodontitis
oder Otitis media, jedoch nicht auf die Prävention von Hautkrebs.
Dadurch ergab sich die Forschungsfrage, ob die Qualität der frei zugänglichen
Informationen bezüglich Hautkrebsprävention im Internet für die geringe Kenntnis und
das falsche Verhalten der Nutzer verantwortlich gemacht werden kann, die in der
Studie von Uter et al. festgestellt wurde. Weiterhin stellt sich die Frage, ob die
Informationsvielfalt in ihrer Gesamtheit Nicht-Medizinern, einschließlich eventuellen
Patienten, bei der Beantwortung ihrer Fragen überhaupt mit korrekten Antworten helfen
kann. Diese Qualität soll in dieser Arbeit erfasst und quantifiziert werden, sodass
mögliche Verbesserungsvorschläge und Hilfestellungen für die richtige Suche im
Internet gegeben werden können. Bevor jedoch eine Aussage über die Qualität und
das Vermitteln korrekter Präventionsmaßnahmen getroffen werden konnte, musste
eine geeignete Methode zur Erfassung gefunden und ausgearbeitet werden.
152. Methoden
2.1 Vorstudie
Da jede Suche im Internet mit einer bestimmten Suchmaschine beginnt, welche die
Ergebnisse für weitere Recherchen liefert, fiel die Wahl auf die am häufigsten benutzte
Suchmaschine in Deutschland: GoogleTM, welche mit einem Marktanteil von knapp
95% die geplanten Suchanfragen dadurch realitätsnah umsetzen ließ. [39, 40] Die
erhaltenen Ergebnisse sollten anhand von unterschiedlichen Instrumenten mit Punkten
bewertet werden. Um die Allgemeingültigkeit und Vollständigkeit einer Internetseite mit
gesundheitsbezogenen Informationen zu prüfen, wurden aus einer Vielzahl von
generischen Instrumenten zwei ausgewählt, die den Anforderungen entsprachen: Das
DISCERN-Instrument und die HONcode-Kriterien. [41-43] Diese ließen einen
Rückschluss auf Seriosität und Verlässlichkeit zu. Der Inhalt der zu bewertenden
Seiten wurde mit den Präventionsmaßnahmen der aktuellen S3-Leitlinie zur Prävention
von Hautkrebs abgeglichen, um vorhandene Fehler und Unvollständigkeiten der
Webseiten aufzudecken. [4]
In einer der Analyse vorangegangenen Umfrage sollten 49 Personen unterschiedlicher
Alters- und Berufsgruppen sinnvolle Stichwörter für eine bei GoogleTM durchgeführte
Suche nach Hautkrebspräventions-Informationen auflisten. Die häufigsten genannten
Begriffe mit mehr als zehn Nennungen waren: Sonnenbrand, Sonnenschutz,
Lichtschutzfaktor und Sonnencreme. Auf Grundlage dieser Befragung wurden die für
die Untersuchung ausgewählten vier Suchanfragen kreiert, von denen jeweils die
ersten 200 Treffer bei GoogleTM erfasst und analysiert worden sind.
Die Klickraten nehmen üblicherweise mit absteigender Position des Treffers zwar
deutlich ab, doch können durch die hohe Anzahl an untersuchten Seiten eventuelle
qualitativ hochwertige Seiten auf niedrigen Plätzen gefunden werden und damit zu
einem ausführlicheren Recherchieren animieren. Die „Google-Organic-CTR-Study“
zeigte 2014, dass die CTR (click-through rate), also die Anzahl der Klicks einer Seite
im Verhältnis zum Anzeigen der selbigen, bereits auf der zweiten Seite einer GoogleTM-
Suchanfrage nur noch bei 3,99% liegt, während der allererste Treffer eine CTR von
31,24% aufweist. Auf der dritten und den folgenden Seiten beträgt die CTR dann nur
noch 1,60%. Das intensive Beschäftigen und Suchen nach den richtigen und
relevanten Informationen werden demnach hauptsächlich auf die ersten zehn Seiten
einer Anfrage beschränkt. [44] Wenn diese ersten zehn Seiten dann auch noch von
schlechter Qualität und falschem oder gar irrelevantem Inhalt sind, könnte das die
Ergebnisse von Uter et al. deutlich bekräftigen. [36]
162.2 Suchanfragen
Aus der vorherigen Umfrage wurden vier Suchanfragen definiert, die ein typisches
Nutzerverhalten bei der Informationssuche im Internet simulieren sollten:
- Hautkrebs Sonnenschutz (A)
- Wie schützt man sich vor Sonne? (B)
- Sonnenschutz Kinder (C)
- Sonnenbrand vorbeugen (D)
Diese wurden im Folgenden an einem privaten DSL-Anschluss und einem neu
installierten Firefox©-Browser (Version 56.0.2 [32-Bit]) [45] ohne Werbeblocker für
jeweilige GoogleTM-Suchanfragen benutzt. Wir entschieden uns für GoogleTM, da diese
die geläufigste Suchmaschine im Internet ist (s.o.). Vor jeder neuen Suchanfrage
wurde das alte Firefox©-Profil gelöscht, ein neues erstellt und eine neue IP-Adresse
zugeteilt, um Referenzierungen zu vermeiden. Zusätzlich wurde ein webbasierter
„Fingerprint“ von der Seite „https://amiunique.org“ erstellt und gespeichert, um den
Erfolg o.g. Maßnahmen zu verifizieren. Um ein typisches „Klickverhalten“ zu
simulieren, wurde auf jeder 10er-Trefferseite eine Seite angeklickt, die zuvor durch das
Programm „R version 3.4.1 (2017-06-30)“ (32-Bit Windows PC) zufällig bestimmt
wurde. Die ersten 200 Treffer jeder Suchanfrage wurden gespeichert und für die
weitere Bearbeitung tabellarisch in einem Spreadsheet aufgelistet. Weiter behandelt
wurden nur frei zugängliche Webseiten, die ohne Anmeldung verfügbar waren, und
deren integrale Links als Teil des Webangebots. Es erfolgte keine Navigation innerhalb
der Webseite nach außerhalb auf externe Angebote. Kommerzielle Vermarktungen und
Hersteller-Seiten, Produkttests und -vergleiche, Foren sowie inhaltlich irrelevante und
bereits erfasste Treffer wurden als solche erfasst, jedoch nicht weiter untersucht.
Die verbliebenen Seiten wurden anschließend inhaltlich und generisch bewertet.
Zuletzt erfolgte eine globale Einschätzung der Qualität der Seiten mit einer Punktzahl
von 0 bis 10 auf einer Likert-Skala, mit 0 Punkten für eine völlig irrelevante
Internetseite, ohne jegliche Information und mit 10 Punkten für eine Seite, die alle
Informationen in einer verständlichen Weise vermittelt und in höchster Qualität
Transparenz und Seriosität darstellt.
Um die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse zu schätzen wurde die erste Suchanfrage
(A) doppelt und gegenseitig verblindet erfasst. Dabei wurden die DISCERN-Kriterien
zusätzlich von einem „Laien“ (P.E.) bewertet, während der HONcode und der Inhalt
von einem Experten (W.U.) doppelt erfasst wurden.
17Die Zeit für das Erheben der Daten und Auswerten der einzelnen Webseiten betrug ca.
116 Arbeitsstunden. Die anschließende Formatierung sowie Diskussion selbiger Daten
wurden im fortlaufenden Arbeitsprozess durchgeführt und optimiert.
2.3 Inhaltliche Kriterien
Die inhaltlichen Kriterien wurden der S3-Leitlinie zur Prävention von Hautkrebs
entnommen, insbesondere aus den empfohlenen Inhalten des Arzt-Patienten-
Gesprächs zu diesem Bereich (Abschnitt 4.26) [4]. Sie bezieht sich auf die Kenntnisse
von Ursachen von Hautkrebs, von Risikofaktoren und von Präventionsmöglichkeiten.
Die von der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention geführte Leitlinie
(ADP: www.unserehaut.de) richtet sich an Ärzte und Patienten in gleichem Maße und
versucht durch den aktuellen Wissensstand eine „Verbesserung der Gesundheit“ und
eine „höhere Lebensqualität der Bevölkerung“ zu ermöglichen. [4] Die 43 ermittelten
Kriterien wurden in folgende Kategorien eingeteilt:
1. Aufklärung über die Gefährdung von UV-Strahlen
2. Motivation zur Verhaltensänderung
3. Starke Sonneneinstrahlungsexpositionen vermeiden
4. Mittagssonne meiden
5. Aufenthalt in der Sonne zu kurz wie möglich
6. Schatten aufsuchen
7. Sonnenbrände vermeiden
8. UV-Index
9. Die Haut langsam an die Sonne gewöhnen
10. Schützende Kleidung tragen
11. Sonnenschutzmittel
12. Hautempfindlichkeit
13. Hauttypen
14. Medikamente
15. Kinder
16. Sonnenstudios meiden
17. Sonnenbrille
Zusätzlich wurden vier weitere Punkte bzgl. der inhaltlichen Qualität ergänzt. Zum
einen, ob die Rangfolge der Sonnenschutzmaßnahmen erwähnt wurde und ob sie
korrekt dargestellt worden ist und zum anderen, ob multimediale Werkzeuge wie Bilder
und Videos im richtigen Kontext benutzt worden sind. Die Rangfolge wurde ebenfalls
der S3-Leitlinie entnommen: An erster Stelle steht das gänzliche Meiden der
Sonnenexposition (z.B. durch Vermeiden von Mittagssonne und Aufsuchen von
Schatten), anschließend das Tragen geeigneter Kleidung und zuletzt das Nutzen von
Sonnenschutzmitteln. [4] Jedes Kriterium wurde dichotom bewertet, bei Zutreffen mit
einem Punkt und bei Nicht-Zutreffen mit 0 Punkten. Die maximale Punktzahl der
inhaltlichen Kriterien betrug somit 47 Punkte (siehe Seite 19).
181. Aufklärung über die Gefährdung von UV-Strahlen
1. Zusammenhang mit Hautkrebs
2. Exposition in der Freizeit
3. Exposition in manchen Berufen
4. Abhängigkeit von Jahreszeit/Tageszeit
5. Abhängigkeit von Wetterlage (Wolkendicke und –bedeckungsgrad)
6. Höhenlage (Meeresspiegel, Gebirge)
7. Reflexion durch den Untergrund (Erde, Sand, Schnee, Wasser)
8. Exposition im Schatten
9. UV-Exposition auch bei bewölktem Himmel
10. Was ist UV-Strahlung (UV-A/-B/-C)
2. Motivation zur Verhaltensänderung
1. Appell zur UV-Meidung
3. Starke Sonneneinstrahlungsexpositionen vermeiden
1. Aktivitäten im Freien in die Morgen- oder Abendstunden verlegen
2. „Schattenregel“: Schatten kürzer als schattengebendes Objekt = Starke UV-
Belastung
4. Mittagssonne meiden
1. Erwähnung „Mittagssonne meiden“
2. Definition der kritischen Zeit (i.d.R. als 11:00-15:00 Uhr)
5. Aufenthalt in der Sonne zu kurz wie möglich
1. Erwähnung „Aufenthalt in der Sonne so kurz wie möglich“
6. Schatten aufsuchen
1. Erwähnung „Schatten aufsuchen“
2. Hinweis auf Streustrahlung v.a. am Strand/unter Sonnenschirm
7. Sonnenbrände vermeiden
1. Erwähnung „Sonnenbrände vermeiden“
2. Risiko für Hautkrebs wird durch Sonnenbrände stark erhöht
8. UV-Index
1. Erklärung des UVI
2. Sonnenschutzmaßnahmen werden in Abhängigkeit vom UV-Index empfohlen
3. Hinweis, wo der UVI publiziert wird
9. Die Haut langsam an die Sonne gewöhnen
1. Erwähnung „die Haut langsam an die Sonne gewöhnen“
10. Schützende Kleidung tragen
1. Hinweis auf Lichtschutzfaktor;
2. langärmelige Kleidung
3. spezielle Strand-/Badekleidung
11. Sonnenschutzmittel
1. Korrekte Einordnung als „letztes Mittel“;
2. Hinweis auf adäquaten Lichtschutzfaktor
3. Eincremen einer ausreichenden Menge (2 mg/cm²);
4. Auftragen vor Sonnenexposition
5. Wiederholtes Auftragen z.B. nach Baden (kein verlängerter Schutz)
6. Wasserfeste Präparate vorzugsweise
12. Hautempfindlichkeit
1. Hinweis auf Fitzpatrick-Hauttypen oder „keltischen Typ“
2. Beratung über individuelle Schutzmaßnahmen in Abhängigkeit vom Hauttyp des
Patienten
13. Hauttypen
1. Darstellung der Merkmale der Fitzpatrick-Hauttypen oder des „keltischen Typs“
14. Medikamente
1. Hinweis auf Packungsbeilage oder Arzt-Information (mögliche Nebenwirkungen)
15. Kinder
1. Kinder sollen keinen Sonnenbrand bekommen
2. Säuglinge sollen der direkten Sonne nicht ausgesetzt werden
16. Sonnenstudios meiden
1. Jegliche Begründung/jegliches Detail
17. Sonnenbrille
1. Hinweis auf ausreichende, UV-schützende Qualität
2. Europäischen Norm EN 1836 erwähnt
3. Blendungskategorien erwähnt
192.4 DISCERN
Für die generische Analyse wurde das DISCERN-Instrument benutzt. [46]
Dabei handelt es sich um ein zuverlässiges und gültiges Werkzeug für die Bewertung
der Qualität von schriftlichen Gesundheits-Informationen. Die ursprünglichen 16
Fragen, die in drei Abschnitte aufgegliedert sind, repräsentieren jeweils ein eigenes
Qualitätskriterium. Für die zu untersuchenden Internetseiten wurden nur die ersten
acht Fragen eingesetzt, um die Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit zu beurteilen,
da der zweite Abschnitt sich hauptsächlich mit Behandlungsalternativen
auseinandersetzt, welche bei der Hautkrebsprävention keine Relevanz zeigen. Für
jedes Kriterium wurde eine Punktzahl vergeben: 5 Punkte für eine Zustimmung, 3
Punkte für eine partielle Zustimmung und 1 Punkt für keine Zustimmung. Bei den acht
Fragen betrug die minimal zu erreichende Gesamtpunktzahl somit 8 Punkte und die
maximale 40 Punkte. [43] Wichtig zu erwähnen sei hier, dass bei einer fehlenden
Zustimmung der ersten Frage die zweite Frage nicht bearbeitet wurde. Dadurch ergab
sich bei der Auswertung der Ergebnisse eine numerische Abweichung bezüglich des
Items 2.
Tabelle 2 – DISCERN-Kriterien [46]
Frage 1: Sind die Ziele der Publikation klar?
Frage 2: Erreicht die Publikation ihre selbstgesteckten Ziele?
Frage 3: Ist die Publikation für Sie bedeutsam?
Frage 4: Existieren klare Angaben zu den Informationsquellen, die zur
Erstellung der Publikation herangezogen wurden (neben
dem Autor oder Hersteller)?
Frage 5: Ist klar angegeben, wann die Informationen, die in der
Publikation verwendet und wiedergegeben werden, erstellt
wurden?
Frage 6: Ist die Publikation ausgewogen und unbeeinflusst
geschrieben?
Frage 7: Enthält die Publikation detaillierte Angaben über ergänzende
Hilfen und Informationen?
Frage 8: Äußert sich die Publikation zu Bereichen, in denen
Unsicherheiten bestehen?
2.5 HONcode
Der HONcode (Health On the Net) ist eine Liste von acht ethischen Richtlinien für
Internetseiten, die Gesundheitsinformationen verbreiten und vermitteln. [42] Er soll
dabei helfen qualitativ hochwertige medizinische Informationen zu fördern.
Internetseiten, die die Kriterien erfüllen, können das HONcode Gütesiegel präsentieren
und damit ihre Qualität hinsichtlich Transparenz und Korrektheit der Informationen
belegen. Eine jährliche Kontrolle sichert die Aktualität und Transparenz. Die Bewertung
der HONcode Kriterien übernahmen wir von den DISCERN-Kriterien, mit fünf, drei oder
einem Punkt. Die maximal zu erreichende Punktzahl betrug somit ebenfalls 40 Punkte
und die minimale 8 Punkte. [42]
20Tabelle 3 – Kriterien des HONcodes
Prinzipien Beschreibung
1. Sachverständigkeit Angabe der Qualifikationen der
Verfasser
2. Komplementarität Information zur Unterstützung- und nicht
als Ersatz- der Arzt-Patient-Beziehung
3. Datenschutz Einhalten des Datenschutzes und der
Vertraulichkeit persönlicher Daten, die
der Webseitenbesucher eingegeben hat
4. Quellenangaben Angabe der Quelle(n) der
veröffentlichten Information sowie des
Datums medizinischer und
gesundheitsbezogener Seiten
5. Belegbarkeit Die Seite muss Behauptungen bezüglich
Nutzen und Effizienz untermauern
6. Transparenz Zugängliche Darstellung, genauer E-
Mail-Kontakt
7. Offenlegung der Finanzierung Angabe der Finanzierungsquellen
8. Werbepolitik Werbeinhalt wird klar von redaktionellem
Inhalt unterschieden
2.6 Ergebnisdarstellung
Die Ergebnisse wurden tabellarisch, durch Säulen- sowie Bland-Altman-Diagramme
dargestellt. Das Bland-Altman-Diagramm vergleicht zwei Methoden, in diesem Fall die
unterschiedliche Punktvergabe von C.E. und W.U. bzw. P.E., indem die Differenz
zweier Ergebnisse gegen den Mittelwert aus beiden aufgetragen wird. Dadurch können
mögliche systemische Unterschiede der verschiedenen Scores erkannt und analysiert
werden. Zur Orientierung sind zusätzlich immer der arithmetische Mittelwert der
Differenz und die 1,96-fache Standardabweichung der Differenz mit angegeben.
[47, 48] Die Kreisgröße in den jeweiligen Diagrammen (angelehnt an „bubble charts“)
entspricht der Anzahl an Internetseiten, die bei einem bestimmten Mittelwert dieselbe
Differenz aufweisen. Zur weiteren Illustration dieser Übereinstimmungen wurden die
dazugehörigen Kreuztabellen erzeugt, jedoch nicht für das Bland-Altman-Diagramm
des globalen Inhalts-Scores, da durch die vielen Ausprägungen eine Interpretation
schwierig geworden wäre.
Die Korrelation der Bewertungen von C.E. und W.U./P.E. wird durch Kendalls als
Rangkorrelationskoeffizient quantifiziert. Dieser Wert gibt an, wie konkordant oder
diskonkordant die beiden Beurteilungen der jeweiligen Parteien ausfiel. Ist positiv,
dann gibt es mehr Übereinstimmungen als Ungleichheiten, wenn negativ ist,
umgekehrt. [49]
21Die Interpretation der Korrelationen der unterschiedlichen Instrumente wurde mithilfe
des Pearson Korrelationskoeffizienten (= r) unterstützt. Dieser ist ein Maß für die
lineare Assoziation zwischen zwei stetig-quantitativen Merkmalen. Bei einem
Koeffizienten von r = 0 besteht kein linearer Zusammenhang, bei 0 < r ≤ 0,5 besteht ein
schwach linearer Zusammenhang. Findet sich ein Korrelationskoeffizient von
0,5 < r ≤ 0,8, so lässt dies auf einen mittleren linearen Zusammenhang schließen. Bei
0,8 < r < 1 ist ein starker linearer Zusammenhang vorhanden und bei r=1 handelt es
sich um einen perfekt linearen Zusammenhang. Dieser kann sowohl positiv als auch
negativ sein. [50]
Die Korrelation zwischen dem inhaltlichen Score und dem jeweiligen Rang der
Internetseite wurde in Boxplots dargestellt. Die Ränge wurden dafür in drei linksoffene
Intervalle unterteilt: Die ersten zehn Seiten einer Suchanfrage, die darauffolgenden 20
Seiten und die restlichen 170 Internetseiten der insgesamt 200 Treffer. Anhand der
Boxplots kann eine Interpretation des Medians, des oberen und unteren Quartils, des
Minimums und Maximums sowie einzelner Ausreißer vorgenommen werden. Durch
das Aufteilen in die drei Kategorien kann folglich diskutiert werden, inwieweit sich die
Ergebnisse qualitativ verändern, wenn man auch Treffer später auftretender Seiten
berücksichtigt.
Weiterhin wurde durch Anwendung des Kruskal-Wallis Tests die Heterogenität der
unterschiedlichen ordinalen Verteilungen ermittelt. Dieser Test für mehr als zwei
unabhängige Stichproben zeigt, ob sich die zentralen Tendenzen der Stichproben
unterscheiden. Angewandt auf die vorliegende Thematik wird demnach geprüft, ob die
Mediane der unterschiedlichen Kategorien der Internetseiten gleich sind oder sich
signifikant unterscheiden. [51]
223. Ergebnisse
Die folgenden Ergebnisse werden mit den Initialen der prüfenden Personen abgekürzt,
C.E. als Untersucher aller Seiten, W.U. als Experte für den HONcode und den Inhalt
bei Suchanfrage A und P.E. als „Laie“ für die DISCERN-Kriterien bei Suchanfrage A.
3.1 „Hautkrebs Sonnenschutz“ (A)
Bei der Suchanfrage „Hautkrebs Sonnenschutz“ handelte es sich bei 3 der 200
Webseiten um Duplikate mit derselben URL, die daher von der weiteren Auswertung
ausgeschlossen wurden. Relevante Inhalte wurden nach Einschätzung von W.U. in
103 von 200 untersuchten Webseiten dargestellt. Nach Einschätzung von C.E. war
dies dagegen bei 180 Seiten der Fall. Bis auf eine Webseite wurden alle von W.U. als
relevant angesehenen Seiten auch von C.E. als relevant angesehen; diese 102 Seiten
als Schnittmenge bilden daher die Grundlage der Datenauswertungen.
3.1.1 Inhaltliche Kriterien
Abbildung 3 zeigt die Verteilung der globalen Punkte bezüglich der inhaltlichen
Kriterien. Die Inhalts-Scores zentrierten sich im Bereich von 5 bis 15 Punkten. Höhere
Punktzahlen von 20 und höher wurden bei W.U. nur von 11 Seiten erreicht und bei
C.E. von 14. Die Ergebnisse aller Items des Inhalts-Scores von C.E. und W.U. sind in
Tabelle 5 zusammengefasst. Die Suchanfrage „Hautkrebs Sonnenschutz“ ergab bei
den bewerteten 102 Internetseiten eine Häufung von bestimmten inhaltlichen Kriterien.
Das sowohl von C.E. als auch W.U. häufigste gefundene Item ist der Zusammenhang
von UV-Strahlung und Hautkrebs („Zusammenhang UV/Hautkrebs“, C.E.: 101,
W.U.: 92). Die Bewertung der auf den Internetseiten gefundenen Informationstexte
unterschied sich bei den weiteren inhaltlichen Items durch zum Teil weit abweichende
Ergebnisse. Die zweit- und dritthäufigsten Items von C.E. waren mit 74 Nennungen
„Appell zur UV-Meidung“ und mit 70 Nennungen „Hinweis auf adäquaten
Lichtschutzfaktor“, bei W.U. mit 79 Nennungen „Hinweis auf adäquaten
Lichtschutzfaktor“ und 74 Nennungen „langärmelige Kleidung“. Die drei Items mit der
geringsten Bewertung waren bei C.E. „Erwähnung Schattenregel“ mit zwei,
„Sonnenbrille nach EU-Norm“ mit einer und „Sonnenbrille mit Blendschutz“ mit drei
Treffern. W.U. vergab die niedrigsten Ergebnisse bei den Items „Erwähnung
Schattenregel“ mit einem, „Sonnenbrille nach EU-Norm“ mit einem und „Sonnenbrille
mit Blendschutz“ ohne einen einzigen Treffer. Bei 6 der 43 Items war eine vollständige
Übereinstimmung der Ergebnisse anzutreffen. Dies betraf folgende Items: „Erwähnung
der kritischen Zeitspanne“, „Aufenthalt in der Sonne so kurz wie möglich“, „Vermeidung
von Sonnenbränden“, „Spezialkleidung, z.B. für den Strand“, „Säuglinge sollen nicht in
23die Sonne“ und „Sonnenbrille nach EU-Norm“. Eine Überschneidung der Bewertung
war also durchaus vorhanden. Die Korrelation zwischen C.E. und W.U., quantifiziert
mittels Pearson Korrelationskoeffizienten, betrug 0,8 (95% KI: 0,71 – 0,86). Die
zusätzlichen Kriterien, die zur inhaltlichen Qualitätsbewertung hinzugezogen wurden,
sind in Tabelle 4 dargestellt. Auch hier ist eine Kongruenz zwischen C.E. und W.U.
erkennbar, so wurde die „Erwähnung der Rangfolge von Schutzmaßnahmen“ von C.E.
in 39 Fällen und von W.U. in 34 Fällen als erfüllt angesehen. Diese Rangfolge wurde
folgend bei C.E. auf 34 Seiten und bei W.U. auf 32 Seiten auch korrekt dargestellt. Die
auf den Internetseiten gezeigten Bilder waren z.T. sinnvoll in Bezug auf die
Primärprävention von Hautkrebs, C.E. stufte zwölfmal präsentierte Bilder als sinnvoll
ein, während für W.U. nur drei Bilder einen inhaltlichen Wert zeigten. Die globale
Qualität wurde von beiden Parteien ähnlich eingeschätzt. Der Mittelwert betrug bei C.E.
3,44 und bei W.U. 3,06. Die Korrelation der Einschätzung der globalen Qualität der
Webseite, auf einer Skala von 0 bis 10, quantifiziert mittels Pearson
Korrelationskoeffizienten, betrug 0,74 (95% KI: 0,64 – 0,82). Die Vergabe der globalen
Punkte ist in Abbildung 10 in einem Säulendiagramm dargestellt.
Abbildung 4 zeigt die Übereinstimmung zwischen der Bewertung derselben
untersuchten Einheiten durch W.U. und C.E. durch das Bland-Altman-Diagramm. Die
Schwankungsbreite der Abweichungen ist im Bereich von niedrigeren Mittelwerten
geringer als im Bereich höherer Mittelwerte (>20). Im oberen Punktbereich wurde
häufiger ein höherer Score durch C.E. vergeben, was die zehn vorliegenden negativen
Differenzen erklärt, während W.U. im Vergleich nur zweimal einen höheren Score
erteilt hat. Die Referenzlinie des arithmetischen Mittels der Differenz „W.U. minus C.E.“
bei -1 zeigte auch, dass die durch C.E. vorgenommene Bewertung tendenziell eher
positiver ausfiel als die von W.U.
Tabelle 4 – Zusätzliche Kriterien in Suchanfrage A
Item n (%) C.E. n (%) W.U.
Erwähnung der Rangfolge von Schutzmaßnahmen 39 (38.2) 34 (33.7)
Rangfolge von Schutzmaßnahmen korrekt 34 (33.3) 32 (31.7)
Sinnvolle Bilder 12 (11.8) 3 (3)
Sinnvolle Videos 9 (8.8) 2 (2)
Globale Qualität (0 bis 10): Q1, Median, MW, Q3 2, 3, 3.44, 5 2, 3, 3.06, 4
24Sie können auch lesen