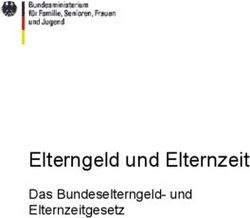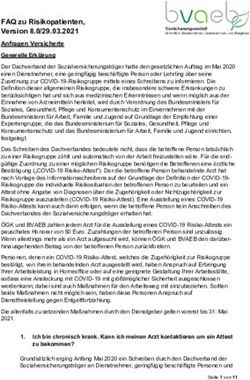DER PAPA WIRD SICH'S SCHON RICHTEN - JKU ePUB
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Eingereicht von
Sonja Humer
Angefertigt am
Institut für Recht der
sozialen
Daseinsvorsorge und
Medizinrecht
Beurteiler / Beurteilerin
DER PAPA WIRD
Assoz. Univ.-Prof. Dr.
Barbara Födermayr
SICH’S SCHON
Juli 2020
RICHTEN
Die Ansprüche des Väterkarenzgesetzes mit besonderem Fokus auf die
gesetzlichen Regelungen des Papamonats
Diplomarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades
Magistra der Rechtswissenschaften
im Diplomstudium
Rechtswissenschaften
JOHANNES KEPLER
UNIVERSITÄT LINZ
Altenberger Straße 69
4040 Linz, Österreich
jku.at
DVR 0093696EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt bzw. die wörtlich oder sinngemäß entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe. Die vorliegende Diplomarbeit ist mit dem elektronisch übermittelten Textdokument identisch. Wels, 14.7.2020 Sonja Humer 14. Juli 2020 2/79
VORWORT Die Unterstützung beim Durchsetzen von Rechten und im besten Fall sogar das Durchsetzen von Gerechtigkeit behielt ich im Laufe meines Studiums stets im Hinterkopf. So war es nicht weiter verwunderlich, dass ich mich im Zuge meiner Ausbildung dafür entschieden habe, meine Diplomarbeit im Fachbereich Arbeits- und Sozialrecht zu absolvieren. Den finalen Impuls hierfür gab mir, ohne es zu wissen, letztendlich Frau Dr.in Barbara Födermayr im Zuge meiner mündlichen Diplomprüfung. Sie verabschiedete mich damals mit folgenden Worten: „Frau Humer man merkt deutlich, dass Sie den Stoff beim Lernen verstehen wollten und das haben Sie auch geschafft.“ Mit dieser Aussage traf sie den sprichwörtlichen Nagel auf den Kopf und für mich stand fest, dass ich dem Fachbereich Arbeits- und Sozialrecht noch nicht den Rücken kehren möchte. Da gegen den Fluss zu schwimmen schon immer eine meiner Stärken war, entschied ich mich nach Rücksprache mit Frau Dr.in Födermayr für ein nicht ganz frauentypisches Thema: Väter, die „Underdogs“ im Bereich Kinderbetreuung. Doch nicht nur Frau Dr.in Barbara Födermayr hat mich auf meinem Weg begleitet. Besonders hervorheben möchte ich an dieser Stelle meine Mutter Helga Humer, welche trotz nahezu täglicher Anrufe im Zuge meiner intensivsten Arbeitsperiode – während der Covid-19 Ausgangsbeschränkungen – stets ein offenes Ohr für mich hatte. Die Fragen „Fällt dir ein anderes Wort für (…) ein?“ und „Dieser Satz klingt nun doch sehr gewöhnungsbedürftig. Kann ich das tatsächlich so schreiben?“ stellte ich in dieser Phase vermutlich nahezu inflationär. Ein zweites Paar Augen und Ohren weiß schließlich jeder Mensch, der sich so intensiv mit einer Thematik auseinandergesetzt hat, zu schätzen. Auch mein Vater Mag. Heinz Humer konnte mich aufgrund seiner Vorkenntnisse im sozialrechtlichen Bereich durch seine Tätigkeit bei der PVA Linz tatkräftig unterstützen. So belehrte er mich unter anderem über die Tatsache, dass es selbstredend keinesfalls einen Tag ohne gesetzliche Regelung gibt und ich als angehende Juristin mit den Formulierungen „bis“ und „nach“ durchaus vorsichtiger umgehen sollte. 14. Juli 2020 3/79
Erwähnen möchte ich auch noch Katharina und Maximilian P., welche trotz der Dreifachbelastung von Beruf, Kinderbetreuung und Haushalt, die Zeit fanden, meine Interviewfragen hinsichtlich Papamonat zu beantworten. Sie haben es mit ihrem lebensnahen Erfahrungsbericht geschafft, meiner Arbeit den – meiner Meinung nach – dringend notwendigen Bezug zum echten Leben zu verschaffen, welcher im Zuge von wissenschaftlichen Arbeiten nur zu gerne vernachlässigt wird. Schließlich war es mir doch ein persönliches Anliegen eine Diplomarbeit zu verfassen, welche nicht die ewig gleichen Phrasen für die Leserschaft herunterbricht. 14. Juli 2020 4/79
Inhaltsverzeichnis
I. ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS ............................................................................................. 8
II. EINLEITUNG ...................................................................................................................... 10
III. VKG .................................................................................................................................... 11
A. Allgemeines ................................................................................................................. 11
B. Geltungsbereich .......................................................................................................... 11
1. Allgemeines............................................................................................................. 11
2. Exkurs: Elternteil iSd § 144 Abs 2 und 3 ABGB ....................................................... 12
3. Ausnahmen vom Geltungsbereich ........................................................................... 13
IV. ANSPRÜCHE NACH VKG .................................................................................................. 14
A. Anspruch auf Freistellung anlässlich der Geburt eines Kindes nach § 1a VKG ............ 14
1. Terminologie ........................................................................................................... 14
2. Praxisbericht ........................................................................................................... 15
3. Arbeitsrechtliche Aspekte ........................................................................................ 16
a) Rechtslage vor dem 1.9.2019 ........................................................................... 16
(1) Allgemeines ................................................................................................. 16
(2) Vereinbarter Papamonat .............................................................................. 17
(3) Anspruch auf Väterfrühkarenz...................................................................... 17
b) Rechtslage ab dem 1.9.2019 ............................................................................ 18
(1) Allgemeines ................................................................................................. 18
(2) Gesetzgebungsverfahren und Inkrafttreten nach § 14 Abs 19 VKG ............. 18
(3) Anspruchsgrundlage und Anspruchsvoraussetzungen ................................. 21
(4) Lage und Dauer der Freistellung nach § 1a Abs 1, 2 und 4 VKG ................. 22
(5) Mitteilungspflichten des AN nach § 1a Abs 3 VKG ....................................... 24
(6) Verhältnis zu anderen Ansprüchen .............................................................. 27
(7) Wichtige Nebenbestimmungen .................................................................... 30
(8) Adoptiv- und Pflegeltern ............................................................................... 35
4. Exkurs: Sozialrechtliche Aspekte............................................................................. 36
a) FamZeitbG ....................................................................................................... 36
b) Familienzeitbonus ............................................................................................ 36
(1) Allgemeines ................................................................................................. 36
(2) Antragsstellung nach § 3 Abs 3 FamZeitbG ................................................. 39
(3) Anspruchsgrundlage und Anspruchsvoraussetzungen nach § 2 FamZeitbG 39
5. Unionsrechtliche Aspekte (RL (EU) 2019/1158) ...................................................... 41
a) Allgemeines...................................................................................................... 41
14. Juli 2020 5/79b) Vaterzeit ........................................................................................................... 43
c) Innerstaatliche Umsetzung ............................................................................... 44
6. Rechtsfragen und Problemfelder auf nationaler Ebene............................................ 45
a) Krankenhausaufenthalt des Kindes (unmittelbar) nach der Geburt ................... 45
b) Verhältnis kollektivvertraglicher Anspruch und Anspruch nach VKG ................ 47
B. Anspruch auf Karenz nach § 2 ff VKG ......................................................................... 48
1. Anspruch auf Karenz nach § 2 VKG ........................................................................ 48
a) Allgemeines...................................................................................................... 48
b) Anspruch .......................................................................................................... 49
2. Sonderformen der Karenz nach § 3 ff VKG ............................................................. 50
a) Teilung der Karenz zwischen Mutter und Vater nach § 3 VKG ......................... 50
b) Aufgeschobene Karenz nach § 4 VKG ............................................................. 50
c) Karenz des Adoptiv- oder Pflegevaters nach § 5 VKG ..................................... 51
d) Karenz bei Verhinderung des anderen Elternteils – Verhinderungskarenz nach
§ 6 VKG ........................................................................................................... 51
3. Wichtige Nebenbestimmungen ................................................................................ 52
a) Kündigungs- und Entlassungsschutz bei Karenz nach § 7 VKG ....................... 52
b) Recht auf Information nach § 7a VKG .............................................................. 53
c) Beschäftigung während der Karenz nach § 7b VKG ......................................... 53
C. Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung sowie Anspruch auf Änderung der Lage der
Arbeitszeit nach § 8 ff VKG .......................................................................................... 54
1. Teilzeitbeschäftigung ............................................................................................... 54
a) Allgemeines...................................................................................................... 54
b) Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung nach § 8 VKG ........................................... 54
c) Vereinbarte Teilzeitbeschäftigung nach § 8a VKG............................................ 56
d) Karenz an Stelle von Teilzeitbeschäftigung nach § 8e VKG ............................. 56
e) Kündigungs- und Entlassungsschutz nach § 8f VKG ........................................ 56
f) Teilzeitbeschäftigung des Adoptiv- oder Pflegevaters nach § 8g VKG ............. 57
2. Änderung der Lage der Arbeitszeit nach § 8h VKG ................................................. 57
V. FAZIT ................................................................................................................................. 58
VI. QUELLENVERZEICHNIS ................................................................................................... 60
A. Literatur ....................................................................................................................... 60
B. Judikatur ...................................................................................................................... 63
1. OGH ........................................................................................................................ 63
2. VfGH ....................................................................................................................... 63
C. Internetadressen.......................................................................................................... 64
14. Juli 2020 6/79VII. ANHANG ............................................................................................................................ 65
A. Internetadressen.......................................................................................................... 65
B. Interview (Originalfassung) .......................................................................................... 66
C. Auszug KollV für Angestellte der Banken und Bankiers ............................................... 73
D. Vorankündigung des Papamonats (Formular AK) ........................................................ 74
E. Meldung des Papamonats (Formular AK) .................................................................... 75
F. Antrag auf Familienzeitbonus für Väter ........................................................................ 76
14. Juli 2020 7/79I. ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS ABGB Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch JGS 946 idgF Abs Absatz AG Arbeitgeber, -in AK Arbeiterkammer (Kammer für Arbeiter und Angestellte) AlVG Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 BGBl 1977/609 idgF AN Arbeitnehmer,-in AngG Angestelltengesetz BGBl 1921/292 idgF Anm Anmerkung, -en ArbVG Arbeitsverfassungsgesetz BGBl 1974/22 idgF Art Artikel BGBl Bundesgesetzblatt B-GlBG Bundes-Gleichbehandlungsgesetz BGBl 1993/100 idgF BR Betriebsrat Bsp Beispiel, -e bspw beispielsweise BSVG Bauern-Sozialversicherungsgesetz BGBl 1978/559 idgF bzw beziehungsweise dh das heißt DN Dienstnehmer, -in EKUG Eltern-Karenzurlaubsgesetz BGBl 1989/651 EStG Einkommenssteuergesetz 1988 BGBl 1988/400 idgF etc et cetera EU Europäische Union EuGH Europäischer Gerichtshof FamZeitbG Familienzeitbonusgesetz BGBl I 2016/53 idgF ff und der, die folgenden FLAG Familienlastenausgleichgesetz BGBl 1967/376 idgF FMedG Fortpflanzungsmedizingesetz BGBl 1992/275 idgF gem gemäß GlBG Gleichbehandlungsgesetz BGBl 1979/108 idgF GSVG Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz BGBl 1978/560 idgF iSd im Sinne des, - der iVm in Verbindung mit KBGG Kinderbetreuungsgeldgesetz BGBl I 2001/103 idgF KollV Kollektivvertrag 14. Juli 2020 8/79
LAG Landarbeitsgesetz 1984 BGBl 1984/287 idgF lit litera (Buchstabe) MSchG Mutterschutzgesetz 1979 BGBl 1979/221 idgF NAG Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz BGBl I 2005/100 idgF NR Nationalrat oÄ oder Ähnliche(s) OGH Oberster Gerichtshof ÖGK Österreichische Gesundheitskasse RL Richtlinie der EU Rsp Rechtsprechung (iSv Judikatur) S Satz UrlG Urlaubsgesetz BGBl 1976/390 idgF usw und so weiter VfGH Verfassungsgerichtshof Vgl vergleiche VKG Väterkarenzgesetz BGBl 1989/651 idgF Z Zahl, Ziffer 14. Juli 2020 9/79
II. EINLEITUNG Nach Erhebungen der Statistik Austria hatten im Jahr 2018 fast ein Drittel aller erwerbstätigen Österreicher Betreuungspflichten für Kinder unter 15 Jahren. In die Untersuchung miteinbezogen wurden hierbei sowohl Frauen als auch Männer jeweils im Alter von 18 bis 64 Jahren. Von der Problematik der Vereinbarkeit von Kinderbetreuung und Erwerbstätigkeit waren im Jahr 2018 demzufolge 1,59 Millionen Berufstätige betroffen. Die klassische Rollenverteilung von Mann und Frau scheint im Hinblick auf die Betreuung der Kinder in Österreich nach wie vor tief verankert zu sein. Nur 5 % der befragten Männer gaben an, dass sie ihre Arbeitszeit auf Grund von Betreuungspflichten reduziert haben. Dem gegenüber waren 39 % der Frauen gezwungen, ihr Beschäftigungsausmaß entsprechend zu reduzieren. Nach wie vor bleiben Männer im Anschluss an die Geburt eines Kindes im gleichen Ausmaß erwerbstätig, zu einer Verminderung der Arbeitszeit kommt es nur in Ausnahmefällen. Dieser Sachverhalt begründet auch den Umstand, dass die überwiegende Zahl der Väter (85 %) die Meinung vertrat, dass allenfalls vorhandene Betreuungspflichten keine Konsequenzen auf ihre Arbeit bergen würden. Dass die Kinderbetreuung nach wie vor im Wesentlichen im Zuständigkeitsbereich der Frauen liegt, zeigt sich auch dadurch, dass Männer nur in geringem Ausmaß ihre Arbeit zu Gunsten der Kinderbetreuung unterbrechen. Obwohl nahezu die Hälfte aller österreichischen Erwerbstätigen mit Kinderbetreuungspflichten ihre Erwerbstätigkeit temporär einschränken oder unterbrechen, waren dies nur in einem geringen Ausmaß die betreffenden Väter. Zahlenmäßig dominieren die Frauen – 1,57 Millionen Mütter stehen 137.000 Vätern gegenüber.1 Doch diese geringe Beteiligung der Männer an der Kinderbetreuung resultiert nicht aus fehlenden gesetzlichen Regelungen. Das VKG2 ist bereits seit seinem Inkrafttreten im Jahr 1990 in der österreichischen Rechtsordnung verankert und normiert seither die wichtigsten arbeitsrechtlichen Ansprüche der Väter. Es finden sich dort Regelungen im Hinblick auf Freistellung, Karenz, Teilzeitbeschäftigung sowie Veränderung der Lage der Arbeitszeit – ausschließlich zu Gunsten der familiären Verpflichtungen. Fraglich bleibt, wie gut diese Ansprüche tatsächlich in der Praxis umsetzbar sind. 1 Vgl http://www.statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_NATIVE_FILE&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&d DocName=122318 (abgefragt am 20.12.2019). 2 Anm: damals noch EKUG. 14. Juli 2020 10/79
III. VKG A. Allgemeines Sowohl mit dem VKG als auch mit dem MSchG wurde eine gesetzliche Regelung des Elternschutzes, notwendig wegen der Doppelbelastung durch Berufs- und Familienleben, geschaffen.3 Am 29.11.1989 wurde dem NR von mehreren Abgeordneten ein Initiativantrag vorgelegt. Ausschlaggebend für den damaligen Antrag war ein Wandel innerhalb des Familienrechts in Folge zahlreicher Reformen, dem der Gesetzgeber auch auf arbeits- und sozialrechtlicher Ebene entsprechen musste. Um eine bestmögliche gemeinsame Versorgung des Kindes durch beide Elternteile zu gewährleisten, bestand die Notwendigkeit zur Schaffung einer übereinstimmenden gesetzlichen Regelung.4 Im weiteren Verlauf wurde das VKG5 in seiner ursprünglichen Form am 29.12.1989 kundgemacht. Art 18 EKUG legte damals ein Inkrafttreten des Gesetzes nur wenige Tage später – am 1.1.1990 – fest.6 Um dem stetigen Wandel innerhalb der Gesellschaft im Hinblick auf das Familienleben gerecht zu werden, wurden die gesetzlichen Regelungen seither kontinuierlich novelliert. B. Geltungsbereich 1. Allgemeines Der Geltungsbereich des VKG ergibt sich aus § 1 VKG. Vom Geltungsbereich erfasst sind nach § 1 Abs 1 Z 1 VKG Beschäftigungsverhältnisse, die auf einem privatrechtlichen Vertrag iSd § 1151 Abs 1 S 1 ABGB beruhen. Nach ständiger Rsp des OGH stellen auch Lehrlinge AN dar und sind somit ebenfalls unter § 1 Abs 1 Z 1 VKG zu subsumieren. Heimarbeiter werden hingegen durch § 1 Abs 1 Z 2 VKG sogar ausdrücklich vom Geltungsbereich erfasst.7 Weiters ergibt sich nach § 1 Abs 1 Z 3 und 4 VKG eine Ausdehnung des Anwendungsbereichs auf 3 Vgl Enzelsberger in Hutter/Mazal, Fachlexikon Arbeitsrecht (2012), Elternschutz (lindedigital.at). 4 Vgl 298/A 17. GP Erläut 52. 5 Anm: damals noch EKUG. 6 Vgl EKUG BGBl 1989/651. 7 Vgl Wolfsgruber-Ecker in Neumayr/Reissner, Zeller Kommentar zum Arbeitsrecht3 § 1 VKG Rz 1 (Stand 1.1.2018, rdb.at). 14. Juli 2020 11/79
öffentlich-rechtliche Bedienstete und Dienstverhältnisse iSd § 14 Abs 2 B-VG und § 14a Abs 3 B-VG. Während § 1 Abs 1 Z 3 VKG auf ein Dienstverhältnis mit dem Bund abstellt, unabhängig davon ob dieses öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Natur ist, beschränkt sich § 1 Abs 1 Z 4 VKG auf Dienstverhältnisse von Lehrern an öffentlichen Schulen bzw öffentlichen land- und forstwirtschaftlichen Schulen sofern diese in die Bundeskompetenz fallen. Durch die Einordnung in die Gruppe der AN iSd § 1 Abs 1 Z 3 VKG und § 1 Abs 1 Z 4 VKG erfolgt auch die Anwendung der Sonderbestimmungen des fünften Abschnitts des VKG.8 Während zunächst nur Väter Normadressaten des VKG sein konnten, stehen die Ansprüche des VKG seit einer Novellierung im Jahr 2016 gem § 1 Abs 1a VKG auch Frauen zu, welche ein Elternteil iSd § 144 Abs 2 und 3 ABGB sind.9 Im Folgenden wird iSd Leserlichkeit dennoch vorrangig von Vätern die Rede sein. Frauen, welche ein „anderer Elternteil“ sind, sind dabei stets mitgemeint. 2. Exkurs: Elternteil iSd § 144 Abs 2 und 3 ABGB Im Jahr 2013 hob der VfGH Teile des FMedG mittels Erkenntnis auf. Durch diese Aufhebung steht die medizinisch unterstützte Fortpflanzung seitdem nun auch Frauen offen, welche in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung leben.10 Basierend auf diesem Erkenntnis musste vom Gesetzgeber eine Anpassung des § 144 ABGB vorgenommen werden. Um sich als Frau als Elternteil iSd § 144 Abs 2 und 3 ABGB zu qualifizieren, hat die von der biologischen Mutter verschiedene Frau bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen. Zunächst gilt zu beachten, dass es sich beim anderen Elternteil auch tatsächlich um eine Frau im biologischen Sinn handeln muss. Das Gesetz stellt hierbei auf Frauen mit XX- Geschlechtschromosomen ab und impliziert damit zugleich den Ausschluss von Frauen, welche ursprünglich als Mann geboren wurden.11 Des Weiteren müssen im Hinblick auf die künstliche Befruchtung im Gesetz näher ausgeführte Fristen eingehalten werden. Das Gesetz nimmt hierbei die Elternschaft als gegeben an, wenn das Kind zwischen 180 und 300 Tagen nach der vorgenommenen medizinisch unterstützen Befruchtung geboren wird.12 Sind die Mutter und die andere Frau jedoch durch eine eingetragene 8 Vgl Wolfsgruber-Ecker in Neumayr/Reissner, ZellKomm3 § 1 VKG Rz 2. 9 Vgl Wolfsgruber-Ecker in Neumayr/Reissner, ZellKomm3 § 1 VKG Rz 2/1. 10 Vgl VfGH G 16/2013 RdM 2014/77, 65. 11 Vgl Stormann in Schwimann/Kodek, ABGB5 § 144 ABGB Rz 16. 12 Vgl Stormann in Schwimann/Kodek, ABGB5 § 144 ABGB Rz 18. 14. Juli 2020 12/79
Partnerschaft verbunden, kommt es automatisch zur Annahme, dass die Frau Elternteil ist, sofern das Kind während einer bestehenden Partnerschaft geboren wird. Hier findet sich eine Analogie zur widerleglichen Annahme, dass auch Männer stets die Väter während aufrechter Ehe geborener Kinder sind.13 Des Weiteren steht den betreffenden Frauen auch die Möglichkeit einer Anerkenntnis oder einer gerichtlichen Feststellung offen.14 3. Ausnahmen vom Geltungsbereich Nicht in den Anwendungsbereich des VKG fallen Land- und Forstarbeiter und all jene AN, die in einem Dienstverhältnis mit einem Land, einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband stehen.15 Des Weiteren sind vom Anwendungsbereich die freien DN, die arbeitnehmerähnlichen Personen und jene, die in einem (freien) Ausbildungsverhältnis stehen, ausgenommen. Dies resultiert daraus, dass es sich bei den zuletzt genannten Beschäftigungsverhältnissen um keine Dienstverhältnisse iSd § 1 Abs 1 VKG handelt.16 13 Vgl Stormann in Schwimann/Kodek, ABGB5 § 144 ABGB Rz 19. 14 Vgl Stormann in Schwimann/Kodek, ABGB5 § 144 ABGB Rz 26. 15 Vgl Wolfsgruber-Ecker in Neumayr/Reissner, ZellKomm3 § 1 VKG Rz 3. 16 Vgl Wolfsgruber-Ecker in Neumayr/Reissner, ZellKomm3 § 1 VKG Rz 4. 14. Juli 2020 13/79
IV. ANSPRÜCHE NACH VKG
Durch zahlreiche Novellierungen des VKG wurden die Ansprüche von Vätern immer
weiter ausgebaut. Mittlerweile finden sich dort neben dem Anspruch auf Karenz nach
§ 2 ff VKG sowie dem Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung bzw Änderung der Lage der
Arbeitszeit nach § 8 ff VKG auch der Anspruch auf Freistellung anlässlich der Geburt
eines Kindes nach § 1a VKG.
Im Anschluss werden nun die jeweiligen Ansprüche – unter besonderer Bedachtnahme
auf den Anspruch nach § 1a VKG – näher beleuchtet.
A. Anspruch auf Freistellung anlässlich der Geburt eines Kindes nach
§ 1a VKG
1. Terminologie
Zum besseren Verständnis wird an dieser Stelle auf die zahlreichen unterschiedlichen
Terminologien bzw Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit der Freistellung nach
§ 1a VKG hingewiesen.
▪ Freistellung anlässlich der Geburt eines Kindes: die Bezeichnung Freistellung
anlässlich der Geburt eines Kindes leitet sich aus dem VKG ab
▪ Papamonat: die Bezeichnung Papamonat wird sowohl umgangssprachlich als
auch in manchen KollV verwendet
▪ Väterfrühkarenz: die Bezeichnung Väterfrühkarenz findet sich im öffentlichen
Dienst sowie in manchen KollV
▪ Familienzeit: die Bezeichnung Familienzeit leitet sich aus dem FamZeitbG ab
▪ Vaterschaftsurlaub: die Bezeichnung Vaterschaftsurlaub findet vorrangig im
unionsrechtlichen Kontext Anwendung17
Nachfolgend wird zum überwiegenden Teil die Bezeichnung Papamonat oder Freistellung
verwendet. Trotz der vorrangig umgangssprachlichen Verwendung wird die Bezeichnung
Papamonat mittlerweile auch in der Literatur18 benützt. Hinsichtlich des sozialrechtlichen
Anspruchs auf Familienzeitbonus wird vorrangig der Begriff Familienzeit bedient.
17 Kurzböck, Der Anspruch auf Papamonat in Frage und Antwort - Teil 1, ARD 6687/5/2020.
18 So etwa Reissner und Sabara.
14. Juli 2020 14/792. Praxisbericht Anhand eines Interviews mit einem mit mir befreundeten Ehepaar, welches vor kurzem zum zweiten Mal Eltern wurde, habe ich versucht, die Praxistauglichkeit der derzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen sowie die Erreichbarkeit von relevanten Informationen näher zu durchleuchten. Katharina und Maximilian P. waren als Interviewpartner auch deshalb für mich sehr interessant, weil Maximilian im Gegensatz zum zweiten Kind bei der ersten Tochter keinen Papamonat in Anspruch genommen hat. Dadurch ist er in der Lage, die Unterschiede zwischen beiden Betreuungsmodellen aus eigener Erfahrung auszumachen. Beide gaben an, dass sie schon im Zuge der Familienplanung die weitere Vorgehensweise in Bezug auf die Kinderbetreuung besprochen und entschieden haben. Ausschlaggebend bei der Entscheidungsfindung sei dabei in erster Linie der finanzielle Aspekt gewesen. Eine Väterkarenz oder eine geteilte Karenz sei aus diesem Grund nicht möglich gewesen. Maximilian stellt klar, dass der Familienzeitbonus zwar ein gewisses "Grundeinkommen" sicherstellt, bei weitem aber nicht den tatsächlichen finanziellen Bedarf von Jungfamilien deckt. Wäre dieser höher, würde dadurch mehr Vätern die Inanspruchnahme eines Papamonats ermöglicht, so seine Annahme. Ein weiterer Interviewpunkt war die Erreichbarkeit von relevanten Informationen im Hinblick auf die gesetzlichen Ansprüche anlässlich der Geburt eines Kindes. Prinzipiell stellte dies für die beiden keine Schwierigkeit dar, zumal Katharina als Personalverrechnerin beruflich mit dieser Materie vertraut ist. Auch im Internet kann man sich gut informieren. Mehr Bedarf würde allerdings an Informationen, die direkt die Väter bzw die Väterkarenz betreffen, bestehen. Dies auch deshalb, da darüber infolge noch geringer Inanspruchnahme wenig bis gar kein Austausch mit anderen Vätern stattfindet. Zum Thema der Abwicklung des Papamonats beim Dienstgeber und der ÖGK gab Maximilian an, dass dies bei ihm reibungslos und unkompliziert funktionierte. Die Unterstützung vom Dienstgeber war auf jeden Fall gegeben und er hatte nie den Eindruck, dass dies nachteilige Auswirkungen auf seine berufliche Laufbahn hätte. Auch von den Kollegen kamen nur positive Rückmeldungen. Dass dies allerdings nicht in jeder Branche üblich und möglich ist, sei ihm aufgrund diverser Gespräche mit Bekannten bewusst. In vielen Bereichen wird es den AN sehr schwer gemacht, einen Papamonat bzw Väterkarenz in Anspruch zu nehmen. 14. Juli 2020 15/79
Zu guter Letzt wurde auch auf die Beweggründe, einen Papamonat in Anspruch zu nehmen, eingegangen. Dazu gab Maximilian unter anderem an, dass er vor allem bei der "Eingewöhnung und Aufnahme" des zweiten Kindes in der Familie aktiv mitwirken wollte. Auch wollte er schon zu Beginn eine starke Bindung zum Kind aufbauen, was durch die ständige Anwesenheit viel leichter möglich ist. Ein weiterer Grund sei die Entlastung von Katharina gewesen, die sich dadurch schneller von der Geburt erholen konnte und ihr dringend nötige Ruhephasen ermöglichte. Abschließend gaben beide an, dass sie den Rechtsanspruch auf den Papamonat als wertvollen Beitrag zur Durchführbarkeit der gemeinsamen Kinderbetreuung ansehen und ihn jederzeit wieder in Anspruch nehmen würden. Das Interview in seiner Originalfassung befindet sich zum Nachlesen im Anhang.19 3. Arbeitsrechtliche Aspekte Zunächst werden im folgenden Abschnitt die arbeitsrechtlichen Aspekte des Papamonats – also der Anspruch nach § 1a VKG – näher beleuchtet. Hierbei wird zwischen dem Zeitraum vor der Einführung der Freistellung ins VKG und nach dessen Aufnahme unterschieden. a) Rechtslage vor dem 1.9.2019 (1) Allgemeines Mit 1.3.2017 trat das FamZeitbG in Kraft, welches die vorerst erste Regelung hinsichtlich eines gesetzlichen Anspruchs im Zusammenhang mit dem Papamonat enthielt.20 Die damals erlassene Regelung im FamZeitbG begründete jedoch lediglich einen sozialrechtlichen Anspruch auf eine Geldleistung während der Konsumation der Familienzeit. Von der Schaffung eines generell geltenden Rechtsanspruches im arbeitsrechtlichen Sinne wurde damals (noch) Abstand genommen. Zwar gab es bereits in manchen KollV und auch im öffentlichen Dienst entsprechende Regelungen, der Allgemeinheit war dies jedoch nur mittels einer gesonderten Vereinbarung zwischen AN und AG zugänglich. Resultierend aus dem noch nicht vorhandenen Rechtsanspruch ergab sich auch das Fehlen eines etwaigen besonderen Bestandschutzes. Die Kündigung 19Vgl VII. B. Interview (Originalfassung). 20Vgl Hess-Knapp, Das neue pauschale Kinderbetreuungsgeld als Konto und der neue Familienzeitbonus (17. Novelle des KBGG), DRdA-infas 2016, 240. 14. Juli 2020 16/79
eines AN aufgrund der Inanspruchnahme von Familienzeit konnte dennoch auch damals unter Berufung auf den Motivkündigungsschutz nach § 3 iVm § 12 GlBG bzw § 4 iVm § 18c B-GlBG beim Gericht angefochten werden.21 (2) Vereinbarter Papamonat Auch ohne kollektivvertraglichen Anspruch gab es bereits vor der einschlägigen Regelung im VKG, aufgrund der im Arbeitsrecht grundsätzlich geltenden Privatautonomie, die Möglichkeit, zwischen AN und AG einen unbezahlten Urlaub zu vereinbaren, welcher als Papamonat fungierte. Bei einer solchen Vereinbarung galt es jedoch, rechtliche Fragen hinsichtlich der Sonderzahlungen, des Urlaubsanspruchs und der Abfertigung bereits im Vorfeld zu klären.22 Fanden sich keine widersprüchlichen Ausführungen im einschlägigen KollV, in internen Betriebsvereinbarungen oder aber auch in der Betriebsübung, war es möglich, Sonderzahlungen aliquot im Ausmaß des unbezahlten Urlaubs zu kürzen, sofern dies im Vorhinein vereinbart wurde.23 Hinsichtlich Abfertigung alt und Urlaubsansprüche gab es hierzu unterschiedliche Auffassungen der Auswirkungen eines solchen unbezahlten Urlaubs. Wurde keine gesonderte Vereinbarung getroffen, galt es der Rsp zu folgen.24 Nach Auffassung des OGH wuchs – sofern der unbezahlte Urlaub im Interesse des AN liegt – kein um den Zeitraum erweiterter Urlaubsanspruch an.25 Anders wurde dies bei der Abfertigung alt26 gehandhabt – dort kam es nach Rsp des OGH sehr wohl zu einer Anrechnung des unbezahlten Urlaubs.27 (3) Anspruch auf Väterfrühkarenz Wie vorangehend bereits erwähnt, war der Privatwirtschaft ein Anspruch auf Freistellung anlässlich der Geburt eines Kindes zunächst fremd. Einzug fand der Papamonat lediglich mittels vereinzelter kollektivvertraglicher Regelungen, zumeist unter der Bezeichnung „Väterfrühkarenz“. So fand sich unter anderem im KollV für Angestellte der Banken und 21 Vgl Hess-Knapp, DRdA-infas 2016, 240 (242). 22 Vgl Mühlberger, Ein "Papamonat" in der Privatwirtschaft: Wie geht das? Worauf ist zu achten? PVP 2014/70, 273 (274). 23 Vgl Mühlberger, PVP 2014/70, 273 (274). 24 Vgl Mühlberger, PVP 2014/70, 273 (274). 25 Vgl OGH 9 ObA 67/05a PVP 2014/70, 273 (274). 26 Anm: gilt nur für AV, die bereits vor dem 1.1.2003 geschlossen wurden. 27 Vgl OGH 8 ObA 47/05b PVP 2014/70, 273 (274). 14. Juli 2020 17/79
Bankiers in § 28c28 bereits seit 2011 ein Anspruch auf Freistellung, welcher der nun allgemein geltenden Bestimmung des § 1a VKG schon damals durchaus ähnelte.29 b) Rechtslage ab dem 1.9.2019 (1) Allgemeines Seit 1.9.2019 haben Väter nunmehr einen allgemeinen arbeitsrechtlichen Rechtsanspruch auf Freistellung anlässlich der Geburt eines Kindes nach § 1a VKG. Dieser Anspruch nach § 1a VKG besteht unabhängig von einem möglichen Anspruch auf Karenz nach § 2 ff VKG.30 Die Freistellung erfolgt gegen Entfall des Entgelts und ist hinsichtlich der Dauer mit der Länge eines Naturalmonats31 beschränkt.32 Neben dem Entgelt ruht auch die Arbeitspflicht des AN. Nicht davon betroffen sind etwaige aus dem AV entspringende Nebenpflichten33, da das AV in seinem Grundgerüst weiterläuft. Während somit unter anderem auch die Bestimmungen hinsichtlich Konkurrenzverbot34 nach § 7 AngG aufrecht bleibt, untersagt § 1a VKG die Ausübung einer Nebenbeschäftigung nicht. Daraus wird geschlossen, dass eine Nebenbeschäftigung ohne Verletzung des Konkurrenzverbots jedoch unter Verlust des Familienzeitbonus35 gestattet sei.36 Der Anspruch nach § 1a VKG richtet sich – wie alle Ansprüche nach VKG – sowohl an Väter als auch Frauen bzw Mütter, welche Elternteil iSd § 144 Abs 2 und 3 ABGB37 sind. Im letzteren Fall spricht man von einem Elternteilmonat.38 Im Sinne der Leserlichkeit wird im Folgenden dennoch hauptsächlich von Vätern gesprochen. (2) Gesetzgebungsverfahren und Inkrafttreten nach § 14 Abs 19 VKG Im nächsten Abschnitt werden das Gesetzgebungsverfahren sowie das Inkrafttreten der gesetzlichen Regelung näher erörtert. Besonders der Thematik des Inkrafttretens wird hierbei vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt und zum besseren Verständnis anhand von Beispielen ausgeführt. 28 Vgl VII. C. Auszug KollV für Angestellte der Banken und Bankiers. 29 Vgl Mühlberger, PVP 2014/70, 273. 30 Vgl Shubshizky, Aktuelle arbeitsrechtliche Neuerungen, ASoK 2019, 359. 31 Vgl IV. A. 3. b) (4) (b) Dauer der Freistellung nach § 1a Abs 1 VKG. 32 Vgl Hofer/Seidl/Tschuffer, Sozialversicherung 202020 (2020) Rz 1013. 33 Anm: bspw Treuepflicht, Fürsorgepflicht, etc. 34 Anm: Verbot von konkret bestimmten außerbetrieblichen Nebenbeschäftigungen. 35 Vgl IV. A. 4. b) (1) Allgemeines. 36 Vgl Reissner, Der „Papamonat“ aus arbeitsrechtlicher Sicht, ASoK 2019, 282. 37 Vgl III. B. 2. Exkurs: Elternteil iSd § 144 Abs 2 und 3 ABGB. 38 Vgl Reissner, ASoK 2019, 282. 14. Juli 2020 18/79
(a) Gesetzgebungsverfahren Am 30.1.2019 wurde ein Initiativantrag auf Abänderung bzw Erweiterung des VKG durch § 1a VKG gestellt. In der Begründung des Initiativantrags wurde damals unter anderem als Motiv angeführt, dass durch die Einführung einer solchen Freistellung bereits unmittelbar nach der Geburt eine verbesserte Bindung zwischen Vater und Kind bewirkt werden kann. Auch eine Erleichterung hinsichtlich der Vereinbarkeit von Beruf und Einbindung in die Kindererziehung sollte durch die Schaffung dieser Neuregelung gewährleistet werden. Die Möglichkeit der Inanspruchnahme des Papamonats forcierte somit in seiner Gesamtheit vor allem eine weitere Verringerung der Doppelbelastung durch Beruf und Privatleben.39 Ebenfalls vom Initiativantrag umfasst war eine entsprechende Änderung bzw Erweiterung des LAG. Diese gesonderte Änderung rührt daher, dass Land- und Forstarbeiter40 vom Geltungsbereich des VKG nicht erfasst sind. Doch auch diesen AN sollte laut Initiativantrag ein gleichwertiger Anspruch – gleich dem des § 1a VKG – zur Verfügung stehen.41 Am 2.7.2019 konnte man sich auf eine übereinstimmende Initiative einigen.42 Die Kundmachung erfolgte daraufhin am 31.7.2019.43 (b) Inkrafttreten Die Regelung nach § 1a VKG trat nach § 14 Abs 19 VKG am 1.9.2019 in Kraft. Umfasst sind dem Gesetzeslaut nach zunächst all jene Geburten, bei denen zwischen dem Stichtag des Inkrafttretens und dem (voraussichtlichen) Geburtstermin drei Monate verstrichen sind.44 Für jene Geburten, welche nach Inkrafttreten erfolgten und deren Termin innerhalb der dreimonatigen Vorankündigungsfrist lag, ergab sich eine Verkürzung der Meldefrist beim AG um eben jene Zeitspanne.45 Reissner befürwortete hier sogar die Möglichkeit einer Vorankündigung bereits vor Inkrafttreten der Regelung, frühestens jedoch zum 1.8.2019 – am auf die Publikation des § 1a VKG im BGBl folgenden Tag.46 39 Vgl 576/A 26. GP Erläut 5. 40 Vgl III. B. 3. Ausnahmen vom Geltungsbereich. 41 Vgl 576/A 26. GP Erläut 5. 42 Vgl https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2019/PK0757/#XXVI_A_00576 (abgefragt am 4.4.2020). 43 Vgl VKG BGBl I 2019/73. 44 Vgl Ercher-Lederer, Rechtsanspruch auf Papamonat, ASoK 2019, 314. 45 Vgl Ercher-Lederer, ASoK 2019, 314. 46 Vgl Reissner, ASoK 2019, 282 (297). 14. Juli 2020 19/79
Dies wird nun im Folgenden zum Zwecke der Veranschaulichung anhand von drei Bsp illustriert.47 Bsp 1 Errechneter Geburtstermin: 1.12.2019 Inkrafttreten/Vorankündigung: 1.9.2019 Hier wurde die Frist zur Vorankündigung eingehalten, da zwischen Inkrafttreten/Vorankündigung und dem errechneten Geburtstermin drei Monate verstreichen konnten. Bsp 2 Errechneter Geburtstermin: 30.11.2019 Inkrafttreten/Vorankündigung: 1.9.2019 Hier wurde die grundsätzlich geltende Frist zur Vorankündigung von drei Monaten unterschritten, da der errechnete Geburtstermin innerhalb der Frist, aber nach Inkrafttreten der Regelung liegt. Eine rechtzeitige Vorankündigung war dem AN in diesem Bsp nicht möglich. Dies schadet dem Anspruch nach § 1a VKG im konkreten Fall nicht.48 Bsp 3 Errechneter Geburtstermin: 31.8.2019 Inkrafttreten: 1.9.2019 Für Geburten vor dem 1.9.2019 – also vor Kundmachung – konnte kein Anspruch nach § 1a VKG geltend gemacht werden. Es bestand jedoch auch hier die Möglichkeit, mithilfe der Vereinbarung eines unbezahlten Urlaubs49 bzw mittels kollektivvertraglicher Regelung eine Väterfrühkarenz50 zu erwirken, um in den ersten Lebenswochen zuhause bei Mutter und Kind zu bleiben. 47 Vgl für weiterführende Beispiele Reissner, ASoK 2019, 282 (297). 48 Anm: Folgt man der Auffassung Reissners wäre hier auch eine Meldung am 31.8.19 unter Einhaltung der Frist denkbar gewesen. 49 Vgl IV. A. 3. a) (2) Vereinbarter Papamonat. 50 Vgl IV. A. 3. a) (3) Anspruch auf Väterfrühkarenz. 14. Juli 2020 20/79
(3) Anspruchsgrundlage und Anspruchsvoraussetzungen Die Anspruchsgrundlage für die Freistellung anlässlich der Geburt eines Kindes bildet § 1a VKG. Der Papamonat dient vorwiegend einer verstärkten Kinderbetreuung (durch den Vater) und wird auch nur auf Verlangen51 des jeweiligen AN gewährt.52 Aus dieser Zweckgebundenheit ist der gemeinsame Haushalt mit dem Kind die wichtigste Voraussetzung für den Anspruch nach § 1a VKG.53 § 1a VKG stellt hierbei auf einen schlichten gemeinsamen Haushalt ab, was das Bestehen einer tatsächlichen Wohngemeinschaft meint. Dies wird angenommen, wenn ein gemeinsames Wohnen und Wirtschaften gegeben ist.54 Dementsprechend kann ein Papamonat grundsätzlich erst nach Eintreffen55 des Kindes im gemeinsamen Haushalt beansprucht werden. Kommt es in der Folge – nachdem der gemeinsame Haushalt bereits begründet wurde – zu kürzeren Unterbrechungen56 der Wohngemeinschaft, schadet dies dem Anspruch grundsätzlich nicht.57 Der Anspruch nach § 1a VKG ist des Weiteren an die (Lebend-)Geburt eines Kindes gebunden. Hierbei gilt es, sich an den Begrifflichkeiten des MSchG zu orientieren. Im Falle eines Schwangerschaftsabbruchs oder einer Fehlgeburt entfällt der Anspruch auf Freistellung nach § 1a VKG. Schwieriger stellt sich die Beurteilung einer Totgeburt dar, welche zumindest vom gynäkologischen Standpunkt aus eine Geburt darstellt und in Folge auch einen Mutterschutz auslöst. Da aufgrund einer Totgeburt jedoch kein gemeinsamer Haushalt entstehen kann und der tatsächliche Zweck des Papamonats somit nicht erfüllt werden kann, besteht auch hier kein Anspruch auf Freistellung.58 Handelt es sich um eine Lebendgeburt und verstirbt das Kind unmittelbar nach der Entbindung noch im Krankenhaus, kommt der Anspruch nach § 1a VKG ebenfalls nicht zum Tragen, da auch hier noch kein gemeinsamer Haushalt begründet wurde.59 Erreicht das Kind hingegen lebend den gemeinsamen Haushalt und verstirbt während der 51 Anm: einseitiges Gestaltungsrecht. 52 Vgl Bleyer/Lindmayr/Sabara, Personalrecht und Betriebswichtiges 202022 (2020) Rz 502a. 53 Vgl Schmadl, "Papamonat", ZAS 2019/61, 334. 54 Vgl Kurzböck, ARD 6687/5/2020. 55 Vgl IV. A. 6. a) Krankenhausaufenthalt des Kindes (unmittelbar) nach der Geburt. 56 Anm: Großeltern besuchen, Untersuchung im Krankenhaus, Spitalsaufenthalt etc. 57 Vgl Kurzböck, ARD 6687/5/2020. 58 Reissner, ASoK 2019, 282 (285). 59 Vgl Reissner, ASoK 2019, 282 (285 f). 14. Juli 2020 21/79
Konsumation der Freistellung, stellt dies einen nachträglichen Wegfall einer der Voraussetzungen dar und führt zu einem vorzeitigen Ende der Freistellung.60 In all diesen Fällen greifen in Folge des Verlustes regelmäßig andere Dienstverhinderungsgründe.61 (4) Lage und Dauer der Freistellung nach § 1a Abs 1, 2 und 4 VKG Im Folgenden werden die zeitlichen Aspekte hinsichtlich Dauer und Lage der Freistellung näher untersucht und im Anschluss zum besseren Verständnis anhand von Beispielen ausgeführt. Im weiteren Verlauf wird überdies die vorzeitige Beendigung des Papamonats durch den Wegfall des gemeinsamen Haushalts behandelt. (a) Lage der Freistellung nach § 1a Abs 1, 2 und 4 VKG Trotz Wahlmöglichkeit des Vaters hinsichtlich des Zeitpunktes der Freistellung gegenüber dem AG, ist dieser in Bezug auf Beginn und Ende des Papamonats bei der Ausübung seines Anspruchs an strikte gesetzlich normierte Grenzen gebunden. Der frühestmögliche Zeitpunkt zur Inanspruchnahme des Papamonats fällt nach § 1a Abs 4 VKG auf den der Geburt folgenden Tag.62 Bezüglich des Endtermins gilt es durch die Anknüpfung an das Beschäftigungsverbot der Mutter nach § 5 MSchG zu unterscheiden. Gewöhnlich endet das absolute Beschäftigungsverbot der Mutter acht Wochen nach der Entbindung. Liegt eine Früh-, Mehrlings- oder Kaiserschnittentbindung vor, verlängert sich dieser Zeitraum um weitere vier Wochen auf insgesamt zwölf Wochen.63 Wurde das Beschäftigungsverbot der Mutter vor der Geburt verkürzt, erhöht sich dieses nach der Geburt um die entsprechende Dauer bis hin zu maximal 16 Wochen. Hat die Mutter aufgrund fehlender Erwerbstätigkeit kein tatsächliches Beschäftigungsverbot, wird ein fiktives Verbot im gleichen Ausmaß angesetzt. In diesem Fall beträgt das Höchstausmaß zwölf Wochen, da eine vorherige Verkürzung in Ermangelung eines Arbeitsverhältnisses grundsätzlich nicht vorliegen kann. In Ausnahmefällen kann nach § 1a Abs 2 VKG der Bezug von Wochengeldes iSd § 102a GSVG oder § 98 BSVG dennoch zu einer Verkürzung im Vorhinein führen. Dies würde eine Verlängerung des 60 Vgl Reissner, ASoK 2019, 282 (286). 61 Vgl Reissner, ASoK 2019, 282 (286). 62 Vgl Rauch in Rauch, ASoK-Spezial Arbeitsrecht 2020 (2020), 9. 63 Vgl Rauch in Rauch, ASoK-Spezial, 9. 14. Juli 2020 22/79
fiktiven Beschäftigungsverbots nach der Entbindung nach sich ziehen. Auch diese Verlängerung ist mit einer Dauer von insgesamt maximal 16 Wochen gedeckelt.64 In diesem Zusammenhang ist auch festzuhalten, dass die Freistellung nach § 1a VKG in einem Stück zu konsumieren ist. Eine tage- oder wochenweise Stückelung des Zeitraums ist im Gesetz nicht vorgesehen und würde darüber hinaus auch den Verlust der finanziellen Unterstützung durch den Familienzeitbonus nach sich ziehen.65 (b) Dauer der Freistellung nach § 1a Abs 1 VKG In § 1a Abs 1 VKG regelt das Gesetz die exakte Dauer des Anspruchs auf Freistellung mit einem Monat. Hierbei wird auf den so genannten Naturalmonat66 abgestellt. Kurzböck verneint – im Gegensatz zu Reissner – aufgrund der konkreten Formulierung im Gesetz die Möglichkeit einer Verkürzung dieses Zeitraums.67 Reissner führt als Gegenposition die Unabhängigkeit von arbeits- und sozialrechtlichen Ansprüchen an. So verliert der Vater zwar unter Umständen seinen Anspruch auf Familienzeitbonus durch eine Verkürzung der Dauer, doch berührt dies – nach seiner Auffassung – den arbeitsrechtlichen Anspruch auf Freistellung nicht.68 Der Naturalmonat läuft bei Beginn mit Monatsersten bis zum Monatsletzten. Liegen Anfangs- und Enddatum nicht im selben Monat kommt es – ausgehend vom Anfangsdatum – zum Abzug eines Tages im Folgemonat.69 Dies wird nun im Folgenden zum Zwecke der Veranschaulichung anhand von drei Bsp illustriert.70 Bsp 1 Anfangsdatum: 1.5. Enddatum: 31.5. Bsp 2 Anfangsdatum: 14.5. 64 Vgl Reissner, ASoK 2019, 282 (288). 65 Vgl Schmadl, ZAS 2019/61, 334. 66 Anm: 28 bis 31 Tage – je nach Monat; vgl zum Begriff des Naturalmonats Kurzböck, ARD 6687/5/2020. 67 Vgl Kurzböck, ARD 6687/5/2020. 68 Vgl Reissner, ASoK 2019, 282 (288); vgl IV. A. 4. b) (1) Allgemeines. 69 Vgl Kurzböck, ARD 6687/5/2020. 70 Vgl für weiterführende Beispiele Reissner, ASoK 2019, 282 (288). 14. Juli 2020 23/79
Enddatum: 13.6.
Bsp 3
Anfangsdatum: 31.1.
Enddatum (Schaltjahr): 29.2.
Enddatum (kein Schaltjahr): 28.2.
(c) Nachträglicher Wegfall der Voraussetzungen bzw des Anspruchs nach
§ 1a Abs 7 VKG
Wie bereits dargelegt, stellt für die Konsumation des Anspruch nach § 1a VKG ein
gemeinsamer Haushalt mit dem Kind eine der maßgeblichen Voraussetzungen dar.
§ 1a Abs 7 VKG verweist bei einem nachträglichen Wegfall dieses Erfordernisses auf
§ 2 Abs 7 und 8 VKG.
Fällt nun der gemeinsame Haushalt während der Inanspruchnahme der Freistellung weg,
obliegt es dem AN, den AG davon in Kenntnis zu setzen. Der AG hat anschließend ein
Wahlrecht. Ihm steht es offen, den AN entweder unter Auflösung des Papamonats zur
Wiederaufnahme seiner Arbeit aufzufordern oder die Freistellung wie bisher
weiterlaufen zu lassen.71
Entschließt sich der AG, die Freistellung weiterlaufen zu lassen, kann der AN seine Arbeit
nicht selbstständig wieder aufnehmen und gilt für den betreffenden Zeitraum als
arbeitslos. Infolgedessen besteht bei Erfüllung der sonstigen Voraussetzungen ein
Anspruch auf Arbeitslosengeld nach § 12 Abs 7 AlVG.72
Liegt kein dauernder Wegfall des gemeinsamen Haushalts vor, entfällt folgerichtig auch
die Wahlmöglichkeit des AG und der Papamonat bleibt unverändert aufrecht. 73
(5) Mitteilungspflichten des AN nach § 1a Abs 3 VKG
Im Folgenden werden sowohl die Mitteilungspflichten des AN als auch die
Konsequenzen bei Verabsäumung dieser näher erläutert.
71 Vgl Wolfsgruber-Ecker in Neumayr/Reissner, ZellKomm3 § 2 VKG Rz 16 (Stand 1.1.2018, rdb.at).
72 Vgl Wolfsgruber-Ecker in Neumayr/Reissner, ZellKomm3 § 2 VKG Rz 18.
73 Vgl Wolfsgruber-Ecker in Neumayr/Reissner, ZellKomm3 § 2 VKG Rz 17.
14. Juli 2020 24/79(a) Allgemeines Um einen Papamonat ordnungsgemäß in Anspruch nehmen zu können, gilt es hinsichtlich der Mitteilungspflichten des AN zwischen Vorankündigung74, Meldung der Geburt und Meldung des tatsächlichen Antrittstermins75 zu differenzieren. Es handelt sich somit um drei unterschiedliche Meldepflichten des AN, welchen er jeweils innerhalb der vorgesehenen Frist nachzukommen hat.76 Spätestens drei Monate vor dem errechneten Geburtstermin hat der AN den AG über den beabsichtigten Antritt des Papamonats in Form einer Vorankündigung nach § 1a Abs 3 VKG zu unterrichten. Diese erste Meldung muss neben der Bekanntgabe des zu diesem Zeitpunkt anzunehmenden Geburtstermins auch einen vorläufigen Antrittstermin enthalten. Der AN kann hierbei innerhalb der gesetzlichen Grenzen hinsichtlich Dauer und Lage des Papamonats den Beginn der Freistellung unabhängig von etwaigen Wünschen des AG frei wählen.77 Weiters muss der Beginn zu diesem Zeitpunkt noch nicht exakt terminisiert werden. Es ist anzunehmen, dass eine vorerst lediglich allgemeine Formulierung78 als ausreichend anzusehen ist.79 Handelt es sich um eine Frühgeburt, welche eine zeitgerechte Vorankündigung unmöglich macht, schadet dies dem Anspruch § 1a VKG nicht, da diese in solchen Fällen unterbleiben kann. Die übrigen Meldepflichten bleiben davon allerdings unberührt.80 Die zweite Mitteilungspflicht bezieht sich auf die Geburt des Kindes, welche der AN dem AG unverzüglich anzuzeigen hat.81 In weiterer Folge hat der AN in einer dritten Etappe erneut eine Woche Zeit, um den genauen Termin des Antrittszeitpunktes dem AG in einer weiteren Meldung bekannt zu geben. Da der in der Vorankündigung genannte Termin lediglich als Orientierungshilfe dient, müssen diese beiden Daten82 nicht übereinstimmen. Diese Fristen gelten wiederum auch für all jene Väter, bei denen die Vorankündigung in Folge einer Frühgeburt nicht eingehalten werden konnte.83 74 Vgl VII. D. Vorankündigung des Papamonats (Formular AK). 75 Vgl VII. E. Meldung des Papamonats (Formular AK). 76 Vgl Kronberger/Kraft, 10 Fragen und Antworten zum Papamonat, BÖB 2019, 40. 77 Vgl Lindmayr, Rechtsanspruch auf Papamonat - BGBl, ARD 6660/16/2019. 78 Anm: bspw „nach Ende des medizinisch indizierten Krankenhausaufenthalts“. 79 Vgl Kurzböck, ARD 6687/5/2020. 80 Vgl Kurzböck, ARD 6687/5/2020. 81 Vgl Kurzböck, ARD 6687/5/2020. 82 Anm: das in der Vorankündigung genannte Datum und das der Meldung des Antritts. 83 Vgl Kurzböck, ARD 6687/5/2020. 14. Juli 2020 25/79
Weder die Vorankündigung84 noch die Mitteilung über Geburt bzw die darauffolgende Mitteilung über den tatsächlichen Antrittszeitpunkt bedürfen der Schriftform. Es empfiehlt sich dennoch zu Beweiszwecken eine schriftliche Ausführung zu wählen.85 Dies wird nun im Folgenden zum Zwecke der Veranschaulichung anhand von zwei Bsp illustriert.86 Bsp 1 Errechneter/Tatsächlicher Geburtstermin: 20.7. Die Vorankündigung hat spätestens mit dem 20.4. zu erfolgen. Der AN hat am 20.7. die Geburt des Kindes ohne Aufschub dem AG bekanntzugeben. Innerhalb einer Woche nach der Geburt – spätestens am 27.7. – muss der AN dem AG den tatsächlichen Antrittszeitpunkt mitteilen. Bsp 2 Errechneter Geburtstermin: 20.7. Tatsächlicher Geburtstermin: 15.4. Im Falle einer „extremen“ Frühgeburt kann die Voranmeldung, sofern sie noch nicht stattgefunden hat, unterbleiben. Von der Geburt des Kindes ist der AG dennoch am 15.4. unverzüglich zu unterrichten. Innerhalb einer Woche nach der Geburt – spätestens am 22.4. – muss der AN den tatsächlichen Antrittszeitpunkt melden. (b) Versäumnis der Mitteilungspflichten durch den AN nach § 1a Abs 3 VKG Wie im vorherigen Abschnitt bereits dargelegt, treffen den AN – um den Anspruch ordnungsgemäß geltend zu machen – drei unterschiedliche Mitteilungspflichten. Unterbleibt auch nur eine dieser drei Meldungen zu einem fristwahrenden Zeitpunkt, so verliert der AN seinen Anspruch nach § 1a VKG.87 Nicht davon betroffen ist jedoch eine freiwillige zwischen AG und AN getroffene Vereinbarung nach § 1a Abs 3 VKG, welche bei Einigung in Folge wie eine gesetzliche 84 Vgl Kurzböck, ARD 6687/5/2020. 85 Vgl Kurzböck, ARD 6687/5/2020. 86 Vgl für weiterführende Beispiele Kurzböck, ARD 6687/5/2020. 87 Vgl Kurzböck, ARD 6687/5/2020. 14. Juli 2020 26/79
Inanspruchnahme zu betrachten ist. Dies erstreckt sich konsequenterweise auch auf sämtliche sonstige Rechtsfolgen des Anspruchs nach § 1a VKG. Eine Ausnahme gilt im Übrigen auch für mögliche kollektivvertragliche Ansprüche, welche unter Umständen günstiger als das Gesetz gefasst sein können. Diese werden von einer nicht rechtzeitig durchgeführten Meldung nicht berührt. In Kollektivverträgen können jedoch eigene Fristen vorgesehen sein.88 (6) Verhältnis zu anderen Ansprüchen Im Folgenden wird das Verhältnis des Papamonats zur Dienstfreistellung sowie zur Verhinderungskarenz dargestellt. Sowohl die Dienstfreistellung als auch die Verhinderungskarenz stellen selbstständige Ansprüche dar, welche grundsätzlich eigenständig neben dem Anspruch nach § 1a VKG entstehen können. (a) Papamonat und Dienstfreistellung nach § 1a Abs 4 VKG Nach § 1a Abs 4 VKG sind gesetzliche, kollektivvertragliche oder auch einzelvertragliche Ansprüche89 auf Dienstfreistellung nicht auf die Freistellung nach § 1a VKG anzurechnen. In Frage kommen hier die gesetzlichen Ansprüche auf Dienstfreistellung nach § 8 Abs 3 AngG, § 1154b Abs 5 ABGB sowie die Pflegefreistellung nach § 16 UrlG als lex specialis.90 Im Falle von § 8 Abs 3 AngG liegt eine Verhinderung, aus anderen wichtigen, die Person des AN betreffenden, Gründen vor. Dabei handelt es sich vorrangig um eine Kollision mit höherrangigen Pflichten, deren Ursprung oft innerhalb der Familie begründet sind.91 § 1154b Abs 5 ABGB ist die entsprechende Generalklausel für all jene AN, die nicht in den Anwendungsbereich des AngG fallen.92 Sowohl der Anspruch auf Freistellung nach § 8 Abs 3 AngG als auch der Anspruch nach § 1154b Abs 5 ABGB begründet eine Entgeltfortzahlungspflicht93 durch den AG. KollV und Einzelverträge können diese gesetzlichen Regelungen zudem näher ausgestalten oder aber auch für den AN günstigere Bedingungen schaffen.94 88 Vgl Kurzböck, ARD 6687/5/2020. 89 Anm: keine Erwähnung im Gesetz finden die Betriebsvereinbarungen. Nach Auffassung Reissners sind diese per analogiam dennoch miteinzubeziehen. 90 Vgl Reissner, ASoK 2019, 282 (292). 91 Vgl Holzer in Marhold/Burgstaller/Preyer, Kommentar zum Angestelltengesetz § 8 Rz 39 (Stand 1.10.2013, rdb.at). 92 Vgl Krejci in Rummel, ABGB - Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch3 § 1154b ABGB Rz 32 (Stand 1.1.2000, rdb.at). 93 Anm: dies kann zum Verlust des sozialrechtlichen Anspruchs auf Familienzeitbonus führen. 94 Vgl Reissner, ASoK 2019, 282 (292). 14. Juli 2020 27/79
Sie können auch lesen