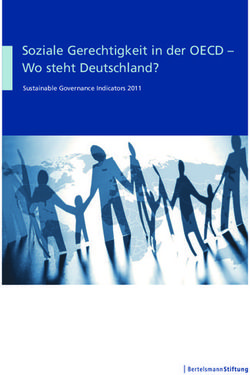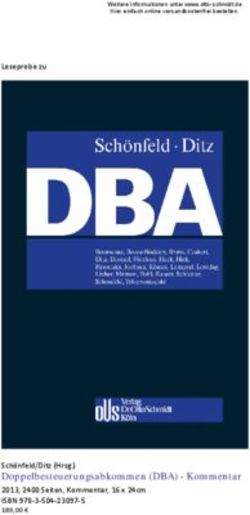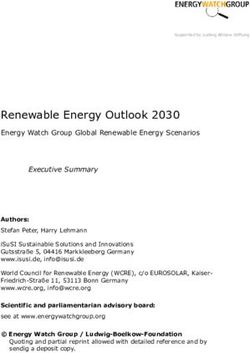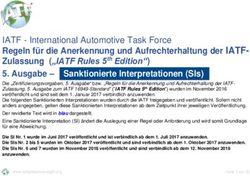Gesamtbeurteilung der Wirtschaftslage - OECD.org
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
OECD-Wirtschaftsausblick
Ausgabe 2018/1
© OECD 2018
Kapitel 1
Gesamtbeurteilung
der Wirtschaftslage
91. GESAMTBEURTEILUNG DER WIRTSCHAFTSLAGE
Einleitung
Die Expansion wird sich in den nächsten zwei Jahren voraussichtlich fortsetzen,
wobei das globale BIP 2018 und 2019 den Projektionen zufolge um fast 4% wachsen wird.
Im OECD-Raum dürfte das Wachstum unter dem Einfluss der in vielen Volkswirtschaften
durchgeführten fiskalpolitischen Lockerung bei rd. 2½% pro Jahr verharren, während es
andernorts auf fast 5% anziehen dürfte (Tabelle 1.1). Obwohl das Beschäftigungswachstum
in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften wahrscheinlich nachlassen wird, dürfte die
Arbeitslosenquote im OECD-Raum auf den niedrigsten Stand seit 1980 zurückgehen, was
die Arbeitskräfteengpässe in einigen Ländern verschärfen dürfte. In den Projektionen
wird dementsprechend von einem Anstieg des Lohn- und Preisauftriebs ausgegangen, der
Table 1.1. Global growth is set to remain close to 4% in the next two years
OECD area, unless noted otherwise
Average 2017 2018 2019
2010-2017 2016 2017 2018 2019 Q4 Q4 Q4
Per cent
Real GDP growth1
World2 3.5 3.1 3.7 3.8 3.9 3.8 3.9 3.9
G202 3.7 3.2 3.8 4.0 4.1 4.1 4.1 4.0
OECD2,8 2.0 1.8 2.5 2.6 2.5 2.7 2.5 2.4
United States 2.1 1.5 2.3 2.9 2.8 2.6 2.8 2.7
Euro area8 1.1 1.7 2.5 2.2 2.1 2.8 2.0 2.0
Japan 1.1 1.0 1.7 1.2 1.2 1.8 1.3 0.6
Non-OECD2 4.8 4.2 4.6 4.8 5.1 4.7 5.0 5.1
China 7.6 6.7 6.9 6.7 6.4 6.9 6.6 6.3
India3 6.8 7.1 6.5 7.4 7.5
Brazil 0.4 -3.5 1.0 2.0 2.8
Output gap4 -2.0 -1.5 -0.7 0.1 0.6
Unemployment rate5 7.3 6.3 5.8 5.4 5.1 5.5 5.3 5.1
Inflation1,6 1.6 1.1 2.0 2.2 2.3 1.9 2.3 2.4
Fiscal balance7 -4.6 -2.9 -2.0 -2.6 -2.7
World real trade growth1 4.0 2.6 5.0 4.7 4.5 4.7 4.6 4.4
1. Percentage changes; last three columns show the increase over a year earlier.
2. Moving nominal GDP weights, using purchasing power parities.
3. Fiscal year.
4. Per cent of potential GDP.
5. Per cent of labour force.
6. Private consumption deflator.
7. Per cent of GDP.
8. With growth in Ireland computed using gross value added at constant prices excluding foreign-owned multinational
enterprise dominated sectors.
Source: OECD Economic Outlook 103 database.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933729097
OECD-WIRTSCHAFTSAUSBLICK, AUSGABE 2018/1 © OECD 2018 – VORLÄUFIGE AUSGABE
101. GESAMTBEURTEILUNG DER WIRTSCHAFTSLAGE
allerdings nur schwach ausfallen dürfte, weil Spannungen bei den Produktionsfaktoren in
den letzten Jahren offenbar nur einen gedämpften Effekt auf die Inflation ausübten und
in einigen Volkswirtschaften Spielraum besteht, die Erwerbsbeteiligung und die Zahl der
geleisteten Arbeitsstunden zu erhöhen. Die globale Investitions- und Handelstätigkeit hat
sich im letzten Jahr erholt und wird den Projektionen zufolge in den kommenden zwei
Jahren weiter stetig expandieren, sofern die Handelsspannungen nicht weiter eskalieren. Die
mittelfristigen Aussichten auf einen starken, anhaltenden Anstieg des Lebensstandards sind
jedoch sowohl in den fortgeschrittenen als auch in den aufstrebenden Volkswirtschaften
nach wie vor schlechter als vor der Krise, was auf weniger günstige demografische Trends und
die Auswirkungen der unterdurchschnittlichen Investitions- und Produktivitätsentwicklung
der letzten zehn Jahre auf das Wachstumspotenzial zurückzuführen ist.
Der kurzfristige Ausblick bleibt zwar günstig, die Abwärtsrisiken überwiegen jedoch.
Die projizierte globale Wachstumsrate von nahezu 4% entspricht zwar der langfristigen
Durchschnittsrate der Zeit vor der Krise, die derzeitige Expansion stützt sich allerdings
nach wie vor auf die in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften verfolgte überaus akkom-
modierende Geldpolitik sowie – zunehmend – auf eine Lockerung der Fiskalpolitik. Dies deutet
darauf hin, dass sich noch kein kräftiges selbsttragendes Wachstum eingestellt hat. Der
Handelsprotektionismus hat bereits das Vertrauen zu schwächen begonnen, und eine weitere
Eskalation würde sich negativ auf Investitionstätigkeit, Arbeitsplätze und Lebensstandard
auswirken. Geopolitische Unsicherheit hat in den letzten Wochen zu einem erheblichen
weiteren Anstieg der Ölpreise beigetragen; falls diese Entwicklung andauert, würden die
höheren Ölpreise den Inflationsdruck verstärken und das Wachstum der Realeinkommen
der privaten Haushalte bremsen. Auch Europa ist nach wie vor von geopolitischen Risiken
betroffen, und die Anleihespreads haben sich im Euroraum in letzter Zeit ausgeweitet.
Außerdem besteht weiterhin das Risiko, dass die in einigen Volkswirtschaften eingeleitete
Normalisierung der Zinssätze – vor allem, wenn sie schnell voranschreitet und mit einer
starken Aufwertung des US-Dollar einhergeht – weitere Anfälligkeiten und Spannungen
an den Finanzmärkten zutage treten lässt, die durch eine überhöhte Risikobereitschaft
und hohe Verschuldung entstanden sind. In einigen aufstrebenden Volkswirtschaften
sind unter dem Einfluss höherer Zinsen auf US-Staatsanleihen und einer Aufwertung des
US-Dollar bereits Spannungen an den Finanzmärkten aufgetreten, insbesondere in Ländern
mit großen und steigenden binnen- und außenwirtschaftlichen Ungleichgewichten oder
einer beträchtlichen in US-Dollar denominierten Auslandsverschuldung.
Vor dem Hintergrund der anziehenden Weltkonjunktur muss die Politik das Augen-
merk darauf richten, eine robustere und widerstandsfähigere Erholung von Produk-
tivität, Investitionstätigkeit und Lebensstandard sicherzustellen. In den großen fort-
geschrittenen Volkswirtschaften muss die Geldpolitik allmählich normalisiert werden,
allerdings in unterschiedlichem Ausmaß. Eine kontinuierliche, klare Kommunikation
über den Normalisierungspfad ist von entscheidender Bedeutung, um das Risiko von
Finanzmarktstörungen so weit wie möglich zu begrenzen. Erforderlich ist auch eine aktive
und zeitnahe Umsetzung prudenzieller und aufsichtsrechtlicher Maßnahmen, um sowohl in
den fortgeschrittenen als auch in den aufstrebenden Volkswirtschaften eine Verschärfung der
von finanziellen Anfälligkeiten ausgehenden Risiken zu verhindern. In der Fiskalpolitik sollte
eine zu stark prozyklische Ausrichtung vermieden und der Fokus eindeutig auf Maßnahmen
gelegt werden, die helfen, das mittelfristige Wachstum zu stärken, und die sicherstellen,
dass die Erholung möglichst weiten Teilen der Bevölkerung zugutekommt. Da sich die
Staatsverschuldung und die Haushaltsdefizite vieler Länder auf hohem Niveau bewegen
und die Reaktionsmöglichkeiten im Fall des Eintretens schwerwiegender Abwärtsrisiken
begrenzt sind, sollte aus einem kräftigeren Wachstum resultierender Spielraum genutzt
OECD-WIRTSCHAFTSAUSBLICK, AUSGABE 2018/1 © OECD 2018 – VORLÄUFIGE AUSGABE
111. GESAMTBEURTEILUNG DER WIRTSCHAFTSLAGE
werden, um neue Finanzpuffer aufzubauen. Sowohl in den fortgeschrittenen als auch in
den aufstrebenden Volkswirtschaften sollten die Strukturreformen wieder vorangetrieben
werden, um das Wachstum zu stützen und sicherzustellen, dass es breiteren Teilen der
Bevölkerung zugutekommt. Der derzeitige – mit starken Beschäftigungszuwächsen
verbundene – Aufschwung bietet eine gute Gelegenheit, die Strukturreformen zu beleben.
Günstige Konjunkturbedingungen helfen die Nutzeffekte von Reformen maximieren; werden
Reformanstrengungen hingegen in Krisenzeiten vorgenommen, wie dies häufig der Fall
ist, können die kurzfristigen Kosten steigen. Um eine Beeinträchtigung der langfristigen
Wachstumsaussichten zu verhindern, zu der es im Fall einer Abkehr von den offenen
Märkten käme, ist es äußerst wichtig, das regelbasierte internationale Handelssystem
zu wahren, eine Eskalation der Handelsspannungen zu vermeiden und die multilaterale
Zusammenarbeit zu stärken (vgl. Kapitel 2).
Konjunkturstützende Maßnahmen werden helfen, das globale Wachstum zu
stützen
Die globale Expansion ist weiterhin solide und breitbasiert, wenngleich sich das
globale BIP-Wachstum im ersten Quartal 2018 abgeschwächt hat (Abb. 1.1, Teil A).
Investitionstätigkeit und Handelswachstum haben angezogen und so zu einem breit
angelegten Beschäftigungsaufbau beigetragen. In den fortgeschrittenen Volkswirtschaften
wird die Konjunktur weiterhin durch fiskal- und geldpolitische Impulse gestützt, wobei
die Effekte der anhaltend akkommodierenden Geldpolitik in den meisten Ländern durch
eine Lockerung des fiskalpolitischen Kurses verstärkt werden. In den aufstrebenden Volks-
wirtschaften hat die Wirtschaftstätigkeit unter dem Einfluss des stärkeren Welthandels,
höherer Rohstoffpreise und erheblicher Infrastrukturinvestitionen in China und anderen
asiatischen Volkswirtschaften ebenfalls angezogen. Die finanziellen Rahmenbedingungen
wirken nach wie vor weitgehend konjunkturstützend, sind in den letzten Monaten jedoch
restriktiver geworden (siehe weiter unten), was auf einen Rückgang der Aktienkurse gegen-
über den zuvor erreichten hohen Spitzenwerten, steigende langfristige Zinsen und einen
Anstieg der Volatilität gegenüber dem ungewöhnlich niedrigen Niveau der letzten Jahre
zurückzuführen ist. Einige aufstrebende Volkswirtschaften sind seit kurzem mit zuneh-
menden Spannungen an den Finanzmärkten konfrontiert, insbesondere Länder mit großen
und steigenden binnen- und außenwirtschaftlichen Ungleichgewichten oder einer beträcht-
lichen in US-Dollar denominierten Verschuldung (siehe weiter unten).
Die Ölpreise sind vor kurzem auf rd. 80 USD pro Barrel gestiegen, womit sie rd. 15%
höher sind als zu Beginn des Jahres und 25 USD pro Barrel über dem Durchschnittswert
von 2017 liegen. Maßgeblich für diesen Anstieg, zu dem es trotz der kräftigen Ölförderung
der Vereinigten Staaten gekommen ist, sind eine anhaltend robuste globale Nachfrage,
auf vereinbarte Förderbeschränkungen der OPEC und einiger Nicht-OPEC-Länder zurück-
zuführende Angebotsengpässe, erhebliche Förderrückgänge in Venezuela sowie die
Erwartung, dass das Angebot aus dem Iran durch geopolitische Spannungen begrenzt
wird1. In den im Folgenden dargelegten Projektionen wird unterstellt, dass die Ölpreise
im weiteren Jahresverlauf von 2018 und im Jahr 2019 bei 70 USD pro Barrel liegen werden
(Anhang A.1), was weitgehend mit den im Monatsverlauf bis Mitte Mai dieses Jahres notierten
durchschnittlichen Terminkontraktpreisen für 2019 in Einklang steht. Sollte der Anstieg
länger andauern, würde er ein erhebliches Abwärtsrisiko darstellen, das eine weitere
Zunahme der Gesamtinflation und einen Rückgang des Wachstums der Realeinkommen
in den ölimportierenden Ländern zur Folge hätte2.
OECD-WIRTSCHAFTSAUSBLICK, AUSGABE 2018/1 © OECD 2018 – VORLÄUFIGE AUSGABE
121. GESAMTBEURTEILUNG DER WIRTSCHAFTSLAGE
Figure 1.1. Global activity indicators have eased recently from robust levels
A. Global GDP growth B. New orders
% changes, a.r., PPP weights Normalised 3-month moving average
4.2 0.8
Composite PMI
Manufacturing export orders
4.0 0.6
3.8
0.4
3.6
0.2
3.4
-0.0
3.2
-0.2
3.0
2.8 -0.4
2.6 -0.6
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
C. Global industrial production growth D. Global retail sales volume growth
% changes, a.r. % changes, a.r.
Quarterly Year-on-year Quarterly Year-on-year
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
0 0
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Note: Data in Panel D are for retail sales in the majority of countries. Monthly household consumption is used for the United States and
the monthly synthetic consumption indicator is used for Japan. Data for India are included in Panel C, but are unavailable for Panel D.
The aggregations are based on purchasing power parity (PPP) weights.
Source: OECD Economic Outlook 103 database; OECD Main Economic Indicators database; Thomson Reuters; Markit; and OECD calculations.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933728546
Die jüngsten Kurzzeitindikatoren der weltweiten Konjunkturentwicklung liefern ein
uneinheitliches Bild, haben jedoch parallel zur Verlangsamung des BIP-Wachstums im
ersten Quartal 2018 allgemein nachgegeben (Abb. 1.1, Teil B-D). Das Geschäftsklima scheint
sich in den letzten Monaten insgesamt stabilisiert zu haben, einige Handelsindikatoren
wie die Exportaufträge und das Umschlagvolumen der großen Containerhäfen haben sich
jedoch weiter abgeschwächt. Die Verlangsamung des BIP-Wachstums im ersten Quartal des
Jahres konzentrierte sich großenteils auf die fortgeschrittenen Volkswirtschaften, vor allem
europäische Länder und Japan. Dies ist u.a. auf vorübergehende Faktoren, insbesondere
außergewöhnlich ungünstige Witterungsbedingungen, zurückzuführen. Die Besorgnis
über globale Handelsstörungen könnte jedoch zu Verunsicherung geführt haben, was die
Unternehmen möglicherweise dazu veranlasst hat, Investitionen aufzuschieben. Es ist auch
möglich, dass die höheren Ölpreise zur jüngsten Abschwächung der Verbraucherausgaben
beigetragen haben (Abb. 1.1, Teil D), indem sie die Gesamtinflation nach oben getrieben
OECD-WIRTSCHAFTSAUSBLICK, AUSGABE 2018/1 © OECD 2018 – VORLÄUFIGE AUSGABE
131. GESAMTBEURTEILUNG DER WIRTSCHAFTSLAGE
Figure 1.2. Global GDP growth is set to strengthen further in 2018-19
Contributions to global GDP growth
A. 2016-17 B. 2018-19
% pts % pts
0.5 3.9
4 4
0.5 3.35 0.45
0.15 0.55
3 0.5
3
1.25
1.2
2 2
0.45
0.45
1 1
0.25
0.25
0.45
0.3
0 0
United Euro Other China India Commodity Other World United Euro Other China India Commodity Other World
States area OECD producers non States area OECD producers non
OECD OECD
Note: Non-OECD commodity producers include Argentina, Brazil, Colombia, Indonesia, Russia, Saudi Arabia, South Africa and other
non-OECD oil-producing economies. Contributions have been rounded to the nearest 0.05.
Source: OECD Economic Outlook 103 database; and OECD calculations.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933728755
und das Wachstum der Realeinkommen der privaten Haushalte vorübergehend gebremst
haben. Diese Effekte klingen in den im Folgenden beschriebenen Projektionen rasch ab, nicht
zuletzt weil die makroökonomische Politik nach wie vor konjunkturstützend ausgerichtet
ist; sie stellen jedoch weiterhin erhebliche Abwärtsrisiken dar, insbesondere wenn die
geopolitischen Spannungen die Ölpreise weiter steigen lassen.
Das globale BIP-Wachstum wird den Projektionen zufolge trotz des schwachen Starts
einiger Länder ins Jahr 2018 sowohl 2018 als auch 2019 fast 4% erreichen, was durch das
stärkere Wachstum in den Vereinigten Staaten, Indien und den Rohstoffförderländern
bedingt ist (Abb. 1.2). Dadurch würde das globale Wachstum zwar wieder die in den beiden
Jahrzehnten vor der Krise verzeichneten Durchschnittsraten erreichen, ein erheblicher
Unterschied zu früheren Expansionsphasen besteht jedoch darin, dass die derzeitige
Expansion nach wie vor durch eine überaus akkommodierende Geld- und Fiskalpolitik
gestützt wird. Auf Pro-Kopf-Basis verbessert sich das Wachstum nun in der Mehrzahl der
OECD- und Nicht-OECD-Volkswirtschaften und hat in den meisten Ländern endlich wieder
das Vorkrisenniveau erreicht, die Folgen der Wachstumsschwäche der Jahre nach der Krise
sind jedoch immer noch nicht überwunden (Abb. 1.3). Die realen Pro-Kopf-Einkommen
werden den Projektionen zufolge 2019 im OECD-Raum insgesamt immer noch über 10%
niedriger sein, als sie wären, wenn sie seit 2007 mit der gleichen durchschnittlichen Jahres-
rate gestiegen wären wie in den beiden Jahrzehnten vor der Krise (Abb. 1.3, Teil B).
In den fortgeschrittenen Volkswirtschaften verbessern konjunkturstützende makro-
ökonomische Maßnahmen, ein kräftiges Beschäftigungswachstum und eine Erholung der
Investitionstätigkeit die Wachstumsaussichten, wobei das BIP-Wachstum im Durchschnitt
des Projektionszeitraums nahe bei 2½% pro Jahr liegen dürfte. Die fiskalische Lockerung
in den Vereinigten Staaten stützt die Investitionstätigkeit und das Produktionswachstum
im Zeitraum 2018-2019, im Jahr 2020 dürfte nach derzeitiger Gesetzeslage jedoch eine
fiskalische Straffung einsetzen, und eine höhere Staatsverschuldung wird die mittelfristigen
Herausforderungen vergrößern (Kasten 1.1). Steuersenkungen und Ausgabensteigerungen
könnten das BIP-Wachstum der Vereinigten Staaten sowohl in diesem als auch im näch-
OECD-WIRTSCHAFTSAUSBLICK, AUSGABE 2018/1 © OECD 2018 – VORLÄUFIGE AUSGABE
141. GESAMTBEURTEILUNG DER WIRTSCHAFTSLAGE
Figure 1.3. Per capita income growth has picked up in the OECD economies
A. GDP per capita growth¹ B. Evolution of OECD real GDP growth²
Average annual growth in period shown
% Index 1990 = 100
5 180
1990-2007 GDP per capita
2007-2016 Linear projection
2016-2019
4
160
3
140
2
120
1
0 100
OECD Non-OECD excl. China 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Non-OECD
1. The OECD and non-OECD aggregates are calculated with moving nominal GDP per capita weights using purchasing power parities.
The non-OECD aggregate is based on data for Argentina, Brazil, China, Colombia, Costa Rica, India, Indonesia, Lithuania, Russia, Saudi
Arabia, South Africa and the Dynamic Asian Economies (Chinese Taipei, Hong Kong - China, Malaysia, the Philippines, Singapore,
Thailand and Vietnam). The 1990-2007 data for the non-OECD excluding China refer to 1993-2007.
2. The dotted line shows a linear projection from 1990 based on the average annual growth rate of OECD GDP per capita in the 1990-2007 period.
Source: OECD Economic Outlook 103 database; UN database; and OECD calculations.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933728964
sten Jahr um ½-¾ Prozentpunkte erhöhen, womit es in beiden Jahren einen Wert von fast
3% erreichen würde. Davon gehen positive Nachfrageeffekte auf andere Volkswirtschaften
aus (Kasten 1.1), höhere Zinssätze in den Vereinigten Staaten und eine damit zusammen-
hängende Aufwertung des US-Dollar unter dem Einfluss eines sich ausweitenden Zins-
gefälles könnten in einigen Ländern, insbesondere in den aufstrebenden Volkswirtschaften,
jedoch Spannungen an den Finanzmärkten hervorrufen. Im Euroraum wird das Wachstum
im Zeitraum 2018-2019 mit 2-2¼% wahrscheinlich robust und breitbasiert bleiben, wobei
die in vielen europäischen Ländern, u.a. in Deutschland, erwartete zusätzliche fiskalpoli-
tische Lockerung die von der akkommodierenden Geldpolitik und der sich verbessernden
Arbeitsmarktlage ausgehenden Impulse verstärken dürfte. In Japan werden die im jüngsten
Nachtragshaushalt angekündigten zusätzlichen Ausgaben die Nachfrage im weiteren
Jahresverlauf von 2018 stützen, 2019 dürfte der fiskalische Gegenwind jedoch etwas stärker
werden.
In den Schwellen- und Entwicklungsländern scheinen die Wachstumsaussichten 2018
und 2019 insgesamt solide, dahinter verbergen sich jedoch unterschiedliche Entwicklungen
in den verschiedenen großen Volkswirtschaften. Nach einem starken Jahresbeginn 2018
dürfte sich das Wachstum in China langsam auf unter 6½% im Jahr 2019 abschwächen.
Das geld-, fiskal- und regulierungspolitische Umfeld wird allmählich restriktiver, da die
Fiskalpolitik jetzt weitgehend neutral ausgerichtet ist und die Kreditbedingungen weniger
expansiv sind; zudem geht die Erwerbsbevölkerung inzwischen zurück. In Indien dürfte ein
kräftiges Inlandsnachfragewachstum demgegenüber dazu beitragen, das BIP-Wachstum in
den Finanzjahren 2018 und 2019 auf rd. 7¼% bzw. 7½% zu erhöhen, wobei frühere Reformen
eine kräftige Belebung des Wachstums der privaten Investitionstätigkeit begünstigen
dürften. Auch in Indonesien und einigen dynamischen Volkswirtschaften Asiens wird das
Wachstum 2018-2019 wohl weiter durch kräftige Infrastrukturinvestitionen gestützt werden.
In einigen anderen Rohstoffförderländern, insbesondere Brasilien und Südafrika, werden
sich die Wachstumsergebnisse den Projektionen zufolge ebenfalls verbessern, wobei die
OECD-WIRTSCHAFTSAUSBLICK, AUSGABE 2018/1 © OECD 2018 – VORLÄUFIGE AUSGABE
151. GESAMTBEURTEILUNG DER WIRTSCHAFTSLAGE
Kasten 1.1 Beurteilung der Auswirkungen der fiskalpolitischen Änderungen
in den Vereinigten Staaten
Die Steuerreform in den Vereinigten Staaten (Tax Cuts and Jobs Act) und die Entscheidung des Kongresses,
die Ausgabenobergrenzen für die kommenden zwei Jahre anzuheben, bedeuten sowohl für 2018 als
auch für 2019 eine erhebliche Lockerung der Fiskalpolitik um rd. 1% des BIP. (In den Projektionen des
Wirtschaftsausblicks von November 2017 wurde im Vergleich dazu eine Lockerung in Höhe von 0,5% des BIP
im Jahr 2018 und eine unveränderte Politik im Jahr 2019 unterstellt.) In diesem Kasten werden die Effekte
dieser fiskalpolitischen Maßnahmen auf die Wachstumsaussichten beurteilt1.
z Zu den wichtigsten Steuermaßnahmen gehören eine dauerhafte Senkung des Körperschaftsteuersatzes
auf 21%, eine Senkung der Einkommensteuersätze, die 2025 ausläuft, und die Einführung einer voll-
ständigen Sofortabschreibung für den Zeitraum 2018-2022, die anschließend bis 2026 schrittweise
wieder aufgehoben wird. Durch diese Maßnahmen gehen die Vereinigten Staaten auch zu einem stärker
territorial ausgerichteten Steuersystem über, womit sie sich den Steuersystemen der meisten anderen
großen Volkswirtschaften annähern. Schätzungen des Congressional Budget Office zufolge werden
die direkten Kosten des Tax Cuts and Jobs Act das Defizit der US-Bundesregierung 2018 um rd. 0,7%
des BIP und 2019 um weitere 0,7% des BIP steigen lassen. Danach dürften die Auswirkungen auf das
jährliche Haushaltsdefizit bei Zugrundelegung der derzeitigen Gesetzeslage bis 2026-2027 auf nahe null
zurückgehen, was eine gewisse fiskalische Straffung in der ersten Hälfte der 2020er Jahre impliziert.
z Das neue Anfang Februar verabschiedete zweijährige Haushaltsgesetz sieht sowohl für 2018 als auch
für 2019 eine höhere Ausgabenobergrenze vor als zuvor erwartet. Die unterstellte Rücknahme dieser
zusätzlichen Ausgaben im Jahr 2020 verstärkt die fiskalische Straffung, die durch die in den nächsten
zehn Jahren (entsprechend den ex ante veranschlagten Kosten des Steuergesetzes) zu erwartenden
Steuererhöhungen impliziert ist.
Diese fiskalpolitischen Maßnahmen wurden folgendermaßen in das modellbasierte Szenario aufgenommen:
z Senkung des effektiven Körperschaftsteuersatzes um 8 Prozentpunkte im Jahr 2018 und 7 Prozent-
punkte im Jahr 2019, die anschließend langsam abklingt. Die dadurch verursachte Reduzierung der
Körperschaftsteuereinnahmen um rd. 0,5% des BIP im Jahr 2018 und 0,8% des BIP im Jahr 2019 approxi-
miert die Auswirkungen der Änderungen, die derzeit insgesamt am Körperschaftsteuer system vor-
genommen werden. In Bezug auf die sonstigen Steueränderungen wurde eine Senkung des effektiven
Einkommensteuersatzes unterstellt, durch die sich die Einnahmen bis 2019 um rd. 0,6% des BIP redu-
zieren, bevor dieser Effekt langsam abklingt.
z Für die Anhebung der Ausgabenobergrenzen wurde unterstellt, dass sie den Staatsverbrauch (gegen-
über dem Basisszenario) 2018 um 0,3% des BIP und 2019 um 0,6% des BIP steigen lässt.
Durch die kurzfristigen Auswirkungen der fiskalpolitischen Maßnahmen insgesamt erhöht sich das BIP-
Wachstum der Vereinigten Staaten den Schätzungen zufolge sowohl 2018 als auch 2019 um ½-¾ Prozent-
punkte (vgl. Abbildung). Dieser Impuls ist zu etwa zwei Dritteln auf den Gesamteffekt der Steueränderungen
zurückzuführen. Die Unternehmensinvestitionen steigen relativ rasch, was auf einen anhaltenden Rückgang
der Kapitalkosten um rd. 10% und die Erwartung künftiger Produktionssteigerungen zurückzuführen ist. Die
kräftigere Endnachfrage in den Vereinigten Staaten kurbelt auch das Importwachstum an und verschärft
die Spannungen am Arbeitsmarkt, so dass die Arbeitslosenquote 2018-2019 um ½ Prozentpunkt zurückgeht
und die Reallöhne bis 2019 um rd. 1% gegenüber dem Basisszenario steigen. Das starke Nachfragewachstum
in den Vereinigten Staaten begünstigt 2019 eine weitere Vergrößerung des US-amerikanischen Leistungs-
bilanzdefizits um rd. ¾% des BIP. Da sich die kurzfristig anziehende Konjunktur auf den Haushaltssaldo
auswirkt, liegt der Anstieg des Defizits 2019 insgesamt näher bei 1½% des BIP. Die Geldpolitik wird auf kurze
Sicht gestrafft, so dass die Leitzinsen 2019 um rd. ¾ Prozentpunkte höher liegen dürften als im Basisszenario,
was eine Aufwertung des effektiven Wechselkurses des US-Dollar zur Folge hat.
Andere Länder profitieren von der anziehenden Importnachfrage der Vereinigten Staaten (unter der
Annahme einer unveränderten Handelspolitik), insbesondere enge Handelspartner wie Kanada und
Mexiko. Dies wird jedoch teilweise dadurch ausgeglichen, dass die Geldpolitik in vielen Ländern aufgrund
der durch die Währungsabwertung gegenüber dem US-Dollar bedingten stärkeren Importpreisinflation
(Fortsetzung nächste Seite)
OECD-WIRTSCHAFTSAUSBLICK, AUSGABE 2018/1 © OECD 2018 – VORLÄUFIGE AUSGABE
161. GESAMTBEURTEILUNG DER WIRTSCHAFTSLAGE
(Fortsetzung)
The US fiscal stimulus is set to strengthen short-term GDP growth
Difference from baseline, percentage points
% pts % pts
0.8 0.8
2018 2019
0.7 0.7
0.6 0.6
0.5 0.5
0.4 0.4
0.3 0.3
0.2 0.2
0.1 0.1
0.0 0.0
United States Mexico Korea Euro area
G20 Canada BRIICS
Source: OECD calculations.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933728508
etwas straffer ausgerichtet wird, als dies sonst der Fall wäre, was die Spannungen an den Finanzmärkten,
mit denen einige Volkswirtschaften derzeit konfrontiert sind, verschärft.
Das in der Analyse unterstellte zukunftsgerichtete Verhalten begrenzt den kurzfristigen Impuls auf die
gesamtwirtschaftliche Produktion etwas, da die Verbraucher künftige Steuererhöhungen antizipieren
und beginnen mehr zu sparen, um diese Steuern zahlen zu können. Das unterstellte zukunftsgerichtete
Verhalten begrenzt auch den Umfang der geldpolitischen Straffung im Zeitraum 2018-2019. In einem
alternativen Szenario, in dem die Verbraucher keine höheren künftigen Steuern antizipieren, wäre der
Effekt auf das BIP-Wachstum 2018-2019 mit durchschnittlich mehr als ¾ Prozentpunkten pro Jahr etwas
stärker, der Inflationsdruck wäre jedoch größer, und das Leistungsbilanzdefizit würde sich ausweiten.
Auf mittlere Sicht lässt sich die volle Wirkung der US-Steuerreform und der Grad, in dem deren Vorteile
der Bevölkerung insgesamt zugutekommen, nur schwer schätzen und im Modell darstellen (Barro und
Furman, 2018). Es herrscht viel Unsicherheit in Bezug auf die Veränderungen der Anreize und Verhaltens-
weisen, die sich aus ihr ergeben können, insbesondere im Hinblick auf Investitionsstandortentscheidungen
und die Frage, inwieweit die direkten Einkommensteuersenkungen, von denen Haushalte mit hohem Ein-
kommen profitieren, der Ersparnis anstatt den Ausgaben zugutekommen. Die dauerhafte Senkung des
Grenzsteuersatzes für Unternehmen bedeutet, dass die realen Kapitalnutzungskosten niedriger sind, als
dies sonst der Fall wäre, was zu einem langanhaltenden Anstieg des Kapitalstocks der Unternehmen führt,
der das Angebot erhöht 2. Insgesamt ist das gesamtwirtschaftliche Produktionspotenzial im betrachteten
Szenario Mitte der 2020er Jahre um rd. ¾% und 2030 um rd. 1% höher. Bis dahin werden höhere Zinssätze
jedoch beginnen, die mittelfristigen Effekte abzuschwächen, und die Staatsschuldenquote wird den
Schätzungen zufolge bis Mitte der 2020er Jahre um rd. 6-7 Prozentpunkte ansteigen, was die Risikoprämien
auf Staatsanleihen und die langfristigen Zinsen nach oben treiben wird.
1. Diese Beurteilung stützt sich auf das globale makroökonomische Modell NiGEM des britischen National Institute of Economic
and Social Research. Die Simulation wurde auf der Basis zukunftsgerichteter Erwartungen durchgeführt, wobei unterstellt
wurde, dass die Unternehmen und die privaten Haushalte über sämtliche künftige fiskalische Änderungen informiert sind. Die
Geldpolitik wurde in allen Volkswirtschaften als endogener Faktor behandelt, außer im Euroraum und in Japan, wo unterstellt
wurde, dass die Leitzinsen nicht vor 2020 geändert werden. Ferner wurde davon ausgegangen, dass die Haushaltsregel ab
2020 wieder in Kraft ist, um die Schuldenquote der Vereinigten Staaten bis Mitte der 2020er Jahre wieder auf das Niveau des
Basisszenarios zu bringen, was einen allmählichen Anstieg des effektiven Steuersatzes bedeutet, der auf die Einkommen
der privaten Haushalte erhoben wird.
2. Es ist auch möglich, dass Veränderungen der Besteuerung der Einkommen der privaten Haushalte Erwerbsentscheidungen
beeinflussen, was hier jedoch nicht modelliert wird.
OECD-WIRTSCHAFTSAUSBLICK, AUSGABE 2018/1 © OECD 2018 – VORLÄUFIGE AUSGABE
171. GESAMTBEURTEILUNG DER WIRTSCHAFTSLAGE
Konjunktur durch eine Lockerung der Geldpolitik und eine aufgehellte Stimmung gestützt
wird. Höhere Ölpreise und niedrigere Zinssätze dürften auch in Russland dazu beitragen,
das Wachstum trotz der straffen Fiskalpolitik zu stützen.
Das Welthandelswachstum hat 2017 unter dem Einfluss der Erholung in Europa, der
Belebung des Elektronikhandels in Asien und der Verschiebung der Nachfragestruktur hin
zu Investitionen auf 5¼% angezogen. Das Importwachstum hat in vielen Rohstoffexport-
ländern ebenfalls zugenommen. Das Handelswachstum wird 2018-2019 den Projektionen
zufolge nachlassen, aber breitbasiert bleiben und unter der Annahme, dass sich die
Handelsspannungen nicht deutlich stärker verschärfen, auf durchschnittlich 4½-4¾%
pro Jahr ansteigen (Abb. 1.4). Bei diesem Tempo würde die Handelsintensität im Vergleich
zur Zeit vor der Krise zwar verhalten bleiben, aber etwas über dem durchschnittlichen
Niveau der Jahre 2012-2017 liegen. Die globalen Leistungsbilanzungleichgewichte werden
den Projektionen zufolge 2018-2019 leicht zunehmen, wobei das Leistungsbilanzdefizit der
Vereinigten Staaten (u.a. aufgrund der derzeitigen fiskalischen Lockerung) um rd. ¾% des BIP
steigen dürfte und die Defizite in einigen aufstrebenden Volkswirtschaften, insbesondere
in Ländern mit einem relativ starken Wachstum der Inlandsnachfrage, voraussichtlich
ebenfalls zunehmen werden. Die Leistungsbilanzüberschüsse Japans, des Euroraums und
Chinas dürften 2018-2019 mit rd. 4% (Japan und der Euroraum) bzw. 1¼% des BIP weitgehend
stabil bleiben. Die außenwirtschaftliche Position der großen Ölförderländer (einschließlich
Russlands) wird sich infolge der höheren Ölpreise verbessern.
Das stetige Beschäftigungswachstum wird sich den Projektionen zufolge 2018-2019
in den meisten fortgeschrittenen Volkswirtschaften fortsetzen, wobei die Beschäftigung
im OECD-Raum um jahresdurchschnittlich 1¼% zunehmen dürfte. Die Arbeitslosenquote
ist im OECD-Raum endlich wieder unter das Vorkrisenniveau gesunken und wird den
Projektionen zufolge bis Ende 2019 weiter auf 5% zurückgehen. Dies wäre die niedrigste
Quote im OECD-Raum seit 1980 und läge mehr als ½ Prozentpunkt unter der geschätzten
langfristig tragfähigen Arbeitslosenquote. Auch Unternehmensumfragen zufolge gibt es
Figure 1.4. A broad-based upturn in trade growth,
but trade intensity remains lower than before the crisis
A. Contributions to world trade growth B. Global trade intensity²
% pts
2.4
China Rest of the world Average 1990-2007 = 2.25
6
Other Asia World 2.2
Commodity producers¹
5 Euro area 2.0
North America
4 Average 1970-2015 = 1.78
1.8
3 1.6
1.4
2
1.2
1
1.0
0 0.8
-1 0.6
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2002-2007 2014 2016 2018
2013 2015 2017 2019
1. Commodity producers include Argentina, Australia, Brazil, Chile, Colombia, Indonesia, Norway, New Zealand, Russia, Saudi Arabia,
South Africa and other oil-producing countries.
2. World trade volumes for goods plus services; global GDP at constant prices and market exchange rates. Ratio of average annual world
trade growth to average annual GDP growth in the period shown.
Source: OECD Economic Outlook 103 database; and OECD calculations.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933728983
OECD-WIRTSCHAFTSAUSBLICK, AUSGABE 2018/1 © OECD 2018 – VORLÄUFIGE AUSGABE
181. GESAMTBEURTEILUNG DER WIRTSCHAFTSLAGE
Figure 1.5. Survey evidence is now pointing to labour shortages in some economies
A. US small businesses reporting labour shortages B. Balance of euro area firms citing constraints
on production from labour shortages
Normalised, six-month moving average Normalised, %
2.0 4
Lack of qualified applicants Services
1.5
Unable to fill job openings Manufacturing
3
1.0
0.5 2
0.0
1
-0.5
-1.0 0
-1.5
-1
-2.0
-2.5 -2
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Note: Normalised values over the period 2003-2018, expressed in standard deviations.
Source: National Federation of Independent Business; European Commission; and OECD calculations.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933729002
Anzeichen dafür, dass sich die Arbeitskräfteengpässe in einigen großen Volkswirtschaften
zu verschärfen beginnen (Abb. 1.5), insbesondere in Deutschland und einigen mittel- und
osteuropäischen Volkswirtschaften, was möglicherweise auf zunehmende Kompetenz-
engpässe zurückzuführen ist (EIB, 2017).
Es gibt inzwischen Anzeichen dafür, dass der Lohndruck stärker geworden ist, ins-
besondere in den Vereinigten Staaten, Kanada, Deutschland und mehreren kleineren
europäischen Volkswirtschaften, wie der Tschechischen Republik, Ungarn und Polen, wo
die Anspannung auf den Arbeitsmärkten zunimmt. In Japan, wo die Arbeitskräfteeng pässe
ebenfalls sehr akut sind, ist das Lohnwachstum nach wie vor verhalten; neue Steuer-
gutschriften für Unternehmen, die die Löhne um mindestens 3% anheben, könnten jedoch
ein stärkeres Lohnwachstum begünstigen. Die Reallöhne werden im OECD-Raum den
Projektionen zufolge 2018-2019 insgesamt um durchschnittlich rd. 0,9% pro Jahr steigen,
stärker als im Zeitraum 2014-2017, in dem ein jahresdurchschnittlicher Zuwachs um rd. 0,3%
verzeichnet wurde (Abb. 1.6). Da diese Belebung zu etwa drei Vierteln auf ein etwas stärkeres
Arbeitsproduktivitätswachstum zurückzuführen ist, erhöht sich der Lohnstückkosten-
anstieg in vielen Volkswirtschaften nur geringfügig.
Dennoch ist das Lohnwachstum nach wie vor schwächer als angesichts der rückläufigen
Arbeitslosigkeit und der offenbar zunehmenden Kompetenzengpässe zu erwarten wäre. Dies
lässt vermuten, dass konventionelle Messgrößen der Arbeitslosigkeit den aktuellen Umfang
der konjunkturbedingten Angebotsüberhänge auf den Arbeitsmärkten des OECD-Raums
unterzeichnen könnten, womit in einigen Volkswirtschaften noch Spielraum bestünde, die
Arbeitsnachfrage weiter zu erhöhen, ohne den Lohnauftrieb deutlich zu steigern.
Die Angebotsüberhänge unterscheiden sich in den großen Volkswirtschaften, in eini-
gen Ländern ist der Anteil der unfreiwilligen Teilzeitbeschäftigung jedoch vergleichsweise
hoch, und eine hohe Zahl von Personen weist zwar eine schwache Arbeitsmarktbindung
auf, steht dem Arbeitsmarkt aber zur Verfügung. Diese Faktoren scheinen in Europa relativ
bedeutsam zu sein, fallen in den Vereinigten Staaten und Japan jedoch offenbar weniger
ins Gewicht (Abb. 1.7). Außerdem bestehen im Ländervergleich erhebliche Unterschiede
in Bezug auf die Erwerbsquoten verschiedener Altersgruppen (Abb. 1.8). In den meisten
Ländern ist ein allgemeiner Anstieg der Erwerbsquoten festzustellen, insbesondere bei älteren
OECD-WIRTSCHAFTSAUSBLICK, AUSGABE 2018/1 © OECD 2018 – VORLÄUFIGE AUSGABE
191. GESAMTBEURTEILUNG DER WIRTSCHAFTSLAGE
Figure 1.6. Real wage growth is projected to pick up, helped by improving productivity growth
A. Real wage growth B. Labour productivity growth
% %
2.0 2.0
1995-2007 1995-2007
1.8 2007-2017 1.8 2007-2017
2017-2019 2017-2019
1.6 1.6
1.4 1.4
1.2 1.2
1.0 1.0
0.8 0.8
0.6 0.6
0.4 0.4
0.2 0.2
0.0 0.0
OECD Euro area OECD Euro area
United States Japan United States Japan
Note: Labour productivity growth is the average annual growth rate of output per person employed. Real wage growth is calculated from
nominal wage growth and the GDP deflator. 2018-2019 are projections.
Source: OECD Economic Outlook 103 database.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933729021
Arbeitskräften, was das Arbeitsangebot erhöht; die Vereinigten Staaten stellen allerdings eine
nennenswerte Ausnahme dar. Der Anstieg der Erwerbsquoten ist u.a. auf den kumulierten
Effekt vergangener Arbeitsmarktreformen zur Verstärkung der Arbeitsplatzschaffung, zur
Verringerung der Frühverrentungsmöglichkeiten sowie zum Abbau von Hindernissen für
die Erwerbsbeteiligung von Frauen zurückzuführen. In einigen europäischen Ländern
leistet der Zustrom von Asylsuchenden ebenfalls einen kleinen Beitrag zum Wachstum
der Erwerbsbevölkerung. Die in den Vereinigten Staaten zu beobachtende rückläufige
Erwerbsbeteiligung von Personen im Haupterwerbsalter (Altersgruppe 25-54 Jahre) hängt
Figure 1.7. There are high numbers of involuntary part-time
and marginally attached workers in some countries
As a percentage of labour force
A. Involuntary part-time workers B. Marginally attached workers
% %
7 5.0
United States United States
Euro area 4.5
6 Euro area
Japan Japan
4.0
United Kingdom United Kingdom
5
3.5
4 3.0
3 2.5
2.0
2
1.5
1
1.0
0 0.5
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Note: Involuntary part-time workers are people working less than 30-usual hours per week because they could not find a full-time job.
Marginally attached workers are persons aged 15 and over, neither employed or in the labour force, nor actively looking for work, but who
are willing to work and available to take a job. Additionally, when this applies, they have looked for work during the past 12 months.
Source: OECD Labour Market Statistics; Eurostat; Bureau of Labour Statistics; Statistics Bureau of Japan; and OECD calculations.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933729040
OECD-WIRTSCHAFTSAUSBLICK, AUSGABE 2018/1 © OECD 2018 – VORLÄUFIGE AUSGABE
201. GESAMTBEURTEILUNG DER WIRTSCHAFTSLAGE
Figure 1.8. Substantial differences remain in activity rates across countries
In per cent of the working age population in each age group; four-quarter moving average
A. Activity rate 15-64 year olds B. Activity rate 25-54 year olds
% %
80 90
75 85
70 80
United States United States
65 Euro area 75 Euro area
Japan Japan
United Kingdom United Kingdom
60 70
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
C. Activity rate 55-64 year olds D. Activity rate 15-24 year olds
% %
80 70
75 65
70 60
65 55
60 50
55 45
United States
50 Euro area
40
Japan United States Japan
45 35
United Kingdom Euro area United Kingdom
40 30
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Source: OECD Short-Term Labour Market Statistics; and OECD calculations.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933729059
teilweise mit einer Zunahme von Krankheit und Erwerbsunfähigkeit zusammen, wobei
auch der hohe Opioidkonsum eine Rolle spielt (CEA, 2018). In allen Ländern sind verstärkte
Anstrengungen zur Umsetzung von Strukturreformen erforderlich, um das Kompetenzniveau
Figure 1.9. Income and employment gains remain uneven in the OECD
A. Employment rates by age group B. Household real disposable income
Index 2008q1 = 100 Index 1985 = 100
115 170
15-24 Top 10%
25-54 Median
160
55-64 Bottom 10%
110 All
150
105 140
130
100
120
110
95
100
90 90
2008 2010 2012 2014 2016 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Note: The OECD employment rate of each age group is the ratio of the number of employed people to the working age population in the
age group. The income series are averages of the 17 OECD member countries for which data are available over the full period.
Source: OECD Short-Term Labour Market Statistics; OECD Income Distribution database; and OECD calculations.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933729078
OECD-WIRTSCHAFTSAUSBLICK, AUSGABE 2018/1 © OECD 2018 – VORLÄUFIGE AUSGABE
211. GESAMTBEURTEILUNG DER WIRTSCHAFTSLAGE
anzuheben, die Verfügbarkeit für den Arbeitsmarkt zu erhöhen und die Erwerbsbeteiligung
zu steigern und so die Arbeitsmarktchancen zu verbessern und die derzeitige Expansion
aufrechtzuerhalten.
Der Anstieg des Beschäftigungswachstums und der Einkommen ist nach wie vor
uneinheitlich. Die Beschäftigungsquoten älterer Arbeitskräfte (ab 55 Jahren) sind in den
letzten Jahren stark gestiegen, die Beschäftigungsquoten von Personen im Haupterwerbs-
alter und jungen Menschen liegen in vielen Ländern jedoch lediglich auf – oder immer
noch unter – Vorkrisenniveau. Das verfügbare Realeinkommen vieler Haushalte, vor allem
solcher mit niedrigem Einkommen, ist in den letzten zehn Jahren nur geringfügig gestiegen
(Abb. 1.9). Das verhaltene Lohnwachstum ist auch einer der Gründe für die weitverbreitete
Unzufriedenheit über die wirtschaftliche Entwicklung.
Entscheidende Fragen und Risiken
Wird die Inflation anziehen?
Höhere Rohstoffpreise haben die Gesamtinflation in zahlreichen fortgeschrittenen
Volkswirtschaften, u.a. im Euroraum, in Japan und in den Vereinigten Staaten, bereits stei-
gen lassen. Zugleich entwickelt sich die Trendrate der Inflation weiterhin verhalten, was z.T.
Figure 1.10. Inflation is projected to approach, or slightly exceed, inflation objectives
in the main OECD areas
Year-on-year percentage changes
A. Monthly headline inflation B. Monthly core inflation
% %
3 3
United States United States
Euro area Euro area
2 Japan 2 Japan
1 1
0 0
-1 -1
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
C. Annual headline inflation
% %
3.0 3.0
2017
2.5 2019 2.5
2.0 2.0
1.5 1.5
1.0 1.0
0.5 0.5
0.0 0.0
JPN
EA
AUS
USA
CAN
DEU
ITA
FRA
GBR
KOR
Note: Headline and core inflation are measured by the harmonised consumer price index for the euro area, the euro area countries and
the United Kingdom; the national headline consumer price series for Canada and Japan; and the personal consumption deflator for the
United States. Core inflation excludes prices of food and energy, including in Japan. In Japan, headline and core inflation in 2019 are
affected by the expected increase in the consumption tax rate.
Source: OECD Economic Outlook 103 database; OECD Main Economic Indicators database; and OECD calculations.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933728565
OECD-WIRTSCHAFTSAUSBLICK, AUSGABE 2018/1 © OECD 2018 – VORLÄUFIGE AUSGABE
221. GESAMTBEURTEILUNG DER WIRTSCHAFTSLAGE
auf das langsame Tempo der Erholung von der Krise zurückzuführen ist (Abb. 1.10). Auch
in den aufstrebenden Volkswirtschaften hält sich der Preisauftrieb im Großen und Ganzen
in Grenzen. Frühere Währungsabwertungen und die höheren Rohstoffpreise verstärken
gegenwärtig jedoch den Inflationsdruck in einigen Ländern, etwa in Argentinien, Mexiko
und der Türkei (Abb. 1.11).
Die Inflationserwartungen, insbesondere die der Unternehmen, haben im Euroraum
und in den Vereinigten Staaten leicht zugenommen (Abb. 1.12). Zusammen mit dem
Ölpreisanstieg und der geringfügigen Arbeitskostensteigerung (siehe weiter oben) wird
dies den Verbraucherpreisauftrieb in den Vereinigten Staaten auf ein leicht über dem
Inflationsziel liegendes Niveau steigen lassen; im Euroraum und in Japan dürfte er jedoch
unter der Zielvorgabe verharren (Abb. 1.10). Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben
gezeigt, dass eine Abnahme der Kapazitätsüberhänge u.U. nicht sofort zu einer deutlich
höheren Inflation führt. Tatsächlich scheint der Zusammenhang zwischen Preisauftrieb
und Kapazitätsüberhängen in den meisten fortgeschrittenen Volkswirtschaften schwach
ausgebildet zu sein3.
Aufwärtsrisiken für die Inflation gehen zumindest kurzfristig von einem möglichen
stärkeren Anstieg der Rohstoffpreise und insbesondere der Ölpreise aus. Diese Risiken dürf-
ten besonders groß werden, sollte die geopolitische Unsicherheit anhalten oder eskalieren.
Figure 1.11. Inflation remains modest in some large emerging market economies
Year-on-year percentage changes
% %
20 8
Brazil China
India 7 Indonesia
Russia South Africa
15 6
5
10 4
3
5 2
1
0 0
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
% %
14 50
Mexico Argentina¹
12 Turkey 45
40
10
35
8
30
6
25
4
20
2 15
0 10
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Note: Historic data are at monthly frequency, projections are at quarterly frequency.
1. Based on unofficial data until March 2017 (Congressional Inflation Index). Coverage is for the Greater Buenos Aires area until
November 2017, nationwide thereafter.
Source: OECD Economic Outlook 103 database; OECD Main Economic Indicators database; and OECD calculations.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933728584
OECD-WIRTSCHAFTSAUSBLICK, AUSGABE 2018/1 © OECD 2018 – VORLÄUFIGE AUSGABE
231. GESAMTBEURTEILUNG DER WIRTSCHAFTSLAGE
Figure 1.12. Corporate expectations of selling prices have strengthened
United States Euro area
Normalised, 3-month moving average Normalised, 3-month moving average
3 3
Manufacturing Industry
Services Services
2 2
1 1
0 0
-1 -1
-2 -2
-3 -3
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Note: The percent balance of the number of firms reporting expectations of higher prices compared with the number of firms reporting
expectations of lower prices. Normalised values over the period 2003-2018, expressed in standard deviations.
Source: US Federal Reserve; European Commission; and OECD calculations.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933728603
Figure 1.13. Large changes in inflation rates have frequently been driven by big changes
in energy and food prices
Change in the year-on-year inflation rates over the year, in percentage points
United States Euro area
10 2 3 3
2 2
5 1
1 1
0 0 0 0
-5 -1 -1 -1
-2 -2
-10 -2
Food and energy -3 -3
Core
-15 -3 -4 -4
-2 -1 0 1 2 -2 -1 0 1 2
Headline inflation Headline inflation
Japan
3 3
2 2
1 1
0 0
-1 -1
-2 -2
-3 -3
-4 -4
-2 -1 0 1 2
Headline inflation
Note: Horizontal axes show the change in the annual headline inflation rate over the 12-month period using monthly series between 2002
and early 2018. Vertical axes show the equivalent changes for core inflation and food and energy price inflation, respectively. Core
inflation excludes prices of energy and food, and in Japan it differs from the domestic definition.
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications, Japan; Bureau of Economic Analysis; Eurostat; and OECD calculations.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933728622
OECD-WIRTSCHAFTSAUSBLICK, AUSGABE 2018/1 © OECD 2018 – VORLÄUFIGE AUSGABE
241. GESAMTBEURTEILUNG DER WIRTSCHAFTSLAGE
Besorgnis darüber hat in den vergangenen Wochen bereits zu einem Anstieg der Ölpreise um
rd. 10% gegenüber dem im Basisszenario unterstellten Niveau von 70 USD pro Barrel geführt
(siehe weiter oben). In den vergangenen Jahrzehnten waren die stärksten Veränderungen
der Inflation durch große Veränderungen der Energie- und Nahrungsmittelpreise bedingt
(Abb. 1.13; Choi et al., 2017). Zudem könnte sich der Energie- und Nahrungsmittelpreis-
anstieg in Anbetracht der offenbar schwindenden Kapazitätsüberhänge relativ stark in
der Gesamt inflation niederschlagen und sich auch auf die Preise für sonstige Waren und
Dienstleistungen (ohne Energie und Nahrungsmittel) auswirken. In den aufstrebenden Volks-
wirtschaften, vor allem in den anfälligeren unter ihnen, wird die Inflation wahrscheinlich
höher ausfallen, wenn sich die jüngste Abwertung ihrer Währungen fortsetzt4.
Das Investitionswachstum hat sich erholt, ist jedoch nach wie vor schwächer als in
früheren Expansionsphasen
Das Investitionswachstum hat sich im Jahresverlauf 2017 in den meisten Volkswirt-
schaften belebt, was durch eine kräftigere inländische und weltweite Nachfrage sowie die Ver-
ringerung der finanziellen Engpässe begünstigt wird. Die Investitionsgüterproduktion hat im
vergangenen Jahr angezogen, und Ergebnisse von Unternehmensumfragen lassen auf steigende
Investitionsabsichten in vielen großen Volkswirtschaften schließen (Abb. 1.14), auch wenn
Besorgnis über Handelsprotektionismus das Vertrauen dort teilweise einzutrüben begonnen
hat5. Der Aufschwung ist jedoch nach wie vor schwächer als in früheren Expansionsphasen,
und das Wachstum des produktiven Nettokapitalstocks verharrt unter dem vor der Krise
Figure 1.14. Survey evidence points to stronger investment intentions
Normalised
A. Investment intentions in the United States B. Balance of large manufacturing firms
with insufficient capacity in Japan
3-month moving average
2 2
1 1
0
0
-1
-1
-2
Manufacturing
-3 Services -2
-4 -3
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
C. Balance of euro area manufacturing D. Balance of German manufacturing
firms citing constraints on production firms citing constraints on production
from equipment shortages from equipment shortages
3 4
2 3
2
1
1
0
0
-1 -1
-2 -2
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Note: Normalised values over the period 2000-2018, expressed in standard deviations.
Source: Bank of Japan; European Commission; US Federal Reserve; and OECD calculations.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933728641
OECD-WIRTSCHAFTSAUSBLICK, AUSGABE 2018/1 © OECD 2018 – VORLÄUFIGE AUSGABE
251. GESAMTBEURTEILUNG DER WIRTSCHAFTSLAGE
erreichten Tempo (OECD, 2017a). Dies ist ein wichtiger Faktor, der die Aussichten für das
Wachstum der Produktivität und des Produktionspotenzials auf mittlere Sicht beeinträchtigt.
Das Tempo des Wachstums der Unternehmensinvestitionen wird in den fortgeschrit-
tenen Volkswirtschaften im Zeitraum 2018-2019 voraussichtlich bei durchschnittlich
zwischen rd. 3½ und 3¾% jährlich liegen. In den Vereinigten Staaten werden die Unter-
nehmensinvestitionen dank der Auswirkungen der Steuerreformen und der günstigen
Finanzierungsbedingungen den Projektionen zufolge besonders kräftig ausfallen und im
Zeit raum 2018-2019 durchschnittlich um 5½% jährlich steigen. Auch in vielen mittel- und
osteuropäischen Ländern wird mit einem anhaltend kräftigen Investitionswachstum
gerechnet. Dennoch dürften die Bruttoanlageinvestitionsausgaben im OECD-Raum 2018-2019
ungefähr 12% (Medianwert) unter dem Niveau liegen, das nötig wäre, um sicherzustellen,
dass das Produktivkapital im Jahresdurchschnitt netto genauso stark expandiert wie in
den zehn Jahren vor der Krise. Dies erklärt sich aus dem Anstieg der Abschreibungsrate
des Kapitals im Zeitverlauf (OECD, 2017a). In einer Reihe aufstrebender Volkswirtschaften
wird eine kräftige Investitionstätigkeit erwartet, insbesondere in Indien, Indonesien und
der Türkei, insgesamt dürfte die Investitionsintensität jedoch weltweit (auch in China) nur
geringfügig über den längerfristigen Durchschnittswerten liegen (Abb. 1.15).
Zu den potenziellen Hindernissen für eine nachhaltige Erholung zählen geringere lang-
fristige Wachstumserwartungen, eine mangelnde Unternehmensdynamik in manchen
Volkswirtschaften sowie Unsicherheit, u.a. bezüglich der weltweiten Handelspolitik. Auch
in unproduktiven Unternehmen gebundene Ressourcen (Andrews et al., 2017) sowie die
Abnahme der Reformanstrengungen zur Beseitigung von Vorschriften, die den Produkt-
marktwettbewerb behindern (OECD, 2018b), verringern die Investitionsanreize. Die Hurdle-
Raten für Unternehmensinvestitionen liegen ebenfalls nach wie vor deutlich über den
Kapitalkosten; sie verharren trotz gleichzeitiger Fluktuationen der Finanzierungskosten
im Zeitverlauf auf hohem Niveau und sind relativ unelastisch (OECD, 2017a). Infolgedessen
hat sich die durchschnittliche Sachkapitalrendite vor Steuern in einigen Ländern seit der
Figure 1.15. Global investment intensity has picked up
A. OECD investment intensity¹ B. Global investment intensity²
2.0 1.6
Business plus government
Housing 1.5
1.4
1.5
1.3 Average 1990-2007 = 1.2
Average
1990-2007 = 1.12
1.2
1.0 1.1
1.0
0.9
0.5
0.8
0.7
0.0 0.6
2002-2007 2014 2016 2018 2002-2007 2014 2016 2018
2013 2015 2017 2019 2013 2015 2017 2019
Note: Ratio of average annual investment growth to average annual GDP growth in the period shown.
1. Ratio of OECD investment growth to OECD GDP growth in period shown.
2. Fixed capital investment and GDP growth in the OECD, Brazil, China, Chinese Taipei, Hong Kong - China, India, Indonesia, Malaysia,
the Philippines, Russia, Singapore, South Africa, Thailand and Vietnam, at constant prices.
Source: OECD Economic Outlook 103 database; IMF World Economic Outlook database; Consensus Economics; and OECD calculations.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933728660
OECD-WIRTSCHAFTSAUSBLICK, AUSGABE 2018/1 © OECD 2018 – VORLÄUFIGE AUSGABE
261. GESAMTBEURTEILUNG DER WIRTSCHAFTSLAGE
Figure 1.16. The rate of return on fixed assets remains high in some countries
% %
18 18
United States OECD
16 Japan 16 Germany
Korea France
14 14
Italy
12 12
10 10
8 8
6 6
4 4
21996 2000 2004 2008 2012 2016
21996 2000 2004 2008 2012 2016
% %
18 18
Mexico
16 16 Australia
Canada
14 14
12 12
10 10
8 8
United Kingdom
6 6
Netherlands
4 Belgium 4
Sweden
21996 2000 2004 2008 2012 2016
21996 2000 2004 2008 2012 2016
Note: The return on capital is calculated as the net operating surplus relative to net fixed assets in all countries apart from Canada,
Australia and Mexico where it is the net operating surplus relative to net non-financial assets. Non-financial assets include the value of
natural resources. The OECD series is a PPP-weighted average of the rate of return on net fixed assets in 18 OECD countries.
Source: OECD Annual National Accounts; and OECD calculations.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933728679
Krise stabilisiert oder sogar erholt (Abb. 1.16; Weale, 2015). Daraus lässt sich der Schluss
ziehen, dass die Unternehmen nicht alle marginalen, aber profitablen Investitionen
tätigen, die normalerweise durch niedrige Zinsen begünstigt werden. Zugleich ist sowohl
volumen- als auch wertmäßig eine starke Fusions- und Übernahmetätigkeit zu beobachten,
insbesondere in den Vereinigten Staaten; damit fließen die Ressourcen eher in den Ankauf
bereits vorhandenen Sachkapitals anderer Unternehmen als in die Vergrößerung des
aggregierten Kapitalstocks.
Höhere Zinssätze könnten zu Spannungen führen und Finanzmarktrisiken zutage
treten lassen
Die finanziellen Rahmenbedingungen sind nach wie vor wachstumsfreundlich, wenn-
gleich sie seit der Veröffentlichung des letzten OECD-Wirtschaftsausblicks im November 2017
in vielen großen Volkswirtschaften restriktiver geworden sind. Die höheren langfristigen
Zinssätze sind großenteils darauf zurückzuführen, dass sich die Konjunkturaussichten
günstiger entwickelt haben als von den Märkten erwartet, weshalb nun mit einer etwas
höheren Inflation und einer etwas weniger akkommodierenden Geldpolitik gerechnet wird
(Abb. 1.17). Die Aktienkurse, die in jüngster Zeit Höchststände erreicht hatten, sind in den
großen Volkswirtschaften gesunken, und die Volatilität der Aktienmärkte hat nach dem
ungewöhnlich niedrigen Niveau des vergangenen Jahres wieder zugenommen, was die
Gefahr einer überhöhten Risikobereitschaft verringern dürfte (Abb. 1.18). An den Kredit-
OECD-WIRTSCHAFTSAUSBLICK, AUSGABE 2018/1 © OECD 2018 – VORLÄUFIGE AUSGABE
27Sie können auch lesen