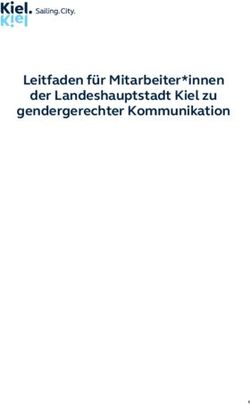Handlungsfelder zur Jugendbeschäftigung in Oberösterreich
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Handlungsfelder zur Jugendbeschäftigung in Oberösterreich Zusammenfassung der Steuergruppenmeetings im netzwerk.jugend.beschäftigung 2014 (Stand April 2014) Koordinationsstelle OÖ: Dr.in Edith Konrad Mag.a Mirna Prebanda Ein Kooperationsprojekt von AKOÖ und Sozialministeriumservice OÖ, gefördert aus Mitteln des Sozialministeriumservice OÖ, unter finanzieller Beteiligung der AKOÖ.
Inhaltsverzeichnis:
1. Österreichische Zielsetzungen im Rahmen der strategischen
Zusammenarbeit (GSR – gemeinsamer strategischer Rahmen) auf
EU-Ebene Strat.at 2020 (WIFO/Metis)……………………………………………..S. 3
1.1 Allgemeine Empfehlungen der OECD…………………………..………..S. 3
2. Arbeitsplatz Oberösterreich 2020………………………………………..……….…S. 5
3. Bad Ischler Dialog und NEET-Studie…………………………………….….……..S. 6
4. „netzwerk.jugend.beschäftigung“ Koordinierungsstelle am Übergang von
der Schule in die Arbeitswelt……………………………………..…………………S. 7
5. Handlungsoptionen aus Sicht der KOST OÖ……………………………...….…..S. 8
21. Österreichische Zielsetzung im Rahmen der strategischen
Zusammen-arbeit (GSR – gemeinsamer strategischer Rahmen)
auf EU-Ebene - Strat.at 2020 (WIFO/Metis)
Im Schwerpunkt 4 (Attraktivität, Qualität und Durchlässigkeit der beruflichen Bildung) heißt
es auf Seite 71 und folgende im strategischen Rahmenprogramm Österreichs im Kontext der
europäischen Strategie 2020, dass ein Ziel der Bildungspolitik sein muss, die
Bildungsniveaus zu verbessern und Schulabbrecher/-innenquoten zu senken (die anderen
Ziele: Attraktivität, Qualität und Durchlässigkeit der beruflichen Bildung; Erhöhung der Anzahl
der Absolventen/-innen naturwissenschaftlicher Studienrichtungen; Steigerung der
Bildungsbeteiligung, Vorbereitung auf das Studium und Erhöhung der Mobilität im tertiären
Sektor). Im Schulbereich geht es dabei schwerpunktmäßig um Drop-out-Bekämpfung, in der
Erwachsenenbildung um bessere Bildungszugänge und Erhöhung der Qualifikation der
Beschäftigten und im Wissenschaftsbereich um die Verringerung der Studienabbrüche. Die
Eingliederung von jungen Menschen ohne Arbeitsplatz oder Ausbildungsplatz ins
Erwerbsleben ist eine der Investitionsprioritäten für die nächste Strukturförderperiode (die
anderen: Aktives und gesundes Altern; aktive Eingliederung; Zugang zu LLL und
Kompetenzsteigerung der Arbeitskräfte; Förderung des Zugangs zu einer hochwertigen
Früherziehung und einer hochwertigen Grund- und Sekundärbildung; start.at Seite 87f). In
diesen Bereichen sollen 2014 bis 2020 80 Prozent der ESF-Mittel investiert werden.
1.1 Allgemeine Empfehlungen der OECD
Auch die OECD kommt in aktuellen Analysen immer wieder zu der Erkenntnis, dass
Arbeitsmarktintegration nur dann erfolgreich und nachhaltig sein kann, wenn regionale
Stakeholder-Netzwerke sich darum kümmern und für Stabilität und Kontinuität auf regionaler
und lokaler Ebene sorgen1. In einem Arbeitspapier aus dem Jahr 2011 beispielsweise heißt
es (S. 13):
„Ensuring employment success for minority young people is a policy area where
a local approach is particularly important. …Local policy makers are able to take
into account such variation, along with the differences in labour market demand,
when developing policy responses. Improving the career prospects of young
1
Sie dazu zum Beispiel ein OECD-Arbeitspapier aus dem Jahr 2010/2011: OECD Local Economic
and Employment Development (LEED) Working Papers 2011/09, Ensuring Labour Market Success for
Ethnik Minority and Imigrant Youth, Francesca Froy, Lucy Pyne,
www.oecd.org/cfe/leed/forum/partnerships
3people requires the mobilization of many different resources at the local level. In
order to have the critical mass necessary to solve entrenched disadvantage,
policy responses also need to be integrated through local collaboration, and
incorporated within broader regional and local development strategies“.
Die hier auf migrantische Jugendliche abgezielte Entwicklung regionaler Strategien gilt
natürlich für alle Zielgruppen, die von Ausgrenzung und Diskriminierung bedroht sind, also
auch Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen. Diversitätskriterien sind je nach
Fragestellung im besonderen Kontext relevant.
Was sollte laut OECD geschehen?
Bildungspolitik verbessert die Arbeitsmarktsituation von benachteiligten Gruppen:
Präventiv gilt es im Schulsystem anzusetzen. Ganztagsschulen können hierfür einen
wesentlichen Beitrag leisten, indem die zusätzlichen zeitlichen Ressourcen für eine
individuelle Förderung genutzt werden.
Etablierung spezieller individueller Fördermaßnahmen zur Verbesserung bzw. zum
Nach-holen allgemeiner schulischer Basiskompetenzen (Mathematik, Deutsch), die
auf die Bedürfnisse von Migranten/-innen besser abgestimmt sind. Wichtig erscheint
auch die Kombination von Qualifizierungsangeboten bzw. Sprachförderungen mit
Kinderbetreuungsmöglichkeiten an einem Ort.
Die Bündelung aller Aktivitäten der Jugendausbildung und Jugendbeschäftigung
muss Vorrang haben: Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik sind zu wenig koordiniert.
Ebenso braucht es eine starke Vernetzung von Jugendarbeit, Betrieben, Kommunen
und Vereinen.
Ausbau innovativer Ausbildungsmodelle und Lernformen für Jugendliche, deren
Bedürfnisse mit traditionellen Bildungsangeboten derzeit nicht abgedeckt werden: Die
bestehenden Ansätze eines "Case Managements" müssen zu einer
flächendeckenden Betreuung und Begleitung dieser Gruppe ausgebaut werden.
Dieses Engagement soll bereits in der Schule einsetzen – die Jugendlichen hätten so
über einen längeren Zeitraum hinweg durchgehend eine Ansprechperson. Wichtig
dabei: die koordinierte Zusammenarbeit aller beteiligten Institutionen und das
offensive Zugehen auf die Jugendlichen.
4Einen ähnlichen Befund zeigt ein Evaluationsbericht2 der L&R Sozialforschung im Auftrag
der ÖROK zur Wirksamkeit von Interregprogrammen und Europäischer transnationaler
Zusammenarbeit in den vergangenen 15 Jahren mit besonderem Fokus auf die Entwicklung
von Humanressourcen, Arbeitsmärkten und Migration. Dieser sieht für die zukünftige
grenzüberschreitende Zusammenarbeit folgende arbeitsmarktpolitische Herausforderungen:
Demografischer Wandel und die Schaffung einer alter(n)sgerechten Arbeitswelt.
Kooperationen in der Bildungspolitik mit dem Fokus auf die Erhöhung der
Bildungsbeteiligung der 15 bis 24-Jährigen und der Bildungsbeteiligung von
Migranten/-innen sowie die Reduzierung der Schul-Drop-outs.
Strukturwandel und die Bedeutung neuer Berufsfelder (Pflege, Tourismus,…).
Soziale Inklusion und Abbau von Barrieren und Ausgrenzungsmechanismen.
Ausbau grenzüberschreitender Netzwerke und gemeinsamer Arbeitsmarktstrategien
in Kooperation mit dem TEP (finanzielle und personelle Ressourcen).
Weiterentwicklung von grenzüberschreitenden Prognoseinstrumenten, die derzeit
noch unzureichend sind.
Migration.
Um diesen Herausforderungen begegnen und geeignete Antworten auf zentrale Frage des
Zusammenlebens finden zu können, braucht es zukünftig – und da sind sich internationale
Expertinnen und Experten der Arbeitsmarkt- und Regionalentwicklung einig – neue Formen
der Kooperation und Partnerschaften über die Grenzen der EU-Länder hinweg aber ebenso
auf regionaler und lokaler Ebene. Voraussetzung dafür sind gut funktionierende Netzwerke,
die in der kommenden Strukturförderperiode 2014 bis 2020 besonders entwickelt und
gefördert werden können.
2. Arbeitsplatz Oberösterreich 2020
„Wir verbessern die Beschäftigungs- und Qualifizierungschancen von Jugendlichen
und jungen Erwachsenen in Oberösterreich, indem wir möglichst viele junge
Menschen an Ausbildungsabschlüsse heranführen. Durch die Erhöhung der
Bildungsbeteiligung der Jugendlichen und durch die Schließung von Bildungslücken
bei niedrig qualifizierten Jugendlichen werden zentrale Lücken der beruflichen
Bildung geschlossen. Durch die Integration von benachteiligten Jugendlichen und die
Verbesserung der beruflichen und schulischen Bildung steigern wir nachhaltig das
2
Bergmann, Nadja, Willsberger, Barbara (2011), 15 Jahre Interreg/ETZ in Österreich – Rückschau
und Ausblick: von Humanressourcen, Arbeitsmärkten und Migration, L&R Sozialforschung Wien
5Fachkräftepotential für die oö Wirtschaft. Die Akteure/-innen am Arbeitsmarkt arbeiten
gemeinsam im Sinne einer aktiven Vernetzung aller relevanten Partner/-innen der
regionalen Arbeits- und Bildungspolitik zusammen. Dadurch soll die Chance auf
institutionsübergreifende Lösungen erhöht werden.“ (Seite 46 – Vision)
„Nachhaltig wirken diese Initiativen, indem auch der regionale Netzwerkaufbau und
die Zusammenarbeit von Unterstützungsstrukturen in Regionen und Bezirken besser
abgestimmt werden.“ (Seite 56 Handlungsfeld – Erhöhung der Transparenz und der
Wirksamkeit des Maßnahmenangebotes)
3. Bad Ischler Dialog und NEET Studie
Beim Bad Ischler Dialog, bei dem jährlich die bildungs- und arbeitsmarktpolitischen
Positionen der österreichischen Sozialpartner diskutiert werden, stand 2013 ebenfalls das
Thema Jugendbeschäftigung im Zentrum. Im zusammenfassenden Paper „Perspektiven für
die Jugend“ vom 9.9. 2013 wird neben der Aufzählung bereits etablierter Angebote und von
Veränderungspotential im Bildungs- und Ausbildungsbereich auch darauf hingewiesen, dass
für eine gute Prozesssteuerung und Wirksamkeit der Strategien und angeschlossenen
Angebote einer Koordination und Steuerung bedarf.
Breiten Konsens gibt es mittlerweile auch in den Territorialen Beschäftigungspakten (TEP)
und der Arbeitsmarktpolitik und den umsetzenden Stellen Österreich weit darüber, dass es
hier mehr Effizienz im Ineinandergreifen von Top-down-Prozessen (Strategische
Steuerung/Angebote zur Zielerreichung/Förderwesen) und Bottom-up-Prozessen (operative
Steuerung) braucht. In Oberösterreich kann dies durch eine regelmäßig aufeinander
abgestimmte Kooperation zwischen der Strategie Arbeitsplatz 2020 (strategische
Steuerung), dem Pakt für Beschäftigung und Qualifizierung (Strategie und
Angebote/Fördermaßnahmen) und dem „netzwerk.jugend.beschäftigung“ -
Koordinationsstelle am Übergang von der Schule in die Arbeitswelt (operative Steuerung
über die Netzwerkstrukturen) vollzogen werden.
4. „netzwerk.jugend.beschäftigung“ – Koordinationsstelle am Übergang
von der Schule in die Arbeitswelt
Das „netzwerk.jugend.beschäftigung“ ist eine Koordinierungsstelle am Übergang von der
Schule in den Arbeitsmarkt, das auf Basis obiger Erkenntnisse und Empfehlungen weiter
ausgebaut werden soll. Es ist ein oberösterreichweites Kooperationsprojekt von BSB OÖ und
6AKOÖ. Im „netzwerk.jugend.beschäftigung“ laufen einerseits die regionalen
Jugendnetzwerke zusammen, die mit ihren Strukturen auf die regionalen Bedürfnisse
eingehen. Anderseits wird mit den Vernetzungs- und Koordinierungsaktivitäten das Jugend-
coaching Angebot vom Bundessozialamt bei der Implementierung in OÖ begleitet.
Die Ziele der regionalen und überregionalen Netzwerkaktivitäten am Übergang von der
Schule in den Arbeitsmarkt sind:
Know-How mit regelmäßigem Informations- und Erfahrungsaustausch bündeln und
Impulse setzten.
Das Jugendcoaching Angebot (und neue Angebote, die in Zukunft entwickelt werden)
in die bestehenden Strukturen implementieren.
Transparenz in der Angebotslandschaft schaffen, Lücken aufzeigen, das Bestehende
nutzen und Ressourcen bündeln im Sinne operativer Steuerung.
Das vorrangige Ziel ist, dass Jugendliche mit besonderem Unterstützungsbedarf am
Übergang von der Schule in den Arbeitsmarkt von unseren Aktivitäten profitieren und
ihre Bildungs- und Berufschancen verbessert werden.
Aus der regionalen und überregionalen Netzwerk- und Koordinierungsarbeit lassen sich
bereits einige Handlungsfelder ableiten, die von den Netzwerkpartnern/-innen aufgezeigt
werden. Die abgebildeten Handlungsfelder resultieren aus der Expertise3 und den
Erfahrungen, die die Experten/-innen täglich in der Jugendarbeit, Beratung, Begleitung,
Betreuung, Schulung und/oder in dem Coaching von Jugendlichen machen.
3
Die Handlungsoptionen sind eine Zusammenfassung der Inhalte, die von den Experten/-innen bei
den Steuergruppentreffen in den Regionen und in OÖ immer wieder zusammengetragen wurden
(Quelle: KOST-Protokolle März bis November 2013 und persönliche Gespräche).
75. Handlungsoptionen aus Sicht der KOST OÖ
Übersicht Handlungsfelder
Vernetzung weitertreiben.
Elterntraining generell und speziell für Eltern mit Kleinkindern ab
Kindergartenalter.
Eltern rechtzeitig einbinden.
Potentialanalysen zur treffsicheren Entscheidung in der Wahl der
Schule oder einer Lehrstelle.
Vernetzung der Berufsorientierung.
Therapiekonzepte ausbauen.
Dem Zeitfaktor für Beziehungsarbeit in Angeboten Rechnung tragen.
Ressourcen statt Defizite im Blick haben.
Schnittstellen zu Betrieben ausbauen.
Angebote am zweiten Arbeitsmarkt und im geschützten Bereich
schaffen.
Bedarfskoordination für die Regionen.
Mehr Förderunterricht in den Schulen ermöglichen.
Helfersysteme im Schulumfeld ausbauen – community school.
One-Stop-Shops in Regionen mit hohen NEET-Zahlen entwickeln.
Anhebung der Altersgrenzen im Jugendcoaching.
Niederschwelligere Angebote für Jugendliche schaffen.
Existenzsicherung bei bestimmten Zielgruppen (z.B. obdachlose
Jugendliche).
Kontinuierliche Qualitätssicherung in der Angebotslandschaft.
Diversität als Querschnittsthema in allen Angeboten am Übergang von
der Schule in die Arbeitswelt integrieren.
8Handlungsfeld - Vernetzung weitertreiben.
In der aktuellen NEET Studie4, die im Auftrag des BMASK durchgeführt wurde, wird
davon ausgegangen, dass regionale Netzwerke jene Ebene sind, die am meisten
Wissen über Jugendliche hat, die von Desintegration betroffen sind (S.25f). Durch die
Zusammenarbeit von Akteuren/-innen in den Bereichen Schule, Jugendarbeit,
Arbeitsmarkt, Sozialpartnerschaft, Wirtschaft, Kultur und Sport kann es zu einem
regionalen Informationsaustausch über desintegrierte Jugendliche kommen. Darauf
kann die Angebotslandschaft gut aufbauen.
Es gibt in Oberösterreich eine gute Netzwerkstruktur und regionale und eine
überregionale Koordinationsstelle am Übergang von der Schule in die Arbeitswelt, die
bei der Implementierung neuer Angebote (Jugendcoaching, AFit,…) unterstützt. Die
ersten Monate der JUCO Umsetzung zeigen, dass diese operative Steuerung auf
zentraler und regionaler Ebene (Top-down und Bottom-up) sehr effizient und hilfreich
ist.
Deshalb sollen die Netzwerkstruktur und die Koordinierungsaktivitäten in den
kommenden Jahren auch flächendeckend ausgebaut und betrieben werden. Dafür
sind personelle und finanzielle Ressourcen erforderlich, die derzeit vom BSB OÖ und
der AKOÖ zur Verfügung gestellt werden. Die nachhaltige Verankerung dieser
Strukturen wird Thema im Experten/-innen-Forum - bestehend aus den wesentlichen
oö Arbeitsmarktakteuren/-innen -, sein. Ziel ist die Einbindung der Koordinationsstelle
in die aktive Arbeitsmarktpolitik als dritte wichtige Stellschraube (strategische
Steuerung über die oö Arbeitsplatzstrategie 2020 – Umsetzung und Finanzierung
über den Beschäftigungspakt – operative Steuerung durch die Koordinationsstelle).
Wichtig ist, auch bereits andere bestehende Netzwerke (Sozialplattform, offene
Jugendarbeit, schulische Helfer/-innen-Netzwerke etc.) im Blick zu haben und
sukzessive in die Vernetzungsarbeit einzubinden.
4
Studie zur arbeitsmarkpolitischen Zielgruppe NEET, ISW/IBE/JKU im Auftrag des BMASK, Wien
2013
9Handlungsfeld – Elterntraining generell und speziell für Eltern mit Kleinkindern ab
Kindergartenalter
Da derzeit viele Ressourcen in das Stützt-System am Übergang von der Schule in die
Arbeitswelt fließen, dadurch aber Ursachen, die in der sozialen Entwicklung der
Kindern und oft im familiären Umfeld liegen und zu verringerten Entwicklungschancen
der Kinder führen, nicht behoben werden, wird in den Steuergruppen in OÖ auch
immer wieder davon gesprochen, dass Eltern in der Kindererziehung möglichst
frühzeitig (spätestens ab Kindergartenalter) begleitet und unterstützt werden müssen.
Durch den präventiven Ansatz würden viele Folgemaßnahmen obsolet. Im
Salzkammergut (Bezirke Gmunden und Vöcklabruck) gibt es dazu beispielsweise
konkrete Ansätze der Elternarbeit und des Coachings von Eltern (z.B. Hagenmühle:
Neue Autorität nach Heim Ohmer;) in Kooperation auch mit den
Bezirkshauptmannschaften. Projekte wie das Rucksackprojekt oder Mama lernt
Deutsch sind ebenfalls Ansätze, die vor allem migrantische Eltern unterstützen.
Handlungsfeld - Eltern rechtzeitig einbinden.
Bei allen JUCO-Steuergruppentreffen in OÖ wurde festgestellt, dass es große
Informationslücken hinsichtlich der Möglichkeiten und Angebote am Übergang von
der Schule in die Arbeitswelt bei Eltern, vor allem auch bei jenen mit
Migrationshintergrund, gibt: Gleichzeitig wissen wir aus Erfahrung, dass ein
wesentlicher Knackpunkt in der Schnittstelle zum Elternhaus liegt. Die Eltern müssen
mehr ins Boot geholt werden, um die Jugendliche auch rechtzeitig in der
Orientierungs- und Entscheidungsphase unterstützen zu können. Das ist auch eines
der zentralen Ergebnisse der Studie vom Institut für Berufs- und
Erwachsenenbildungsforschung (IBE) an der Universität Linz. Die Studie belegt, dass
die ersten Informationen im Rahmen der Berufsorientierung/-beratung zu einem sehr
späten Zeitpunkt von Jugendlichen mit Migrationshintergrund und aus
bildungsbenachteiligten Elternhäusern eingeholt werden.5 Dazu braucht es innovative
und kreative Ansätze, da alles, was bisher auch mit Projekten erprobt wurde, in der
5
vgl. Studie und Handlungsleitfaden: Berufsorientierung und Berufsberatung von Jugendlichen mit
Migrationshintergrund. Am Beispiel Oberösterreich. IBE im Auftrag von Land OÖ, Linz 2011, SS. 167,
175 – 176 u. Ergebnispräsentation, siehe:
http://www.ibe.co.at/fileadmin/AblageBox/Projektdownloads/ESF_Ergebnispraesentation.pdf, 13. 11.
2013
10Breite nicht zielführend ist. So ist es z.B. bei Bewerbungen zu einer Lehrstelle neben
der 1. oder 2. Leistungsgruppe auch erforderlich, dass die Eltern bei der
Lehrstellenbewerbung anwesend sind. Betriebe nehmen die Anwesenheit der Eltern
beim Bewerbungsgespräch sehr positiv wahr, weil es ein Zeichen dafür ist, dass jene
hinter der Ausbildung stehen.
Eltern mit Migrationshintergrund sind oft zu wenig über die Ausbildungsmöglichkeiten
in Österreich informiert. In den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens gibt es diese
Form der Lehrlingsausbildung nicht, in der Community ist deshalb wenig Verständnis
für das System. Es herrscht viel Unwissenheit bzgl. Schulsystem (Leistungsgruppen
etc.), Ausbildung und Jobchancen.
Außerdem schätzen viele Eltern auch das Potenzial des Kindes falsch ein. Diese
Eltern von etwas anderem zu überzeugen, ist meist aussichtslos, da sie sich hier
auch in der Erziehungskompetenz in Frage gestellt sehen. Gerade Eltern, die Kinder
mit besonderem Unterstützungsbedarf haben, kommen meist auch nicht zu
Elternsprechtagen, Informationstagen des AMS etc. Die Studie von IBE belegt
ebenfalls, dass der Angleichungsprozess von Plänen und realen Chancen bei den
„klassischen“ Risikogruppen zu spät einsetzt. Die Investition in Eltern-Arbeit bei
Jugendlichen mit besonderem Unterstützungsbedarf ist laut der Studie ebenfalls ein
bedeutendes Handlungsfeld.6 Hier stellt sich die Frage, wie diese Zielgruppen
erreicht werden können und vor allem wo man sie „abholen“ kann, da sie oft keine
Sprechstunden besuchen.
Ein Weg wäre die Initiierung von migrantischen Elternvereinen, um migrantische
Eltern besser an das triale Prinzip unseres Schulsystems heranführen zu können. Vor
zwei Jahren wurde beispielsweise in Wels von Sevil Kus (Integrationsbüro der
Volkshilfe Wels) ein unabhängiger türkischer Elternverein gegründet. In monatlichen
Eltern-Treffen werden migrantischen Eltern Informationen über Schule, Schulsystem
und die Unterstützungsangebote für die Kinder weitergegeben. Die Eltern haben dort
Gelegenheit, Erfahrungen auszutauschen und Probleme zu besprechen. Zielgruppe
sind vor allem auch migrantische Eltern, die weniger Zugang zu Bildung haben. Ein
Erfolgsfaktor für die Erreichbarkeit möglichst vieler Eltern sind viele Multiplikatoren/-
6
Studie und Handlungsleitfaden: Berufsorientierung und Berufsberatung von Jugendlichen mit
Migrationshintergrund. Am Beispiel Oberösterreich. IBE im Auftrag von Land OÖ, Linz 2011, siehe
Ergebnispräsentation:
http://www.ibe.co.at/fileadmin/AblageBox/Projektdownloads/ESF_Ergebnispraesentation.pdf, dl. 13.
11. 2013
11innen (Brückenbauer/-innen), die wiederum in ihren Kulturvereinen über die
Tätigkeiten und Themen der Eltern-Treffs berichten. Durch diese „muttersprachlichen
Treffs“ können Eltern Anfangs leichter erreicht werden. Am Beginn ist viel
Informationsarbeit nötig, weil Eltern aus anderen Kulturen die Grundkenntnisse des
österreichischen Schulsystems fehlen und diese davon ausgehen, dass es in
Österreich genauso wie in ihrer Kultur funktioniert. Die Elterntreffen sollen eine
Brücke sein, um Eltern mittel und langfristig dazu zu bringen, sich an Elternvereinen
der Schulen zu beteiligen, was aufgrund vieler Barrieren (Sprache, andere Kultur, …)
oft in der ersten Phase nicht möglich ist. Grundsätzlich ist es ist wichtig, schon
frühzeitig mit Informationsarbeit anzusetzen und nicht erst am Übergang von der
Schule in die Arbeitswelt.
Handlungsfeld – Potentialanalysen zur treffsicheren Entscheidung in der Wahl der
Schule oder einer Lehrstelle
Die Akteure/-innen am Übergang von der Schule in die Arbeitswelt stellen immer
wieder fest, dass Eltern und auch Jugendliche völlig falsche Vorstellungen über
Anforderungen der Arbeitswelt haben. Hier kommt es durch falsche
Selbsteinschätzung sehr oft zu Fehlentscheidungen, die sich fatal auf die weitere
Erwerbsbiografie auswirken können. Potentialanalysen sind hier ein gutes Instrument,
Stärken und Schwächen festzustellen und auf Basis der Ergebnisse Entscheidungen
besser treffen zu können.
Handlungsfeld – Vernetzung der Berufsorientierung
In Oberösterreich gibt es an Schulen, von den Sozialpartnern und den Betrieben gute
Angebote in der Berufsorientierung. Trotzdem wird immer wieder festgestellt, dass
Eltern und Kinder nicht ausreichend Bescheid wissen. Trotz intensiver Bemühungen
von allen Seiten werden auch immer noch die drei klassischen Frauenberufe für
Lehrausbildungen von Mädchen gewählt, bei Burschen ist die Berufswahl etwas
breiter, aber auch hier dominieren herkömmliche Verhaltensmuster. Eine Vernetzung
der bestehenden BO-Angebote, gemeinsame Auftritte und die frühzeitige Information
und Einbindung von Eltern wäre hier hilfreich. Auch in migrantischen Communities ist
hier vermehrter Handlungsbedarf, da auch hier festgefahrene Bilder und Wertigkeiten
12in Bezug auf Lehre (die es oft in den Herkunftsländern nicht gibt) und Arbeit
vorherrschen.
Handlungsfeld - Therapiekonzepte ausbauen.
Es gibt eine erhebliche Anzahl an Jugendlichen in Oberösterreich, die im präventiven
Sinn zusätzliche therapeutische Angebote brauchen, um den Schritt in die Berufswelt
wagen zu können. Auch die aktuelle NEET-Studie weist darauf hin, dass zur
Integration von NEET Maßnahmen zur Gesundheitsprävention notwendig sind (Seite
443)7. Neben der (sozial) pädagogischen Unterstützung in schulischen und
nachschulischen Maßnahmen ist es aus verschiedenen Gründen kaum möglich ein
interdisziplinäres Angebot zu schaffen, um sie bei diesem Schritt bestmöglich und
professionell zu unterstützen.
Oft zeichnet sich schon lange, bevor Jugendliche ganz aus dem System fallen und
NEET werden, ab, dass das passieren wird. Hier fehlen sehr oft finanzielle
Möglichkeiten für therapeutische Unterstützungsmöglichkeiten, mit denen man
präventiv entgegen wirken könnte. Es gibt in Ansätzen (bei einzelnen Projekten zum
Beispiel ZIB Hagenmühle) therapeutische Unterstützung und Beratung in all ihren
Facetten, die für eine ganzheitliche und umfassende Begleitung notwendig wäre,
allerdings nicht. Gibt es nicht die Zugangsvoraussetzungen, scheitert therapeutische
Unterstützung und interdisziplinäre Zusammenarbeit an folgenden Punkten:
Fehlende familiäre Unterstützung finanziell, organisatorisch und die Einstellung
betreffend Beratung und Therapie.
Fehlende organisatorische Unterstützung damit Therapie in der Einrichtung vor
Ort oder anders formuliert, im Alltag dieser angeboten werden kann.
Fehlende Ressourcen für Diagnostik, Fallbesprechung und interdisziplinärer
Expertengesprächen.
Als einzige Einrichtung konnte bisher das ZIB Hagenmühle8 beginnen einen
Therapeutenpool aufzubauen – es ist nicht einfach rechtzeitig fachlich
qualifizierte Therapeuten/-innen zur Hand zu haben, die mit diesem Klientel
arbeiten wollen und bereit sind außerhalb ihrer Praxis tätig zu werden. Diese
bereits erworbenen Erfahrungen könnten genutzt und ausgebaut werden.
7
Studie zur arbeitsmarkpolitischen Zielgruppe NEET, ISW/IBE/JKU im Auftrag des BMASK, Wien
2013
8
Siehe: www.zib-hagenmuehle.at
13Voraussetzungen, um Therapie schlagkräftig zu implementieren:
Das Angebot muss möglichst offen und vielseitig sein, um auf die individuellen
Bedürfnisse der einzelnen eingehen zu können. Daraus folgt, dass ein möglichst
breiter Therapeutenpool aufgebaut werden soll, der sich nicht auf bestimmte
Richtungen und Angebote versteift.
Therapeutische und pädagogische Interventionen sollen eng aufeinander
abgestimmt sein. Es braucht interdisziplinäre Fallbesprechungen und
Meinungsaustausch unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen
(Psychotherapiegesetz etc.).
Die zusätzlichen Angebote sollen nachgehend, niederschwellig, bei Bedarf
vor Ort und mit wenig Organisationsaufwand für den Jugendlichen und die
betreuende Einrichtung verbunden sein.
Eine fachlich fundierte Organisation und Qualitätsmanagement.
Bereitstellung ärztlich - psychiatrischer und psychologisch - klinischer
Diagnosemöglichkeiten.
Bildung von Bündnissen und Vernetzungsarbeit zwischen Jugendlichen,
Eltern, Einrichtung, Ämtern und Therapie wie es unteranderem im Ansatz von
Haim Omer9 gefordert wird.
Coaching für Eltern, Familien und weitergefassten Unterstützungssystemen .
Beanspruchung des Angebots bereits im schulischen System (Prävention).
Der/Die Koordinator/-in kann und soll selbst nicht beratend und therapeutisch
in diesem Kontext tätig sein.
Gute Voraussetzungen für die Umsetzung wegen struktureller Besonderheiten
im Salzkammergut, wie das Jugendnetzwerk10, Kompetenzzentrum
Salzkammergut und bereits erworbenes Know-how im ZIB Hagenmühle.
Handlungsfeld - Dem Zeitfaktor für Beziehungsarbeit in Angeboten Rechnung
tragen.
Das Coaching braucht Zeit und Beziehungsarbeit. Coaching von Migranten/-innen ist
auch, wie sich in allen Angeboten zeigt, meist zeitintensiver. Teilweise werden
Dolmetscher/-innen eingesetzt oder es sind Vertrauenspersonen aus der Familie beim
9
Omer Haim , Schlippe Arist(2010), Stäke statt Macht, Neue Autorität in Familie, Schule und
Gemeinde Vandenhoeck & Ruprecht; Auflage: 1., Auflage (18. Februar 2010)
10
http://www.arbeiterkammer.com/online/jugendnetzwerk-44300.html
14Coaching anwesend, um die sprachlichen Schwierigkeiten zu überbrücken. Es stellt sich
die Frage, wie gerade migrantische Zielgruppen besser erreicht werden können.
Generell stell sich die Frage, wie Erfolgsnachweise der Anbieter/-innen (Zahlen,
Fördergeber,..) und die Erkenntnis, dass Beziehungsarbeit mehr Zeit braucht, Flexibilität,
Spontanität, Orientierung etc. zusammen passen? Schließt sich das aus? Diese Fragen
müssen in jedem Fall auch in die Entwicklung neuer Programme und Projekte in der
nächsten Strukturförderperiode einfließen. Ebenso die Frage, die auch auf Anbieter/-
innenseite immer wieder in den Raum gestellt wird, nämlich, ob sich in der
Betreuungsintensität- und –qualität etwas ändern muss? (weniger Jugendliche, die die
demografische Entwicklung ja mit sich bringt, muss ja nicht heißen, weniger Betreuung,
sondern möglicherweise auch mehr Zeit für Betreuung und Beziehungsarbeit).
Handlungsfeld - Ressourcen statt Defizite im Blick haben.
Weg von starren Maßnahmenkorsetten hin zu maßgeschneiderten, individuellen
Angeboten die auf die Bedürfnisse der Jugendlichen zugeschnitten sind (ist zum
einen gesellschaftspolitische Verantwortung und zudem auch volkswirtschaftlich
„billiger“ als ständig Reparaturmaßnahmen oder Mindestsicherung/Sozialzahlungen
etc.).
Jugendliche und junge Erwachsene, die Mindestsicherung beziehen haben
besondere Problemstellungen: zum Beispiel besteht hier derzeit das Problem, dass
Jugendliche, die vor dem 18 Lebensjahr eine Lehre begonnen haben, weiterhin die
Mindestsicherung beziehen können, jene, die bereits älter sind und eine Lehre
beginnen, den Mindestsicherungsanspruch verlieren.
Immer wichtiger werden individuelle Betreuung und individuelle Settings, in denen
den Jugendlichen ganz konkret in der jeweiligen Lebenssituation geholfen werden
kann. Dazu gibt es auch schon Projektansätze mit guten Erfolgen (Tagelöhner
Projekte, ...) und die Pilotprojekte im AFit setzen auch genau hier an. Die Betreuung
ist zwar im ersten Schritt aufwändig und teuer – arbeitsmarktpolitisch und
volkswirtschaftlich zahlt sich diese individuelle Förderung aber in jedem Fall aus, da
die Erfolgschancen größer sind (ist für zukünftige strategische Ausrichtungen
mitzudenken).
15Handlungsfeld - Schnittstelle zu Betrieben ausbauen.
Der „Wettbewerb der besten Lehrlinge“ erschwert die Lehrplatzsuche massiv. Die
vielen Absagen der Betriebe, die vor allem Jugendliche mit besonderem
Unterstützungsbedarf immer wieder erfahren müssen, frustrieren die Jugendlichen.
Hier gilt es anzusetzen und mit den Wirtschaftskammern neue und zeitgerechte
Zugänge in die Betriebe und Standards für eine Lehrlingsausbildung festzulegen.
Auch die Erfahrungen zum Lehrlingscoaching in OÖ zeigen, dass dieses Angebot
dringend notwendig ist und ausgebaut werden muss. Allerdings ist vorstellbar, dass
der Zugang analog zum JUCO in den Pflichtschulen auch auf die Berufsschulen
ausgedehnt wird, da es dort mehr Möglichkeiten der Interaktion gibt und das
Coaching (langfristig) auch Entlastung für die Lehrer/-innen wäre.
In Oberösterreich gibt es bereits gute Kooperationen mit der Wirtschaft, die über die
Jugendnetzwerke gepflegt werden. Beispielhaft sind die Jugendbeschäftigungspakte
in Ried, Wels und Gmunden (Schärding arbeitet gerade an einem Commitment für
die Region zur Integration von Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen). Die
Pakte sind politische Willensbekundungen einer Region, an einem Strang zu ziehen
für bessere Beschäftigungschancen für die Jugend der Region und quasi eine Art
„Selbstverpflichtung“, dass jeder/jede, die mit im Boot ist, sich in seinem/ihrem
Bereich besonders dafür engagieren will. Bei regelmäßigen Treffen wird auch immer
wieder drauf geschaut, wo die Paktpartner/-innen stehen, wer wem in welcher Sache
unterstützen kann und was es zu speziellen Fragen/Herausforderungen braucht (das
wird in die oö Beschäftigungspolitik eingespielt über die Treffen zur
Arbeitsplatzstrategie OÖ 2020“ (strategische Steuerung), den Beschäftigungspakt
(Angebote und Förderungen zur Umsetzung und Erreichung der
arbeitsmarktpolitischen Ziele) und das „netzwerk.jugend.beschäftigung“ als operative
Steuerung (zentral/regional).
Handlungsfeld - Angebote am zweiten Arbeitsmarkt und im geschützten Bereich
schaffen.
Des Weiteren gibt es derzeit zu wenige Plätze für Jugendliche mit
Unterstützungsbedarf (Wartezeit von ein bis fünf Jahren) generell und auch die
Plätze für Jugendliche, die am ersten Arbeitsmarkt keine Chance haben, sind in
Oberösterreich zu wenig (es gibt hier bei bestehenden Einrichtungen wie z.B. Hof
16Tollet, FAB - pro work, Lebenshilfe etc. lange Wartezeiten). FAB-pro work in Ried im
Innkreis hat aktuell 10 Vorgemerkte auf der Warteliste (Stand Herbst 2013), auch die
Miteinander GmbH in Gmunden hat eine sehr lange Warteliste (im Herbst wurde ein
neuer Lehrling aufgenommen; insgesamt gibt es 7 Lehrplätze; nachbesetzt kann
immer nur dann werden, wenn einer aufhört;). Auch „Assista - soziale Dienste“ in
Vöcklabruck bietet Plätze zur Integration von Jugendlichen mit besonderen
Bedürfnissen durch Beschäftigung (keine Tagesstruktur sondern
Praktika/Kooperationen mit Betrieben). Aktuell werden 15 Klienten/-innen betreut
(Stand Sommer 2013). Auch hier gibt es wesentlich mehr Nachfrage und Wartelisten,
aber derzeit viel zu wenig Ressourcen. Das gilt generell für ganz Oberösterreich. Der
Arbeitsmarkt fehlt für diese Zielgruppe. Fazit: Arbeit an die Ressourcen der
Menschen anpassen.
Die Anzahl der Jugendlichen mit psychische und körperliche Beeinträchtigungen ist in
den letzten Jahren auch im Innviertel, wie zum Beispiel in den Projekten für
Arbeitsintegration bei RIFA in Ried im Innkreis bemerkbar ist. Weiteres steigt auch
die Zahl der Jugendlichen, die vollkommen unrealistische Wünsche und falsche
Selbsteinschätzungen haben. Jugendliche – oft ohne Beruf und sogar
Pflichtschulabschluss - bemängeln die ihnen angebotenen Arbeitsstellen und lösen
das Arbeitsverhältnis nach kurzer Zeit – ohne nachvollziehbaren Grund - wieder auf.
Dies wird auch immer wieder von den Streetworkern in OÖ bestätigt. Hier braucht es
bereits in der Schule mehr und gezieltere Berufsorientierung und auch intensive
(Zusammen)Arbeit mit den Eltern, die diese Haltungen oft unterstützen. Die
Studienergebnisse von IBE heben hervor, dass die Berufsorientierung als
langfristiger Reifungsprozess anzusehen ist, der auf die Talente, Stärken und
Interessen von Jugendlichen aufbaut und im Laufe der Schulkarriere sie an mögliche
Wege und Perspektiven heranführt.11 Aus diesem Grund ist es auch umso wichtiger,
dass die bestehenden Beratungs-, Ausbildungs- und Beschäftigungsangebote für
Jugendliche mit besonderem Unterstützungsbedarf auf ihre Potentiale aufbauen.
11
Studie und Handlungsleitfaden: Berufsorientierung und Berufsberatung von Jugendlichen mit
Migrationshintergrund. Am Beispiel Oberösterreich. IBE im Auftrag von Land OÖ, Linz 2011, S. 186 -
187
17Handlungsfeld – Bedarfskoordination für die Regionen
Analog zu den Bedarfskoordinatoren/-innen der Bezirkshauptmannschaften zur
Planung von Plätzen für Menschen mit Beeinträchtigung (die im
Chancengleichheitsgesetzt 2008 definiert wurden), könnten auch
Bedarfskoordinatoren/-innen für Plätze für ausgrenzungsgefährdete Jugendliche
entwickelt werden, die Unterstützung am Übergang von der Schule in die Arbeitswelt
und darüber hinaus brauchen (wäre Planungs- und Steuerungsinstrument und hätte
auch den Vorteil, dass die Betriebe besser planen können).
Handlungsfeld - Mehr Förderunterricht in den Schulen ermöglichen.
Insgesamt ist es wichtig, bereits in der Schule mit Fördermaßnahmen frühzeitig
anzusetzen, da hier die Jugendlichen noch erreichbar sind. Die Förderung der
Schüler/-innen ist auch eine Ressourcenfrage. Für die Jugendlichen, die im
Schulsystem gehalten werden (11. und 12. Schuljahr), sind in den Schulen keine
zusätzlichen Ressourcen vorhanden. Werden sie quasi „mitbetreut", muss die
Vorsorge und nicht die „Reparatur“ in den Vordergrund gestellt werden.
Ausbau der Schulsozialarbeit (SUSA): die Schulsozialarbeiter/-innen sind in
Oberösterreich bei der Jugendwohlfahrt angesiedelt. Das Angebot ist anonym,
kostenlos und freiwillig. SUSA ist ein präventiver Ansatz für Fälle, in denen (noch)
keine Kindeswohlgefährdung vorliegt. Die Schulsozialarbeiter/-innen sind direkt an
den Pflichtschulen und für Schüler/-innen und Lehrer/-innen tätig und für alle
„Lebensfragen“ Ansprechpartner/-innen. Aufgrund begrenzter Ressourcen gibt es
auch hier regionale Versorgungslücken in Oberösterreich.
Hilfreich wären hier auch die Etablierung von Frühwarnsystemen, die gefährdete
Jugendliche frühzeitig identifiziert.
Handlungsfeld - Helfersysteme im Schulumfeld ausbauen – community school.
Modelle, wie das der „community school“ wären hilfreich im Sinne einer
ganzheitlichen Sichtweise und Entwicklung der „Reparaturwerkstatt“ zu einer
„interdisziplinären“ und präventiven Begleitung der Jugendlichen vom Kleinkindalter
18bis ins Erwachsenenleben unter Einbindung der Eltern, der Kindergärten und Schulen
und des gesamten Systemumfeldes. Hier könnte man in der neuen
Strukturförderperiode ansetzen und innovative Modelle initiieren, die Bewährtes
bündelt und die Durch-lässigkeit der einzelnen Systeme sowie Vernetzung und
Kooperation fördern.
Die Helfersysteme im Schulumfeld können auch in besonders schwierigen
Situationen für Schüler/-innen ein Auffangnetz und für die Schulen relevant sein. Die
Thematik der Schulsuspendierung ist ein konkreter Fall, der für interne und externe
Betreuungspersonen eine Herausforderung darstellt. Es gibt keine einheitliche
Regelung im Umgang mit den Jugendlichen und Eltern in solchen Fällen. Aus diesem
Grund gehen die Schulen auch unterschiedlich vor (keinerlei Kontakt zu den
Jugendlichen oder trotzdem Kontakt mit Jugendlichen und Eltern). Im Sinne der
Vermeidung von erhöhter Schulabbruchs- und Ausgrenzungsgefahr können in diesen
Fällen Helfersysteme im Schulumfeld aktiv werden.
Handlungsfeld - One-Stop-Shops in Regionen mit hohen NEET-Zahlen entwickeln.
Tatsache ist, dass Maßnahmen dann angenommen werden, wenn es Jugendlichen
so einfach wie möglich gemacht wird, diese in Anspruch zu nehmen. Voraussetzung
ist laut aktueller NEET-Studie12 (Seite 26ff) ein flächendeckendes, flexibles und
dezentrales Maßnahmenangebot, das auf die Bedürfnisse der Jugendlichen
ausgerichtet ist. Ein Ansatz dazu sind die in Großbritannien entwickelten „One-Stop-
Shops“, die für die multiplen Problemlagen vieler Jugendlicher Hilfestellung unter
einem Dach bieten können. Hier wären auch die bestehenden Konzepte der offenen
Jugendarbeit und Sozialarbeit einzubinden.
Handlungsfeld – Anhebung der Altersgrenzen im Jugendcoaching
Für die Jugendlichen über 19 ist der Zugang zum Jugendcoaching grundsätzlich
eingeschränkt. Das Vorliegen eines SPF, einer Lernbehinderung oder eines
sozialen/emotionalen Handicaps ist erforderlich.
Der Träger aus dem Bereich der höheren Schulen meldet zurück, dass auch einige
Jugendliche - außerhalb der altersrelevanten JUCO-Zielgruppe (ab dem 9.
12
Studie zur arbeitsmarkpolitischen Zielgruppe NEET, ISW/IBE/JKU im Auftrag des BMASK, Wien
2013
19individuellen Schulbesuchsjahr) - in den Maturaklassen Jugendcoaching benötigen
würden. Es kommt vor, dass speziell in Maturaklassen, die Jugendlichen in 2 „Lager“
aufzuteilen sind: jene unter 19, welche das JUCO in Anspruch nehmen können und
jene über 19, die einen Behinderungsnachweis benötigen. Das vorrangige Ziel sollte
auf jeden Fall der erfolgreiche Schulabschluss sein.
In den Maturaklassen sind die Jugendlichen, unabhängig vom Alter, bereits sehr
nahe an dem Ziel des Schulabschlusses angelangt. Mit der Anhebung der
Altersgrenze könnte ein leichterer Zugang zum Jugendcoaching geschaffen werden.
Gleichzeitig kann damit auch die Abbruchsgefahr bei Jugendlichen mit besonderem
Unterstützungsbedarf im Abschlussjahr reduziert werden.
Handlungsfeld – Niederschwelligere Angebote für Jugendliche schaffen
Die Ansätze in der wirksamen Implementierung von Therapiekonzepten, in der
Schaffung von Angeboten am zweiten Arbeitsmarkt und im geschützten Bereich
sowie auch in der Entwicklung von One-Stop-Shops weißen darauf hin, dass
Jugendliche mit besonderem Unterstützungsbedarf niederschwelligere Angebote
benötigen. In Oberösterreich gibt es vielfältige Angebote für schulabbruchs- und
ausgrenzungsgefährdete Jugendliche am Übergang von der Schule in den
Arbeitsmarkt. Einige sind in hochschwelligen Bereichen für Jugendliche mit
besonderem Unterstützungsbedarf angesiedelt. Aus der Region Gmunden wird
rückgemeldet, dass niederschwellige Angebote für Jugendliche zwischen 18 und 24
fehlen. Einige Jugendliche mit besonderem Unterstützungsbedarf können an die
bestehenden Angebote nicht anschließen.13 Der Zugang für diese Zielgruppen soll
erleichtert werden durch: unbürokratische Betreuungsaufnahmen in die Angebote,
konzeptionelle Erweiterung der Angebote auf bestimmte Altersgruppen (unter 14
Jährige/über 18-Jährige), Optimierung des Übergabemanagements unter den
Anbietern/-innen, bedarfsgerechte und flexible Angebote.
13
Laut Einschätzung der Partner/-innen in Gmunden haben ca. 15 Jugendliche Bedarf an einem
niederschwelligen Angebot.
20Handlungsfeld – Existenzsicherung bei bestimmten Zielgruppen (z.B. obdachlose
Jugendliche)
Im Bereich der außerschulischen Jugendlichen sind die obdachlosen Jugendlichen
eine besondere Risikogruppe. Die genaue Zahl der obdachlosen Jugendlichen in
Österreich ist unbekannt. Im Jahr 2010 haben in Wien 1400 obdachlose Personen,
im Alter zwischen 18 und 29 Jahren, ein Wohnungsangebot in Anspruch
genommen.14 Hier ist anzunehmen, dass sich der überwiegende Anteil in einem
NEET-Status befindet.15
Die Partner/-innen machen auf die Thematik der obdachlosen Jugendlichen
aufmerksam.16 Es wird ein Mangel an Krisen- und Sozialwohnungen festgestellt, die
für die Existenzsicherung und die Inanspruchnahme von Leistungen wesentlich sind.
Handlungsfeld - Kontinuierliche Qualitätssicherung in der Angebotslandschaft.
Entwicklung gemeinsamer Know-Hows und Beratungs- und zertifizierter Coaching-
Qualität durch begleitende Reflexion und Evaluation. Zielführend wäre es, auch für
die Umsetzer/-innen immer wieder gemeinsame Weiterbildungen, zu
unterschiedlichsten Themenschwerpunkten anzubieten und dadurch eine
vergleichbare Qualität zu entwickeln. Zentraler Punkt dabei ist auch das Abbauen von
Konkurrenzen, das Kennenlernen des jeweils „Anderen“ (Zum Beispiel JUCO/offene
Jugendarbeit, …), Verständnis für unterschiedliche pädagogische und
erziehungswissenschaftliche sowie sozialarbeiterische Konzepte zu entwickeln und
auch unterscheiden zu können, wann welches Konzept zielführender ist.
Hilfreich wären hier auch gemeinsame Weiterbildungen von Berater/-innen, Coaches,
Trainer/-innen von Maßnahmen und Lehrlingsausbildnern, Führungskräften aus
Betrieben etc. Hier kann im Tun und gemeinsamen Lernen möglichst hoher
Lernerfolg sichergestellt werden (Lernen von den Vortragenden und den Kollegen/-
innen im Workshop – voneinander und miteinander und gleichzeitige Sensibilisierung
14
vgl. Riesenfelder, A.: Schelepa, S.; Wetzel,P. (2012): Evaluierung Wiener Wohnungslosenhilfe.
Wiener Sozialpolitische Schriften Band 4, verfügbar unter:
http://www.gv.at/gesundheit/einrichtungen/planung/pdf/evaluierung-wohnungslosenhilfe.pdf, 24. 09.
2013. In WISO Nr. 4/13, S. 109 – 110.
15
Wirtschafts- und sozialpolitische Zeitschrift (WISO) (2013) – NEET-Jugendliche: Eine neue arbeits-
marktpolitische Zielgruppe in Österreich. Bacher, Tamesberger, Leitgöb/Lankmayer, S. 110
16
Der Mangel an Krisen- und Sozialwohnungen wird auch aus Gmunden rückgemeldet.
21für das jeweils „Andere“, andere Sichtweisen und Perspektiven sowie Vernetzung).
Beispiele dazu sind die von der AKOÖ durchgeführten Workshops im Rahmen der
Jugendbeschäftigungspakte Wels und Ried sowie Salzkammergut
(Gmunden/Vöcklabruck).
Handlungsfeld - Diversität als Querschnittsthema in allen Angeboten am
Übergang von der Schule in die Arbeitswelt integrieren.
Migration
Österreich blickt auf eine seit den 1960er Jahren durch unterschiedliche Phasen der
Einwanderungspolitik gekennzeichnete umfangreiche Einwanderungsgeschichte
zurück. Derzeit haben etwa 16 Prozent der Schüler/-innen eine andere Erstsprache
als Deutsch. An den Volksschulen sind es 21 Prozent (Quelle: Nusche, Deborah,
Shewbridge, Claire, Rasmussen, Christian Lamhauge (2009), „OECD Reviews of
Migrant Education. Austria“, OECD 2009, herausgegeben vom BMUKK 2010; Seite
8ff). Etwa die Hälfte davon hat österreichische Staatsbürgerschaft. Dabei gibt es
beträchtliche regionale Unterschiede: 39 % in Wien, 8 % in der Steiermark oder in
Kärnten. Insgesamt unterrichten aber weniger als 20 % der österreichischen Schulen
keine Schüler/-innen mit anderen Erstsprachen. Das heißt, dass interkulturelles
Lernen und Fragen der Diversität in den Schulen nicht auf bestimmte
Regionen/Bereiche zutreffen, sondern alle betreffen und den Schulalltag in Österreich
prägen. Im Vergleich zu den in Österreich geborenen Mitschülern/-innen sind bei
Schüler/-innen mit Migrationshintergrund im Durchschnitt auf allen Ebenen
schwächere Schulische Leistungen zu beobachten. Das heißt, sie haben auch
größere Schwierigkeiten beim Übergang von der Pflichtschule in eine weiterführende
Schule, in die Lehre oder die Arbeitswelt.
Die OECD zieht den Schluss, dass diese Zielgruppe von einer Politik der
Chancengerechtigkeit profitieren würde und schlägt vor, dass im Sinne von
Chancengerechtigkeit Jugendlichen mit Migrationshintergrund mehr und vor allem
gezieltere Fördermaßnahmen bekommen müssten. Die bereits begonnenen
Entwicklungen hin zu strukturellen Reformen in der Elementarbildung (Early
Childhood Education Care, ECEC; Sprachscreening, verpflichtendes
Kindergartenjahr,…), Ausbau der Sprachförderung in Deutsch und den
Muttersprachen, interkulturelles Lernen als Lernprinzip an vielen Schulen und auch in
der Lehrer/-innen Aus- und Fortbildung müssen laut OECD in den kommenden
Jahren weiter verfolgt und intensiviert werden. Dazu braucht es auch politische
22Strategien. Zu fördern gilt es in diesem Zusammenhang auch die Vernetzung
zwischen Schule, Eltern und Migranten/-innen-Communities. Augenmerk ist aber
nicht nur auf die Migrationsfrage, sondern auch auf die Geschlechterfrage zu richten.
Im Sinne eines ganzheitlichen Verständnisses von Diversität sind auch hier
Weiterentwicklungen notwendig.
Gender
So kommt eine ESF-Studie (Pimminger, Irene (2010), Junge Frauen und Männer im
Übergang von der Schule in den Beruf; S. 4ff) zum Ergebnis, dass die
Bildungsnachteile von Frauen nicht nur der Vergangenheit angehören, sondern
mittlerweile umgekehrt die Sorge um Jungen und junge Männer als die neuen
„Bildungsverlierer“ den Bildungsdiskurs beherrschen. Junge Männer verlassen mit
rund 6 Prozent die Schule etwas häufiger als junge Frauen (rund 4 Prozent) ohne
Abschluss (Hochschulreife machen hingegen: 25 % Männer – 31 Prozent Frauen).
Insgesamt ist der Anteil der jungen Männer an den Abgängen ohne Schulabschluss
(rund 61 Prozent) oder mit Hauptschulabschluss (rund 56 Prozent) überproportional
und an den Abgängen mit allgemeiner Hochschulreife (rund 45 Prozent)
unterdurchschnittlich. Daten und Befunde weisen aber auch darauf hin, dass soziale
Herkunft und Migrationshintergrund einen entscheidenden Einfluss auf den
Bildungserfolg haben und zwar mehr als das Geschlecht. Fest steht auch, dass die
geschlechtsspezifischen Strukturen des Arbeitsmarktes trotz massiver Interventionen
und Bemühungen fortgeschrieben werden.
Zudem gelingt es Mädchen und (jungen) Frauen auch trotz besserer Ausbildungen
nicht, daraus einen Vorteil am Arbeitsmarkt zu lukrieren. Junge Frauen sind in der
dualen Ausbildung immer noch unterrepräsentiert (42 Prozent) und in der schulischen
Ausbildung stark überrepräsentiert (72 Prozent). Im Übergangssystem betrug ihr
Anteil im Jahr 2008 rund 44 Prozent. Bei den Ungelernten Quoten verhält sich der
Frauen- zum Männeranteil 15,4 zu 15,0 Prozent (2009). Das Risiko, ohne
Schulabschluss zu einem Berufsabschluss zu kommen, ist, wie Befunde zeigen,
hoch. Hier setzt auch das neue Gesetzt zum Nachholen von Schulabschlüssen an.
Bei Frauen hat dieses Faktum noch nachteiligere Auswirkungen, weil viele davon es
gar nie schaffen, am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen und nie in der Arbeitswelt
auftauchen. Die Erwerbsbeteiligung von Frauen ohne Berufsabschluss ist sehr
gering. Die Erwerbsquote von 24-. Bis 54 jährigen Frauen ohne Berufsabschluss
betrug 2010 61 Prozent, die der Männer 81 Prozent. Bei Frauen mit Lehrausbildung
23lag die Erwerbsquote in dieser Altersgruppe bei 84 Prozent, bei Männern bei 94
Prozent.
24Literatur
Bauer, Werner T. (2008), Zuwanderung nach Österreich, ÖGPP – Österreichische
Gesellschaft für Politikberatung und Politikentwicklung, www.politikberatung.or.at
Bergmann, Nadja, Willsberger, Barbara (2011), 15 Jahre Interreg/ETZ in Österreich –
Rückschau und Ausblick: von Humanressourcen, Arbeitsmärkten und Migration, L&R
Sozialforschung Wien
Bysse, S., Berry-Lound, D., Austin, J., Station, J. (2009), Best Practise in Tackling NEETs,
Research Report Hg.v. Learning and Skills Council Yorkshire and the Humber Region,
http://readingroom.lsc.gov.uk
Eurofund (2011), Junge Menschen und NEETs in Europa, erste Ergebnisse,
http://www.eurofund.europa.eu
Gregoritsch, Petra, Gude, Stefanie, Timar, Paul, Wagner-Pinter, Michael (2011), Nach der
Pflichtschule, Sythesis Forschung im Auftrag des AMS Österreich, Wien
Nusche, Deborah, Shewbridge, Claire, Rasmussen, Christian Lamhauge (2009), „OECD
Reviews of Migrant Education. Austria“, im Auftrag der OECD 2009, herausgegeben vom
BMUKK 2010
Omer Haim , Schlippe Arist(2010), Stäke statt Macht, Neue Autorität in Familie, Schule und
Gemeinde Vandenhoeck & Ruprecht, Februar 2010
Pimminger, Irene (2010), Junge Frauen und Männer im Übergang von der Schule in den
Beruf, Agentur für Gleichstellung im ESF, Berlin, 2. Aktualisierung Juni 2012
OECD Local Economic and Employment Development (LEED) Working Papers 2011/09,
Ensuring Labour Market Success for Ethnik Minority and Imigrant Youth, Francesca Froy,
Lucy Pyne, www.oecd.org/cfe/leed/forum/partnerships
25Steiner, Mario (2009), Early School Leaving und Schulversagen im österreichischen
Bildungssystem, in: BM_UKK (Hg.): Nationaler Bildungsbericht Österreich 2009, Band 2:
Fokussierte Analysen bildungspolitischer Schwerpunktthemen, 141-159, Graz
Studie zur arbeitsmarkpolitischen Zielgruppe NEET, ISW/IBE/JKU im Auftrag des BMASK,
Wien 2013
Studie und Handlungsleitfaden: Berufsorientierung und Berufsberatung von Jugendlichen mit
Migrationshintergrund. Am Beispiel Oberösterreich. IBE im Auftrag von Land OÖ, Linz 2011
Studie und Handlungsleitfaden: Berufsorientierung und Berufsberatung von Jugendlichen mit
Migrationshintergrund. Am Beispiel Oberösterreich. IBE im Auftrag von Land OÖ, Linz 2011,
Ergebnispräsentation,
http://www.ibe.co.at/fileadmin/AblageBox/Projektdownloads/ESF_Ergebnispraesentation.pdf,
dl. 13. 11. 2013
York Consulting (2005), Literature review oft he NEET Group, Edingburgh: Scottish
Exekutive Social Research, http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/77843/0018812.pdf,
10.11.2012
26Sie können auch lesen