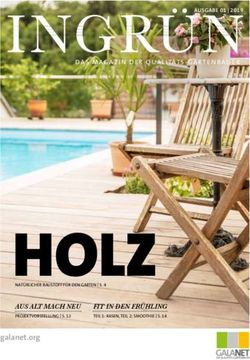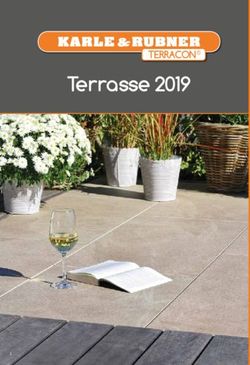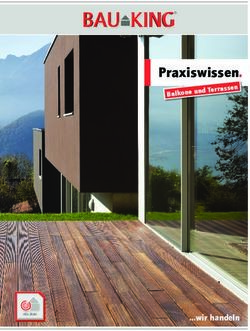Heizen mit nachwachsenden Rohstoffen: Chancen für Pellets, Holzhackschnitzel und andere Bio-Brennstoffe
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Modernes Heizen mit Holz
10. e.u.z- Baufachtagung
18./19.10.2001 Hannover
Heizen mit nachwachsenden Rohstoffen: Chancen für
Pellets, Holzhackschnitzel und andere Bio-Brennstoffe
Dipl. Ing. Regina Bähr, Dipl. Ing. Martin Klima, Ing. Büro Inco
Alexanderstr. 69-71,52062 Aachen
Tel 0241 / 47467-0, Fax 0241 / 404161
0. Vorwort
Mit Holz heizen: Im nördlichen Deutschland vor 10 Jahren noch behaftet mit dem
Stigma von Arbeit, Dreck und hohen Kosten. Dieses Negativimage haftet dem
Energieträger Holz weiterhin an, dabei hat sich in den vergangenen Jahren im
Bereich der Holzheizung ein von vielen nicht wahrgenommener Innovationsschub
vollzogen.
In allen Bereichen, von der Stückholzverbrennung über Hackschnitzel bis zu
Holzpellets sind Techniken entwickelt worden, die den spezifischen Anforderungen
des Gutes gerecht werden und damit effizient, sauber, schadstoffminimiert und
nahezu vollautomatisch verbrennen. Mit Holz heizen bedeutet:
• Nahezu CO2- neutral heizen, es wird nur im Holz gebundenes CO2 freigesetzt
• Fossile Energieträger ersetzen und damit zukünftigen Generationen zur
Verfügung stellen
• Die regionale Forstwirtschaft stärken und damit Arbeitsplätze in der Region
erhalten und neu schaffen
Dass wir die vorhandenen Biomassepotentiale nutzen müssen, haben sowohl der
Ministerrat der EG als auch die Bundes- und Landesregierungen erkannt. Durch neu
aufgelegte Förderprogramme werden effiziente Holzheizungen unterstützt und deren
Marktverbreitung gefördert. Hervorzuheben sei hier das Förderprogramm des Landes
NRW (HAFÖ), welches den Einsatz automatisch befeuerter Holzheizungen mit bis zu
40% der Investitionskosten fördert. Dieses Programm hat im Jahre 2001 eine rege
Nachfrage erfahren und wird in 2002 voraussichtlich wieder aufgelegt.
Die Kostensteigerung der klassischen fossilen Energieträger in Verbindung mit einer
Preisstabilität bei Holzpellets und Hackschnitzel machen diese Energieträger
ebenfalls interessant.
1. Das Energieholzpotential
Bei der Diskussion um den verstärkten Einsatz von Holz als Brennstoff steht die
Frage nach der ausreichenden Verfügbarkeit von Holz schnell im Raum. Die Angst,
dass der Einsatz von Holz als Brennstoff zu zusätzlichen Rodungen und einer
Gefährdung des Waldes führt, wird immer wieder geäußert, ist aber, wie die
nachfolgenden Ausführungen zeigen werden, völlig unbegründet. Die Tabelle 1.1
1Modernes Heizen mit Holz
10. e.u.z- Baufachtagung
18./19.10.2001 Hannover
zeigt die bei nachhaltiger Waldnutzung verfügbaren Brennholzpotentiale
/Passivhausinstitut/.
Quelle Volumen Masse Energiegehalt
Bisher nicht 20 Mio m³/a 10 Mio t/a 50 Mrd kWh/a
geernteter Anteil an
Holzzuwachs
Schwachholz 12 Mio m³/a 6 Mio t/a 30 Mrd kWh/a
Sägenebenprodukte 3 Mio m³/a 1,5 Mio t/a 7,5 Mrd kWh/a
Landschaftspflegeholz 1,4 Mrd kWh/a
Gesamt 88,9 Mrd kWh/a
entspricht 8,89 Mrd l Öl/a
Tabelle 1.1 Brennholzpotenzial im Überblick
In der Bundesrepublik Deutschland wird mit einem jährlichen Aufkommen von 8 Mio
t Altholz gerechnet (0,1 t je Einwohner) /Forstabsatzfond 1998/. Ein Teil dieses
Holzes ist naturbelassen (z.B. Obstkisten, Paletten, Bauzäune) und für den Einsatz in
Holzhackschnitzelkesseln sehr interessant, da sie zu günstigen Preisen abgegeben
werden. Ob der Einsatz von unbehandeltem Altholz in Anlagen, die nach der 1.
BImsch betrieben werden (Anlagen unter 1 MW) und keiner Genehmigung bedürfen,
zulässig ist, könnte nicht eindeutig geklärt werden (Reduzierung des Einsatzes auf
Kessel in holzverarbeitenden Betrieben).
In einzelnen Bundesländern (z.B. Rheinland-Pfalz) konnte eine Sondergenehmigung
für den Einsatz von unbehandeltem Altholz erreicht werden. Hierbei lehnte man sich
an die Deklarierung der Altholzverordnung des Landes Rheinland Pfalz
/MfUuF,1998/.
Dennoch, nimmt man z.B. an, dass die Gesamt-Wohnfläche der Bundesrepublik
einen Energieverbrauch für Heizung und Warmwasserbereitung wie der derzeitige
Bestand aufweist (ca. 270 kWh/m²a), dann kann mit der jährlich anfallenden Menge
an o.g. Hölzern ca. 11% des Wärmebedarfs abgedeckt werden. Nimmt man an, dass
alle Gebäude auf Niedrigenergiehausstandard getrimmt werden, so können ca. 32%
mit diesem Holzanteil versorgt werden. Bei Annahme von Passivhausstandard sind
es sogar über 80%.
Hieraus können zwei wesentliche Aufgaben für die Zukunft abgeleitet werden:
ο Verbesserung des Wärmedämmstandards und
ο erhöhter Anteil bei der energetischen Holznutzung.
Derzeit sind wir noch weit von einer Ausschöpfung der vorhandenen, nachhaltig
nutzbaren Potentiale entfernt. Die umweltpolitischen Signale sagen jedoch deutlich,
dass wir diese Potentiale schnell und effizient nutzen sollten. Die energetische
Nutzung von Hackschnitzeln und Holzpellets ist hier ein sinnvoller undnotwendiger
Weg.
2Modernes Heizen mit Holz
10. e.u.z- Baufachtagung
18./19.10.2001 Hannover
2. Holzhackschnitzel
Für die Nutzung als Brennstoff können Holzhackschnitzel aus Waldholz, der
Landschaftspflege, aus Sägewerksnebenprodukten und aus naturbelassenem Altholz
eingesetzt werden.
Hackschnitzelkessel benötigen immer höhere Investitionskosten als konventionelle
Kessel für fossile Energieträger. Die Verbrennungstechnik ist aufwendiger und der
Platzbedarf für die Kesseltechnologie und für Speicherung des Gutes höher als bei
Öl oder Gas.
Deshalb ist der Einsatz einer Hackschnitzelheizung immer dann sinnvoll, wenn
entweder der Brennstoff günstig verfügbar ist (Forstwirte, Bauernhöfe mit
Forstwirtschaft, Gemeinden mit eigenen Forsten und Forstarbeitern etc.) oder das zu
versorgende Gebäude eine so hohe Anschlussleistung besitzt, dass die hohen
Investitionskosten durch den niedrigeren Brennstoffpreis (auf dem freien Markt)
aufgefangen werden.
Sehr gute Eignung
⊕ Schulen Krankenhäuser, Wohnheime, Schwimmbäder
⊕ Holzverarbeitende Betriebe mit Trocknungsanlagen
⊕ Molkereien, Brauereien, Schlachthöfe
⊕ Wohngebiete mit dichter Bebauung, mehrgeschossige Bauten
Bedingte Eignung
∅ Wohn-/Neubaugebiete mit flächiger Bebauung
∅ Kleinere kommunale Gebäude
∅ Gemischte Gewerbegebiete
∅ Industrieanlagen
Schlechte Eignung
! Einzelne Wohnhäuser (Ein- und Zweifamilienhäuser)
! Kleine Einzelobjekte mit geringem Wärmebedarf
Tabelle 2.1 Eignung von Objekten zur zentralen Wärmeversorgung mit HHS
/hessenenergie,2001/
Brennstoffqualität
Bei der Beurteilung der Hackschnitzel lehnt man sich an eine österreichische Norm
an //Marutzky, 1999/ /. Sie teilt das Hackgut in Abhängigkeit von der Größe, dem
Wassergehalt, der Schüttdichte und dem Aschegehalt in verschiedene Klassen ein.
3Modernes Heizen mit Holz
10. e.u.z- Baufachtagung
18./19.10.2001 Hannover
A)Hackgutklasse Zulässige Massenanteile und jeweilige Zulässige
Bandbreite für Teilchengrößen (Siebanalyse) Extremwerte für
in mm Teilchen
Max. 20 60-100% Max 20 % Max. 4 % Max Max.
% Querschni Länge
tt
G30 >16 16-2,8 2,8-1 31,5 31,5-5,6 5,6-1 63 63-11,2 11,2-1 250 kg/m³ „hohe Schüttdichte“
D) A1 >1% „geringer
Aschegehaltsklasse Aschegehalt“
n
A2 1-5 % „erhöhter
Aschegehalt“
Tabelle 2.2 Einteilung der Qualität der Hackschnitzel nach Önorm M7133
/Marutzky1999/
Je kleiner, trockener und dichter das Hackgut, desto teurer ist es.
Die Qualität der Materials bestimmt natürlich auch die Wahl der Verbrennungs- und
Beschickungstechnologie.
Brennstofflagerung
Die Brennstofflagerung erfolgt meist in Spänebunkern, bei größeren Anlagen auch in
offenen Lagerhallen mit befahrbarem Schubboden.
Auch die Bunker besitzen Schubböden, die das Hackgut in die
Kesselfördereinrichtung einbringen. Bei kleineren bis mittleren Kesseln werden hier
Schneckenförderer eingesetzt, die eine hohe Anforderung an die Hackgutklasse
stellen.
4Modernes Heizen mit Holz
10. e.u.z- Baufachtagung
18./19.10.2001 Hannover
Bei größeren Kesseln werden Stempelförderer eingesetzt, die das Hackgut in den
Kessel drücken. Die Anforderungen an die HS-Qualität ist gering, sie können auch
einzelne armdicke Hölzer verarbeiten und funktionieren im wesentlichen störungsfrei.
Bei kleineren Wohnhäusern wird das Speichervolumen nach dem Bedarf und der
Lagerfähigkeit des Gutes bestimmt. Ziel ist es u.a., die Anzahl der Beladungen des
Bunkers nicht zu hoch ausfallen zu lassen, um den Bedienungskomfort zu erhöhen.
Bei größeren Anlagen greifen andere Kriterien. Hier werden die Speichervolumina so
optimiert, dass das Speichervolumen abhängt von dem Bedarf und den Kosten der
Anlieferung. So wurde im Projekt Solarsiedlung Bonn-Tannenbusch das
Speichervolumen des Spänebunkers mit ca. 110 m³ so gewählt, dass ein
Sattelschlepper mit Hänger abkippen kann.
Bild 2.3 Spänebunker im Projekt Bad Neuenahr.
Kesseltechnologie
Die Dimensionierung des Hackschnitzelkessels hängt von mehreren Parametern ab.
Bei monovalenter Versorgung muss der Kessel auf den Wärmebedarf ausgelegt
werden. Bei bivalenten Anlagen mit zusätzlichem Energieträger (Öl oder Gas) muss
ein Kompromiss gefunden werden. Die Versorgungssicherheit, Investitionskosten,
Qualität des Hackgutes und Wärmenachfrage sind die wesentlichen
Einflussparameter. Sinnvoll ist es, eine möglichst hohe Auslastung des Kessels bei
Volllast zu erreichen, auch wenn moderne Kessel bis auf ca. 30% ihrer Nennleistung
heruntergefahren werden können (dann steigen jedoch die Verluste und die
Emissionen).
Oft werden Hackschnitzelkessel auf 20 – 50% des Wärmebedarfs ausgelegt, damit
können 60 – 80% des Jahreswärmebedarfs abgedeckt werden. Die spezifischen
Investitionskosten der Gesamtanlagen liegen nach hessischen Erfahrungen in der
Bandbreite von 500 bis 940 DM je kW und sind abhängig von den äußeren
Rahmenbedingungen. Die Aufteilung auf die einzelnen Bereiche wurde wie folgt
festgestellt: Kesselanlage+Steuerung ca. 30%, Fördereinrichtung ca. 14%, Baukörper
5Modernes Heizen mit Holz
10. e.u.z- Baufachtagung
18./19.10.2001 Hannover
ca. 24%, Rauchgasreinigung+Abgassystem ca. 11%, wärmetechnische Einbindung
ca 10%, Planungskosten ca. 11% /Hessenenergie,2000/.
Technisch verfügbar sind Hackschnitzelkessel ab einer Leistung von ca. 20 kW bis
hin zu einer Leistung von mehreren Megawatt.
Kleinere Kessel werden meist mit Unterschubfeuerungen eingesetzt. Bei größeren
Kesseln ist die Vorschub-Treppenrostfeuerung die günstigste Art, da hier große
Schwankungsbreiten an Feuchte und Größe des Hackgutes zugelassen werden
können.
Beispiel Bad Neuenahr – erstes Biomasse-Nahwärmenetz in Rheinland-Pfalz
63 Einfamilienhäuser in Niedrigenergiebauweise werden in Bad Neuenahr durch ein
Biomasse-Nahwärmenetz mit Wärme für die Heizung und Warmwasser versorgt. Das
Projekt wurde vom Land Rheinland-Pfalz gefördert und erhielt im Jahre 2000 den
Staatspreis des Landes.
Es wurde eine Nahwärmezentrale für die ganze Siedlung realisiert, die mit einem
Holzhackschnitzelkessel (300kW) und einem Gaskessel für die Spitzenlast
ausgerüstet wurde.
Die Wärme wird über ein erdreichverlegtes Nahwärmenetz verteilt und mittels
entsprechender Wärmeübergabestationen an die einzelnen Häusern übergeben. Ein
Pufferspeicher von 10 m³ deckt Spitzennachfrage im Teilastbetrieb und glättet somit
die Leistungsanforderung an den Kessel .
Der Holzhackschnitzelbunker mit einem Volumen von 80 m³ fasst den Holzbedarf für
ca. 1 Woche in der Heizperiode. Aus dem Bunker werden die Holzhackschnitzel über
hydraulisch angetriebene Schubböden und Stempel in den Kessel gefördert.
Die Anlage hat zwei Heizperioden hinter sich und lief bisher zur vollsten
Zufriedenheit. Die Wärmekosten der Häuser sind trotz Anheiz- und
Trockenheizbetrieb sowie Teilbeheizung vergleichbar zu einer konventionellen
Versorgung mit Gas- Einzelthermen. Innerhalb dieser Zeit wurde der Gas-Kessel nur
ein einziges Mal bei einer Revision der Stempelförderung (eingeklemmtes Metallteil)
in Betrieb genommen.
Bild 2.4 Die Siedlung „Alte Ziegelei“ in Bad Neuenahr.
6Modernes Heizen mit Holz
10. e.u.z- Baufachtagung
18./19.10.2001 Hannover
Bild 2.5 Die Unterverteilungen in den Häusern, Wärmesatelliten mit
Wärmemengenzähler, Plattenwärmetauscher für die Warmwasserbereitung und
Strangregulierung für die Heizungsanlage.
7Modernes Heizen mit Holz
10. e.u.z- Baufachtagung
18./19.10.2001 Hannover
Bild 2.6 Blick in den Kesselbrennraum im Betriebszustand Gluterhaltung.
Die Solarsiedlung Bonn-Tannenbusch
Die Erfahrungen der Siedlung in Bad Neuenahr wurden auf die Konzeption einer der
50 Solarsiedlungen des Landes NRW übertragen, die in Bonn-Tannenbusch mit dem
Bauträger dfh derzeit realisiert wird. Technisch gesehen wird hier ähnliches realisiert
wie in Bad Neuenahr, nämlich eine Nahwärmeversorgung für ca. 85 Wohneinheiten
über einen zentralen Holzhackschnitzelkessel (300kW) und einen Gasspitzenkessel.
Die Übergabe der Wärme erfolgt in Bonn-Tannenbusch zeilenweise, d.h. in
Unterzentralen für jeweils 4-6 Häuser wird eine Wärmeübergabestation vorgesehen.
Zusätzlich sind, entsprechend der Anforderungen an eine Solarsiedlung, thermische
Kollektoren und Fotovoltaikmodule vorgesehen. Die gesamte Wärmeversorgung wird
im Contractingverfahren realisiert. /Klima, 2001/.
Abb. 2.7 Zeilenweise Versorgung über Nahwärme mit solarer Warmwasserbereitung
im Projekt Bonn Tannenbusch
8Modernes Heizen mit Holz
10. e.u.z- Baufachtagung
18./19.10.2001 Hannover
3. Holzpellets
Holzpellets sind Presslinge aus naturbelassenem Holz. Sie sind u.a. in der DIN 51731
genormt. Entsprechend dieser Norm haben Holzpellets der Größengruppe HP5 einen
Durchmesser von 4 bis 10 mm und eine Länge unter 5 cm. Der Heizwert liegt bei 4,9
kWh/kg, was etwa dem Heizwert von einem halben Liter Heizöl entspricht. Der
Ascheanteil der Pellets liegt bei 0,4 bis max. 1,5%. Die Asche kann über den
Hausmüll entsorgt werden.
Der Brennstoff eignet sich auf Grund seiner Homogenität hervorragend für den
automatisierten Betrieb in kleinen bis mittleren Leistungsbereichen bis 150 kW (in der
BRD). In anderen Ländern wie Schweden, Dänemark oder Italien, die auf Grund von
höherer Besteuerung durch erheblich höhere Energiepreise gekennzeichnet sind,
werden auch Kessel und Heizkraftwerke im Megawattbereich mit Pellets befeuert.
Für die Herstellung von Pellets muss ca. 2,45 % des Energiegehaltes der Pellets
eingesetzt werden. Der Vorgang des Pelletierens stellt mit 1,5 % den
energieaufwendigsten Posten dar. Diese Angaben beziehen sich auf die Herstellung
von Pellets aus Hobelspänen. /Bergmair, 1996/.
Rohstoffpotentiale für die Pelletproduktion
Wie bereits weiter oben geschildert, ist das Potential an nachwachsendem Rohstoff
Holz noch lange nicht erschöpfend genutzt. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie für
eine Pelletproduktion in der Region Eifel/Ardennen wurde dies näher untersucht
/Klima2,2001/.
Zur Produktion von Pellets werden vornehmlich Hobelspäne und bei steigender
Nachfrage auch Sägespänen eingesetzt. In der Eifel/Ardennen-Region ist in einem
Umkreis von 100 km beispielsweise ein Potential von ca. 180.000 t atro/Jahr an
Hobel- und Sägespänen vorhanden. Dieses Material wird derzeit über weite Strecken
transportiert, um einer Entsorgung zugeführt zu werden. An einer wirtschaftlichen
Weiterverarbeitung der Späne sind die Säge- und Hobelwerke dieser Region sehr
interessiert. Mit diesem Spänepotential kann problemlos eine Pelletproduktion von
50.000 to Pellets pro Jahr versorgt werden. 50.000 to Pellets reichen für die
Versorgung von ca. 10.000 Einfamilienhäusern in Niedrigenergiehausbauweise.
In derselben Studie wurde untersucht, wie sich der mögliche Absatzmarkt für Pellets
in der weiteren Umgebung (ca. 200 km) entwickeln wird. Anhand statistischer Daten
und der derzeitigen Entwicklung der Pellets und Pelletsfeuerungenproduktion können
positive Signale für die Produktion und den Absatz von 50.000 t. für das Jahr 2005
getroffen werden.
9Modernes Heizen mit Holz
10. e.u.z- Baufachtagung
18./19.10.2001 Hannover
Sieht man die Entwicklung bei den Förderanträgen zu Pelletfeuerstätten in NRW und
die agile Markttätigkeit von Kesselherstellern in diesem Bereich, so lassen sich auch
hieraus positive Signale ableiten.
Energiekosten - Pellets im Vergleich
Die Kostensteigerung der letzten Jahre für die konventionellen fossilen Energieträger
Kohle und Gas hat den Holzpellets einen weiteren Schub gebracht. Je nach Größe
des Kessels und damit Brennstoffbedarf kann man derzeit schon konkurrenzfähig mit
Pellets heizen. Die Tabelle 3.2 gibt hier einen groben Vergleich zu anderen
Energieträgern.
Brennstoff Energieinhalt Energiekosten
Pellets 15 kg Sack 5 kWh/kg 9 – 12 Pf/kWh
Pellets Tankwagen 5 kWh/kg 6 – 8 Pf/kWh
Erdgas (inkl. Zählerk.) 10,0 kWh/m³ 7 – 9 Pf/kWh
Heizöl EL 10 kWh/Liter 8 –10 Pf/kWh
Flüssiggas 6,5 kWh/Liter 12 –15 Pf/kWh
Tabelle 3.2 Pellets im Vergleich – Energiekosten
Einen aktuellen Vergleich bei einer Abnahmemenge von umgerechnet 2000 Liter
Heizöl zeigt die folgende Tabelle, die für den Raum Aachen die Situation Anfang
Oktober 2001 wiederspiegelt.
Brennstoff Heizöl (EL) Erdgas Pellets
l m³ kg
Heizwert (kW h/E inheit) 10 10,28 5
Heizwärmebedarf kW h/a 20000 20000 20000
Jahresnutzungsgrad
Heizungsanlage 0,85 0,87 0,82
Grundpreis 348
Kosten DM /Einheit 0,78 0,75 0,40
Jahresheizkosten DM /a 1844 2015 1957
Rahmendaten: EFH incl W W - B ereitung Stand 10/2001
W ert Heizöl nach myoil.de, durchschnittlicher Heizölpreis im Raum Aachen 9/2001
W ert Gas nach Gaspreisliste STAW A G ab 1.10.2001
Tabelle 3.3 Pellets im Vergleich- aktueller Kostenvergleich für die Region Aachen
Die Ergebnisse zeigen keine wesentlichen Unterschiede zwischen den
Energieträgern auf. Eine Beheizung mit Pellets ist also in der Region Aachen derzeit
kostenneutral zu einer Beheizung mit Öl oder Gas. Für andere Regionen in der BRD
mag das erheblich anders aussehen (z.B. Rhein-Main-Region mit hohen
10Modernes Heizen mit Holz
10. e.u.z- Baufachtagung
18./19.10.2001 Hannover
Gaspreisen). Eine Prognose für die Zukunft abzugeben, ist angesichts der derzeitigen
Situation schwerlich möglich. Für die Pellets kann jedoch eher von sinkenden als von
steigenden Kosten ausgegangen werden.
Die Pelletverbrennung
Durch die Homogenität und Kompaktheit des Energieträgers Pellets lässt sich die
Verbrennungstechnologie gut anpassen. Dies gilt sowohl hinsichtlich der
Feuerungstechnik für Holz (zweiphasige Luftzufuhr) als auch hinsichtlich der
Regelfähigkeit des Anlagentechnologie. Eine für Holzfeuerungen, aber auch andere
fossile Brennstoffe bis dahin nicht gekannte Leistungsreduzierung bis auf 2 kW
Feuerungsleistung machen diesen nachwachsenden Rohstoff auch für
Niedrigenergie- und sogar Passivhäuser interessant.
Bild 3.1 Der Pellet-Kaminofen von Wodtke
In dem Anwendungssegment Niedrigenergie- und Passivhäuser kann der Pellet-
Kaminofen eingesetzt werden. Abgeleitet vom klassischen Kaminofen werden hier
Pellets in einem Leistungsbereich von 2 bis 10 kW verbrannt. Dabei kann von dieser
Leistung bis zu 80% an einen integrierten Wärmetauscher abgegeben und der
Heizung und Warmwasserbereitung zugeführt werden, wie folgendes Anlagenschema
zeigt.
11Modernes Heizen mit Holz
10. e.u.z- Baufachtagung
18./19.10.2001 Hannover
Bild 3.2 Der Pellet-Kaminofen in Kombination mit einer Solaranlage und einem
Kombi Pufferspeicher für Heizung und Warmwasserbereitung /ProSolar,2000/
Somit kann in einem Niedrigenergiehaus mit dem Kaminofen der gesamte
Wärmebedarf für Warmwasser und Heizung regenerativ gedeckt werden. Die
Verbindung mit einer Solaranlage zur Warmwasserbereitung in den Sommer- und
Übergangsmonaten bietet sich an.
Der Kaminofen kann auch in der Altbausanierung und zur Ergänzung der
konventionellen Heizungsanlage herangezogen werden.
Im Sommer 2001 hat ein österreichischer Lieferant einen Kamineinsatz für von
Specksteinöfen entwickelt, der voraussichtlich ab 2002 auf dem Markt verfügbar sein
wird. Auch dies zeigt, wie stark offensichtlich die Motivation und/oder Marktnachfrage
nach diesem Brennstoff auch in „Nischenmärkten“ ist.
Natürlich kann der Kaminofen ohne integrierte Warmwasserbereitung auch als Ersatz
für den konventionellen Kaminofen herangezogen werden oder als Heizmedium für
selten benutzte Räume/Wohnungen wie z.B. Ferienhäuser etc. Eine automatische
Zündung in Verbindung mit einer programmierbaren Steuerung oder Anbindung über
Modem an das personal web ist auf dem Markt verfügbar.
12Modernes Heizen mit Holz
10. e.u.z- Baufachtagung
18./19.10.2001 Hannover
Zentralheizungsanlagen
1-Brennerteller 10- Brennerschnecke
2-Flammrohr 11-Hauptantrieb und Getriebe
3-Aschebox 12- Brandschutzklappe
4-Wärmetauscher mit Reinigungsfeder 13- Raumaustragungsschnecke
5- Reinigungsmotor 14- Steigschnecke
6- Gebläse 15 – Antriebsmotor Schnecken
7- Wärmedämmung 16- Saugzuggebläse
8- MES- Regelung
9-Elektro- Zündung
Bild 3.3 Querschnitt durch einen Pelletkessel /Ökofen,2000/
Zentrale Pelletkessel sind mittlerweile von vielen Anbietern in einem Leistungsbereich
von 5 bis zu 60 kW am Markt erhältlich. Sie bieten einen ähnlichen Komfort wie
konventionelle Öl- oder Gasheizungen.
Der in Größe und Qualität genormte Brennstoff Holzpellet wird über Förderschnecken
und/oder Saugsysteme vollautomatisch in den Pelletkessel gefördert. Durch einen
speziellen Brennertopf und eine geregelte Luft- und Brennstoffzufuhr durch eine
elektronische Steuerung wird eine optimale, saubere Verbrennung ermöglicht. Die
Zündung der Pellets erfolgt automatisch über eine elektrische Vorrichtung (Glühstab
oder Heißluftfön). Durch eine geregelte Luft- und Brennstoffzufuhr kann der Kessel
die Leistung im Bereich von 30- 100% modulieren
Mit einer Pelletheizung lässt sich jede Art von wasserbetriebenem
Wärmeabgabesystem betreiben, wie beispielweise Radiatoren, Fußboden-, Wand-
und Deckenheizung.
Die derzeit am Markt befindlichen Kessel weisen z.T. deutliche Unterschiede im
Wirkungsgrad 84 - 94% (bei Nennleistung)), Emissionen (z.B. CO 32,4 – 273,6 mg/
kWh), Stromverbrauch (338- 660 kWh; bei 2750 Volllaststunden),
Wartungsfreundlichkeit ( mit / ohne automatische Entaschung; mit / ohne
Aschekomprimierung, mit / ohne automatische Rauchgaszugreinigung), Preis etc.
auf. Die in Klammern genannten Werte entstammen einem in unserem Büro
13Modernes Heizen mit Holz
10. e.u.z- Baufachtagung
18./19.10.2001 Hannover
erstellten Vergleich von 12 Kesselfabrikaten (Auswahl siehe Anhang). Unseres
Wissens gibt es bisher keinen umfassenden Vergleich der in Deutschland am Markt
erhältlichen Kessel. Eine Lücke, die zum Wohle der Verbraucher geschlossen werden
müsste.
Bild 3.4 Automatische Reinigung der Rauchgaszüge an einem Pelletkessel (KWB)
Ein wesentlicher Punkt ist die Reinigung des Kessels bzw. Kaminofens und die
Entsorgung der Asche. Hier reicht die Bandbreite von manueller Reinigung bis hin zur
vollautomatischen Reinigung und Komprimierung der Asche, so dass nur noch ein-
bis zweimal in der Heizperiode die Asche aus dem Aschekasten entsorgt werden
muss.
Bei größeren Kesseltypen im Bereich von 100 kW und mehr wird auf die Technologie
zurückgegriffen, die bei Hackschnitzelkesseln bekannt ist.
Eine interessante Überlegung ist der Einsatz von Pelletkesseln in Solarsiedlungen.
Eine Zeile von 4 bis 10 Häusern (je nach Dämmstandard) kann von einem Kessel
versorgt werden. In Verbindung mit thermischen Solaranlagen, Windkraftanlagen und
Fotovoltaikanlagen ist so eine „LOW-CO-TWO“ Siedlung machbar.
14Modernes Heizen mit Holz
10. e.u.z- Baufachtagung
18./19.10.2001 Hannover
Bild 3.5 Konzept für den Einsatz eines Pelletkessels in einer Solarsiedlung
Pelletkessel können in diesem Leistungsbereich alternativ zu Gas- oder Ölkesseln
eingesetzt werden. Besonders der Bereich der Altbausanierung ist in den nächsten
Jahren interessant, da hier ein nachwachsender Rohstoff die fossilen Rohstoffe
substituieren kann. Bei Vorhandensein einer alten Öltankanlage reicht meist der
vorhandene Platz aus, um einen Pelletlagerraum zu errichten.
Die Lagerung der Pellets
Die Anlieferung der Pellets erfolgt bei Sackwarenlieferung im 15 kg- oder 30 kg-Sack.
Die lose Lieferung erfolgt über einen Tanklaster, der ca. 30 m Entfernung zwischen
Laster und Lagereinfüllstutzen überbrücken kann.
Anwendungsbeispiel kWh/a Lager-
Volumen
Altbau, Holz-Zentralheizung 37.300 11,48 m³ 100
%
NEH-Holzheizung 16.809 5,17 m³
45%
PH-Holz-Zentral-Kessel 7.367 2,27 m³
20%
PH-Holzofen, nur Raum- 2.462 0,79 m³
heizung 7%
Tabelle 3.1 Pellets im Vergleich, Lagerbedarf bei unterschiedlichem Dämmstandard
15Modernes Heizen mit Holz
10. e.u.z- Baufachtagung
18./19.10.2001 Hannover
Für die Lagerung der Pellets sind unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten am Markt.
Wird im Passivhaus ein Pelletkessel nur zur Raumheizung eingesetzt, so reichen hier
ca. 30 Sack à 15 kg aus. Diese kann man bequem in einem Nebenraum oder der
Garage lagern. Weit darüber hinaus gehende Mengen sollten in einem speziellen
Lagerbehälter/-raum untergebracht werden.
Sacksilos können zwischen 2 - 7 t Pellets lagern. Sie sind für die Innenaufstellung
gedacht, auch eine Außenaufstellung von Silos ist denkbar (bei ausreichender
Stellfläche und architektonischer Integrationsfähigkeit). Seit 2001 bietet ein Hersteller
einen Erdtank als Lagermöglichkeit an.
Die „normale“ Variante ist der Umbau eines Raumes zu einem Lagerraum. Dieser
wird mit einem Schrägboden zur besseren Entnahme der Pellets ausgerüstet. Der
Lageraum kann über Einblasstutzen von einem Silowagen mit Pellets befüllt werden.
Hierzu ist es notwendig darauf zu achten, dass der Abstand zwischen Einblasstutzen
und Standmöglichkeit des Silowagens 30 m nicht überschreitet.
Bild
3.6
Lagermöglichkeit der Pellets in einem Erdtank außerhalb des Hauses /Nau,2000/
16Modernes Heizen mit Holz
10. e.u.z- Baufachtagung
18./19.10.2001 Hannover
Bild 3.7 Beispiel für einen Pellet Lagerraum /Ökofen,2000/
Beispielprojekt: Die Solarsiedlung Bilderstöckchen
Die Siedlungsgesellschaft am Bilderstöckchen wurde 1932 von mehreren
katholischen Vereinen gegründet, um preiswerten Siedlungsbau auf einem
ehemaligen Militärgelände zu errichten. Das zur Sanierung als Solarsiedlung
anstehende Projekt wurde 1909 als Artilleriedepot errichtet und 1937 als erste
Mietwohnbebauung der Gesellschaft fertig gestellt. Im Hinblick auf die „Bewahrung
der Schöpfung“ will man besonders den Einsatz erneuerbarer Energien im
Mietwohnungsbau verfolgen.
Die lang gestreckte Hauszeile wird durch veränderte Wohngrundrisse, Erweiterungen
der umbauten Fläche sowie die Aufstockung von ehemals 69 Wohneinheiten mit
durchschnittlich 46 m² Wohnfläche auf zukünftig 78 Wohnungen mit einer breiten
Nutzungspalette ausgebaut. Auf insgesamt 5.510 m² wird nordwestlich des Kölner
Stadtzentrums bezahlbarer, energetisch wirtschaftlicher Wohnraum erstellt (Zwei- bis
Vierraum- Wohnungen).
Der Heizenergieverbrauch soll durch Realisation des NEH-Standards im
Altbaubestand gegenüber der alten Bebauung um 80% reduziert werden.
Der Einsatz einer zentralen Abluftanlage trägt nicht nur zur Reduktion des
Energieverbrauchs bei, sondern verbessert auch die Luftqualität in den Wohnungen.
17Modernes Heizen mit Holz
10. e.u.z- Baufachtagung
18./19.10.2001 Hannover
Bild 3.2a Abluftanlage im Projekt Bilderstöckchen zur Verbesserung der Luftqualität,
Verminderung von Bauschadenrisiken und zur Energieeinsparung.
Bild 3.2 Anlagenschema des Projekts Bilderstöckchen.
Die Wärmebereitstellung für die Solarsiedlung erfolgt durch die Kombination eines
Gas-Brennwertkessels, eines Holzpelletkessels und einer thermischen
Solaranlage. Das Brauchwasser soll jeweils zu 50% von der thermischen
18Modernes Heizen mit Holz
10. e.u.z- Baufachtagung
18./19.10.2001 Hannover
Solaranlage und dem Holzpellet-Kessel erwärmt werden. Die überschüssige Wärme
wird zur Heizungsunterstützung genutzt. Der Wärmebedarf für die Heizung wird
überwiegend durch den Gas- Brennwert-Kessel sichergestellt.
Mit ca. 200 m² Kollektorfläche wird die Solaranlage etwa 50% des
Warmwasserbedarfs der Siedlung decken.
Die dachintegrierten Flachkollektoren werden 2-lagig auf der Westseite des
Mansarddaches angeordnet.
Hydraulisch wird die Anlage so eingebunden, dass die Kollektoren auf einen
Schichtenspeicher mit 8000 Liter Inhalt fahren (direkt eingebunden). Aus den
Schichtenspeichern wird ein Plattenwärmetauscher bedient, der im
Durchlauferhitzerprinzip das nachströmende Kaltwasser in den
Warm7wasserspeicher vorerwärmt (im Sommerfall auf 50°C). Somit werden keine
Maßnahmen der Legionellendekontamination auf der Solarseite notwendig.
Bild 3.3 Die Solaranlage auf dem Projekt Bilderstöckchen
Der Pelletkessel, mit einer Leistung von 32 kW, deckt den Restwärmebedarf zur
Warmwasserbereitung. Die überschüssige Wärme wird zur Heizungsunterstützung
genutzt.
Die Pellets (Holzpresslinge) werden in einem ca. 30 m³ großen Erdtank gelagert und
über eine Förderschnecke zum Pelletkessel gefördert.
19Modernes Heizen mit Holz
10. e.u.z- Baufachtagung
18./19.10.2001 Hannover
Bild 3.4 Der Pellet-Lagerraum mit
Schüttboden und Einblasstutzen
Bild 3.a Pelletkessel, Gas-Spitzenkkessel und 8 m³ Schichtenspeicher
20Modernes Heizen mit Holz
10. e.u.z- Baufachtagung
18./19.10.2001 Hannover
4 Fördersituation
Die Investitionen in Holzheizungen werden derzeit sowohl auf Bundes- als auch auf
Landesebene gefördert.
Die Förderung des Bundesamts für Wirtschaft sieht für automatisch beschickte
Holzheizungen eine Förderung von 120 DM/ kW vor, bis zu einer Maximalsumme von
4.000 DM.
Interessanter ist hier in NRW die Förderung über das Ministerium für Umwelt und
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Holzabsatzförderrichtlinie).
Automatisch beschickte Holzheizungen werden hier mit bis zu 40 % der
Investitionskosten gefördert. Anträge können bei der jeweils zuständigen unteren
Forstbehörde gestellt werden.
Auch im REN-Förderprogramm des Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur
und Sport sind Mittel für automatisch beschickte Holzheizungen vorgesehen. Bis zu
25 % der Kosten (Investitions- und Planungskosten) werden gefördert, wenn die
Heizung in Verbindung mit einer solarthermischen Anlage installiert wird und der
Wärmebedarf des Hauses 25 % unter Wärmeschutzverordnung 95 liegt. Anträge
müssen beim Landesinstitut für Bauwesen in Dortmund gestellt werden.
21Modernes Heizen mit Holz
10. e.u.z- Baufachtagung
18./19.10.2001 Hannover
Literatur
/Bergmair, Bergmair, J; Gesamtenergieaufwand bei der Herstellung von
1996/ Hackgut und Pellets, Regionalenergie Steiermark, Graz, 1996
/Forstabsatzfon Forstabsatzfond; Holzenergie für Kommunen; Bonn, 1998
d, 1998/
/Hessenenergie HessenEnergie; Energienutzung aus Holzhackschnitzeln, Fachtext
, 2000/ 11.3, Wiesbaden, 2000; www.hessenENERGIE.de
/Klima1,2001/ Bähr,R;Klima,M; Solarsiedlung Bonn Tannenbusch
Contractingverfahren zu Biomasse-Heizwerk und Solaranlagen ,
Vortrag auf dem AGÖF Fachkongreß, Nürnberg, 2001
/Klima2,2001/ Bähr,R;Klima,M; Machbarkeitsstudie zum Aufbau einer
Pelletproduktion, unveröffentlicht, Aachen, 2001.
/Marutzky,1999/ Marutzky, R.; Seeger, K.; Energie aus Holz und anderer Biomasse
,Leinfelden- Echterdingen, 1999
/MfUuF,1998/ Ministerium für Umwelt und Forsten (RhldPf); Leitlinie für eine
qualitätsgesicherte Aufbereitung und Verwertung von
Gebrauchtholz; Mainz, 1998
/Nau,2000/ Nau, Moosburg; Firmeninfo
/Passivhaus- Feist, Dr. Wolfgang, Passivhaus-Institut
institut, 2000/ Protokollband Nr. 20 „Passivhaus-Versorgungstechnik“
Artikel Varianten für die Wärmeversorgung von Passivhäusern im
Vergleich, Darmstadt, 2000
/ProSolar,2000/ Firmeninfo der Fa. ProSolar,
/Ökofen,2000/ Ökofen, Mittelneufach- Reichertshofen; Firmeninfo
22Sie können auch lesen