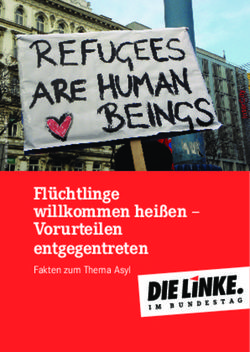Kommunales Abwasser Lagebericht 2017 - Baden ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Kommunales Abwasser
Lagebericht 2017
Impressum
Herausgeber
Ministerium für Umwelt, Klima
und Energiewirtschaft Baden-Württemberg
Kernerplatz 9
70182 Stuttgart
http://www.um.baden-wuerttemberg.de
Bearbeitung
Landesanstalt für Umwelt, Messungen
und Naturschutz Baden-Württemberg
Referat 41, Gewässerschutz
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de
Ministerium für Umwelt, Klima
und Energiewirtschaft Baden-Württemberg
Referat 53 „Gewässerreinhaltung, stehende
Gewässer, Bodensee“
Druck
e.kurz + co druck und medientechnik gmbh
Kernerstaße 5
70182 Stuttgart klimaneutral
natureOffice.com | DE-301-031351
Stand: Juni 2017 gedruckt
Auflage: 500 ExemplareDie europäische Kommunalabwasserrichtlinie sieht alle zwei
Jahre eine Information der Öffentlichkeit über den Stand der
Abwasserbehandlung vor. Der nunmehr elfte Lagebericht
macht erneut deutlich, dass die Abwasserbeseitigung in Ba-
den-Württemberg einen hohen Stand erreicht hat. Die Ge-
samtabbauleistung der 924 baden-württembergischen Klär-
anlagen betrug zum Ende des Jahres 2015 beim chemi-
schen Sauerstoffbedarf rund 96 % und beim Stickstoff rund
79 %. Nicht zuletzt durch die im Bewirtschaftungsplan nach
der Wasserrahmenrichtlinie enthaltenen erhöhten Anforde-
rungen an Kläranlageneinleitungen hat sich die Abbauleis-
tung beim Phosphor in Baden-Württemberg auf rund 93 %
erhöht. Die Phosphoreinträge reduzierten sich in den vergangenen Jahren im Land um etwa 300 Ton-
nen, davon etwa 250 Tonnen im Neckareinzugsgebiet. Der Ausbaugrad der Regenwasserbehandlung
in Baden-Württemberg beträgt etwa 96 %.
Der anzustrebende „gute ökologische Zustand“ der Gewässer ist trotzdem in vielen Wasserköpern noch
nicht erreicht. Insbesondere bei kleinen Gewässern mit wenig natürlichem Abfluss kann es zu Defiziten
kommen. Neben dem ordnungsgemäßen Betrieb und dem weiteren Ausbau der Kläranlagen sowie
dem Restausbau der Regenwasserbehandlung geht es darum, auch den Betrieb von Regenwasseran-
lagen zu optimieren. Ein wichtiger Beitrag hierzu ist der Einbau von Messeinrichtungen zum Entlas-
tungsverhalten und die Nutzung der gewonnenen Erkenntnisse, um die Systeme zu optimieren.
In der Zukunft werden Starkregenereignisse und deren Auswirkungen auf die Entwässerungssysteme
und die Gewässer eine große Rolle spielen. Ziel ist es, Handlungskonzepte zum kommunalen Starkre-
genmanagement zu entwickeln und die von befestigten Flächen resultierenden Spitzenabflüsse sicher
abzuleiten.
Im Rahmen der Spurenstoffkonzeption des Landes sollen an wasserwirtschaftlich ausgewählten Stand-
orten Kläranlagen mit einer Stufe zur Spurenstoffelimination ausgebaut werden. Derzeit sind in Baden-
Württemberg dreizehn derartige Anlagen in Betrieb (einschließlich einer Anlage in Bayern, die überwie-
gend baden-württembergisches Abwasser behandelt) und fünf weitere in der Bau- oder Planungs-
phase. Dies konnte mit finanzieller Unterstützung des Landes und nicht zuletzt dank des Engagements
aller Beteiligter erreicht werden.
Bei der konsequenten Erschließung von Energieeinspar- und Energiegewinnungspotentialen hat auch
der Abwassersektor einen Beitrag zu leisten. Es gilt, den Spagat zu schaffen: Einerseits benötigen wir
für einen wirksamen Gewässerschutz weiterhin Energie und andererseits müssen wir im Interesse des
Klimaschutzes Energie sparen. Deshalb geht es darum, Energie für einen guten Gewässerschutz effi-
zient zu nutzen.
Die gute Ausbildung und Fortbildung des Betriebspersonals unserer Abwasseranlagen, insbesondere
der Kläranlagen, sowie die gute und langjährige Zusammenarbeit zwischen Land und Kommunen spie-
geln sich auch im hohen Standard der Abwasseranlagen wider. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam
mit den Städten und Gemeinden im Lande auch zukünftig diesen Standard halten und die geforderten
Ziele erreichen können.
Franz Untersteller MdL
Minister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft des Landes Baden-WürttembergINHALTSVERZEICHNIS
1. EINLEITUNG ................................................................................................................1
2. ANSCHLUSSGRAD AN DIE ÖFFENTLICHE KANALISATION .................................. 3
3. KANALISATION UND REGENWASSERBEHANDLUNG............................................ 4
4. KLÄRANLAGEN...........................................................................................................7
4.1. REINIGUNGSLEISTUNG DER KLÄRANLAGEN ........................................................ 7
4.2. ABWASSERMAßNAHMEN ZUR ZIELERREICHUNG DER WRRL........................... 16
4.3. EINFLUSS VON ABWASSER AUF DIE GEWÄSSERQUALITÄT BEI
NIEDRIGWASSER...................................................................................................... 17
4.4. SPURENSTOFFE ....................................................................................................... 18
4.5. ENERGIEEFFIZIENZ / ENERGIEGEWINNUNG BEI KOMMUNALEN
KLÄRANLAGEN......................................................................................................... 19
5. INDUSTRIELLE EINLEITER ...................................................................................... 22
5.1. PRTR-SONDERUNTERSUCHUNGSPROGRAMM.................................................... 22
6. KLÄRSCHLAMM ........................................................................................................ 24
7. INVESTITIONEN UND STAATLICHE FÖRDERUNG ................................................ 27
8. AUSBLICK.................................................................................................................. 29Kommunales Abwasser 1 1. Einleitung In der Richtlinie der Europäischen Union (EU) über die Behandlung von kommunalem Abwasser vom 21. Mai 1991 (Kommunalabwasserrichtlinie - 91/271/EWG) ist in Artikel 16 festgelegt, dass die zuständigen Stellen oder Behörden der Mitgliedsstaaten alle zwei Jahre einen Lagebericht über die Beseitigung von kommunalen Abwässern und Klärschlamm in ihrem Zuständigkeitsbereich zu veröffentlichen haben. Mit dem nun vorgelegten elften Lagebericht kommt das Land Baden- Württemberg für seinen Bereich dieser Verpflichtung nach. In der Broschüre sind wesentliche Angaben zur Abwasserentsorgung, zur Reinigungsleistung der Kläranlagen und zur Klärschlammbeseitigung zusammengefasst zum Stand 31. Dezember 2015, sofern nicht anderes vermerkt ist. Die Anforderungen an kommunalen Kläranlagen ergeben sich in erster Linie aus der Kommunalabwas- serrichtlinie. Diese ist durch die Abwasserverordnung des Bundes (AbwV) vom 17. Juni 2004, zuletzt geändert am 2. September 2014, sowie der baden-württembergischen Reinhalteordnung kommunales Abwasser (ROkA) vom 10. Dezember 1993, zuletzt geändert am 3. Dezember 2013, umgesetzt. Die Abwasserverordnung enthält für alle Kläranlagen ab einer Ausbaugröße über 10.000 Einwohner- werten (EW) Grenzwerte für die Stickstoff- und Phosphorkonzentrationen im Ablauf einer Kläranlage. Damit geht sie beim Stickstoff über die Anforderungen der Kommunalabwasserrichtlinie hinaus, die diese Anforderungen nur für Einzugsgebiete empfindlicher Gebiete vorsieht. Diese Unterscheidung hat jedoch für Baden-Württemberg keine Bedeutung, da die gesamte Fläche Baden-Württembergs wie auch Deutschland als empfindliches Gebiet ausgewiesen ist. Die ROkA dient auch zur Definition von weitergehenden, über die Kommunalabwasserrichtlinie hinausgehenden Anforderungen, insbesondere für das Einzugsgebiet des Bodensees und der Oberen Donau. Die Erstellung der von der EU geforderten Zustandsberichte macht eine Vielzahl von Untersuchungen über die Reinigungsleistung der Kläranlagen notwendig. Neben der staatlichen Kontrolle durch die Wasserbehörden stellt die Eigenkontrolle (Selbstüberwachung) des Anlagenbetreibers die zweite Säule der Überwachung im Abwasserbereich dar.
2 Kommunales Abwasser Darüber hinaus sind die Anforderungen durch die EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL - 2000/60/EG), die im Wasserhaushaltsgesetz in nationales Recht umgesetzt wurde, zu beachten. Das Ziel der WRRL ist es, den guten ökologischen und den guten chemischen Zustand bzw. das gute Potenzial der Ge- wässer zu erreichen. Aus diesen Anforderungen heraus können zusätzliche Anforderungen an die Emissionen von Abwasseranlagen, insbesondere Kläranlagen, dann erwachsen, wenn ein Wasserkör- per den guten Zustand verfehlt. Deshalb stellen die Abwassermaßnahmen auch im zweiten Bewirt- schaftungszyklus der WRRL einen wesentlichen Bestandteil des Maßnahmenprogramms dar.
Kommunales Abwasser 3
2. Anschlussgrad an die öffentliche Kanalisation
Die dezentrale Abwasserbeseitigung betrifft überwiegend Einwohner kleiner Weiler, Gehöfte oder von
Einzelanwesen im ländlichen Raum. Die dort anfallenden Abwässer werden über private Kleinkläran-
lagen mit naturnahen Verfahren (z. B. Pflanzenkläranlagen) oder technischen Verfahren (z. B. Bele-
bungsanlagen) gereinigt oder in geschlossenen, d. h. abflusslosen, Gruben gesammelt und über eine
zentrale Kläranlage ordnungsgemäß entsorgt. Im Einzelfall wird unter Berücksichtigung der Siedlungs-
struktur, der topographischen Verhältnisse und der bautechnischen Möglichkeiten geprüft, ob hier ein
Anschluss an eine zentrale kommunale Kläranlage beispielsweise über eine kostengünstige Druckent-
wässerungsleitung („Pumpe und Schlauch“) zweckmäßig ist.
Am Jahresende 2015 waren nur noch etwa 66.000 Einwohner nicht an eine kommunale mechanisch-
biologische Kläranlage angeschlossen. Das entspricht einem Anschlussgrad an die Kanalisation von
über 99 % (Abb.1), der dem jahrelangen zielgerichteten und zügigen Ausbau der Abwasseranlagen
und der öffentlichen Kanalisation zu verdanken ist. Es zeichnet sich ab, dass Abwässer von etwa wei-
teren 15.000 Einwohnern in den nächsten Jahren über zentrale Kläranlagen entsorgt werden können.
Nach derzeitiger Einschätzung wird bei etwa 51.000 Einwohnern von Baden-Württemberg das anfal-
lende Abwasser dauerhaft dezentral entsorgt werden. Davon haben derzeit etwa 35.000 Einwohner
eine ordnungsgemäße dezentrale Abwasserbeseitigung und etwa 5.000 Anlagen – entsprechen etwa
16.000 Einwohner (etwa 0,15 Prozent der Einwohner) – müssen ertüchtigt oder neu gebaut werden.
100 1.000
900
90 800
Einwohner in TSD
Anschlussgrad an Kanalisation 700
Anschlussgrad an Kläranlagen
80 600
Anschlussgrad [%]
nicht angeschlossene Einwohner
noch nicht ordnungsgemäß entsorgte Einwohner 500
70 400
300
60 200
100
50 0
1963 1975 1983 1991 1998 2004 2008 2012 2014
Abbildung 1: Anschlussgrad an die Kanalisation und an kommunale Kläranlagen in Baden-Württem-
berg [Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, ergänzt LUBW Stand: 31.12.2015]4 Kommunales Abwasser
3. Kanalisation und Regenwasserbehandlung
Circa 74.000 km beträgt nach den aktuellen Daten des Statistischen Landesamtes die Gesamtlänge
der öffentlichen Kanalisation in Baden-Württemberg. Bei etwa 50.000 km handelt es sich um Misch-
wasserkanäle, bei denen Schmutzwasser aus Haushalten und Gewerbe gemeinsam mit dem Nieder-
schlagswasser von den befestigten Flächen im Einzugsgebiet in einer Leitung abgeleitet wird. Daneben
kommt mit regionalen Schwerpunkten das Trennsystem zum Einsatz. Hier werden Schmutzwasser und
Niederschlagswasser in getrennten Leitungen abgeführt.
Misch- Schmutz- Regen-
kanalisation wasserkanäle wasserkanäle
80.000
70.000
60.000
Kanallänge in km
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
1975 1979 1983 1987 1991 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013
Abbildung 2: Öffentliche Kanalisation in Baden-Württemberg [Statistisches Landesamt Baden-Würt-
temberg, Stand: 31.12.2013]
Während in früheren Jahren eine möglichst schnelle Ableitung des Niederschlags im Fokus stand, ver-
folgt das Land Baden-Württemberg mit Einführung der Verordnung des Ministeriums für Umwelt und
Verkehr über die dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser („Niederschlagswasserverordnung“
vom 22.03.1999) eine veränderte Strategie. Mit den Elementen der modifizierten Entwässerungsver-
fahren (wie z. B. Minimierung der Versiegelung, dezentrale Versickerung, Gründächer, Regenwas-
sernutzung und getrennte Ableitung von nicht behandlungsbedürftigem Niederschlagswasser) wird der
Eintrag des Niederschlagswassers in die Kanalisation gemindert und ein Beitrag zum Erhalt des natür-
lichen Wasserkreislaufs geleistet. Diese Entwässerungsstrategien werden vornehmlich bei der Planung
und Erschließung von Neubaugebieten umgesetzt. Die Akzeptanz der neuen Strategie zeigt sich in
einem ab dem Jahr 1999 gegenüber der Mischwasserkanalisation steigenden Anteil der Schmutz- und
Regenwasserkanalisation auf mittlerweile circa ein Drittel bezogen auf die Gesamtlänge der öffentli-
chen Kanalisation (Abb. 2). Aber auch bei bestehenden Siedlungs- und Gewerbegebieten kann durchKommunales Abwasser 5
Abkopplungsmaßnahmen befestigter Flächen von der Kanalisation eine Verbesserung erreicht werden.
Durch die Einführung der gesplitteten Abwasserabgabe wurden in den vergangenen Jahren verstärkt
solche Maßnahmen umgesetzt.
Durch dezentrale Versickerung, aber auch durch Verdunstung, sollen die Auswirkungen der Bebauung
auf den Abfluss der Niederschläge, insbesondere die hydraulische Überlastung von kleinen Gewässern
und die Häufigkeit von Entlastungen aus Regenwasseranlagen ins Gewässer verringert werden. Ziel
ist es, die von befestigten Flächen resultierenden Spitzenabflüsse auf ein für das jeweilige Gewässer
vertretbares Maß zu begrenzen und gleichzeitig den Belangen des Grundwasserschutzes angemessen
Rechnung zu tragen. Das Auftreten von Hochwasserereignissen in größeren Gewässern kann aller-
dings durch diese nur lokal wirksamen Maßnahmen in den Siedlungsgebieten nicht in relevantem Um-
fang beeinflusst werden.
100
95
96
95 95
94
90 93
91
Ausbaugrad [%]
89
85 88
84
80
80
75 78
75
70
69
65
60
55
50
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Abbildung 3: Ausbau der Regenwasserbehandlung in Baden-Württemberg (Stand: 31.12.2016)
Für einen wirksamen Gewässerschutz sind weiterhin Anlagen zur Regenwasserbehandlung erforder-
lich. Im Regelfall sind dies Regenüberlaufbecken bei Mischkanalisation und Regenklärbecken bei
Trennkanalisation. Auch hier können infolge gewässergezogener Anforderungen weitergehende Rei-
nigungsstufen wie beispielsweise Retentionsbodenfilter erforderlich sein. Der Ausbau der Regenwas-
serbehandlung stellt nach wie vor eine wichtige Teilkomponente eines ganzheitlichen Gewässerschut-
zes dar.6 Kommunales Abwasser
Mit dem Bau von Regenüberlaufbecken und Regenklärbecken wurde bereits in den 1970-er Jahren
begonnen. Der Ausbaugrad ist in den 1990-er Jahren besonders stark angestiegen. Ende des Jahres
2016 betrug das Gesamtbeckenvolumen etwa 3,7 Mio. m³ und hat sich gegenüber 2014 geringfügig
erhöht. Es standen in der Mischkanalisation etwa 7.000 Regenüberlaufbecken und in der Trennkanali-
sation etwa 600 Regenklärbecken zur Verfügung.
Mit dem Ausbaugrad der Regenwasserbehandlung von derzeit etwa 96 % ist bereits ein hoher Stand
bei der Regenwasserbehandlung erreicht. Neben dem Restausbau werden weitere Verbesserungen in
der optimierten Betriebsweise dieser Regenwasserbehandlungsanlagen und damit einem verbesserten
Gewässerschutz gesehen. Die Erfassung des Entlastungsverhaltens (Entlastungshäufigkeit und -
dauer, Einstauhäufigkeit und -dauer) ist deshalb ein wichtiger Schritt in dieser Entwicklung. Derzeit sind
an etwa 3.400 Regenüberlaufbecken Messeinrichtungen zur Erfassung des Entlastungsverhaltens vor-
handen. Das Land Baden-Württemberg ist bestrebt, in den kommenden Jahren sukzessive alle Regen-
überlaufbecken mit Messeinrichtungen zur Erfassung des Entlastungsverhaltens auszurüsten.
4000
Anzahl RÜB Anzahl Messeinrichtungen
3500 3357
3000
2500
Anzahl
2000
1552
1500 1424
1236
1000
724
385 392 437
500 288
251
34 0
0
≤ 100 > 100 ≤ 500 > 500 ≤ 1.000 > 1.000 ≤ 1.500 > 1.500 Keine Angaben
Vorhandenes Volumen pro Becken [m³]
Abbildung 4: Anzahl der Regenüberlaufbecken und der vorhandenen Messeinrichtungen
(Stand: 31.12.2016)Kommunales Abwasser 7 4. Kläranlagen 4.1. Reinigungsleistung der Kläranlagen Rund 4 % der Kläranlagen Baden-Württembergs mit einem Ausbaugrad > 100.000 Einwohnerwerte (EW) reinigt mehr als ein Drittel des anfallenden Abwassers. Circa 50 % des Abwassers wird in 303 Anlagen mit einem Ausbaugrad > 10.000 EW und ≤ 100.000 EW geklärt. D.h., das ca. 87 % des im Land anfallenden Abwasser in rund einem Drittel der Kläranlagen gereinigt wird. Die restlichen 13 % des Abwassers werden in 585 kleineren Anlagen mit einem Ausbraugrad ≤ 10.000 EW gereinigt (siehe Abb.5). Das Umweltministerium ist seit Jahren bemüht, beispielsweise durch För- dermaßnahmen zum Zusammenschluss mehrerer kleinere Anlagen, die Anzahl der Kläranlagen weiter zu reduzieren. Zum Stand am 31.Dezember 2015 wurden im Land 924 kommunale Kläranlagen betrie- ben. Das waren 20 Anlagen weniger gegenüber dem Jahr 2014. Dies entspricht einer Gesamtausbau- größe von ca. 20,8 Mio. EW und damit kann das Abwasser der ca. 10,7 Mio. angeschlossenen Ein- wohnern (E) gereinigt werden; ca. 10,1 Mio. Einwohnergleichwerte (EGW) stehen zur Behandlung von Gewerbe- und Industrieabwasser bzw. als Reserve zur Verfügung. In Abbildung 6 sind die großen oberirdischen Fließgewässer Rhein, Donau und Neckar mit ihren wich- tigsten Nebenflüssen und Kläranlagen mit Anschlusswerten größer 10.000 EW dargestellt. 38 Kläran- lagen über 100.000 EW entsorgen im Regelfall das in den Ballungsräumen des Landes anfallende Abwasser. Von diesen 38 Kläranlagen liegen zwei außerhalb der Landesgrenze. Es handelt sich um die Kläranlage Neu-Ulm, die in Bayern liegt, sowie um die Kläranlage Bibertal-Ramsen, die in der Schweiz liegt. Diese beiden Kläranlagen sind in den Abbildungen 6 und 7 mitberücksichtigt.
8 Kommunales Abwasser
Anlagenanzahl Jahresabwassermenge
36
35%
303
297
52%
288
11%
2%
Ausbau-EW
≤ 2.000 > 2.000 - 10.000 >10.000 - 100.000 > 100.000
Abbildung 5: Reinigungskapazität der Kläranlagen in Baden-Württemberg in Abhängigkeit der
Größenklasse (Ausbau-EW) (Stand: 31.12.2015)Kommunales Abwasser 9
Abbildung 6: Übersicht der kommunalen Kläranlagen in Baden-Württemberg > 10.000 EW sowie die
Kläranlage Neu-Ulm und Kläranlage Bibertal-Ramsen (Stand 31.12.2015)10 Kommunales Abwasser
Abbildung 7: Siedlungsdichte (Einwohner/km²) und Kläranlagen > 100.000 EW in Baden-Württemberg
sowie die Kläranlage Neu-Ulm und Kläranlage Bibertal-Ramsen (Stand 31.12.2012)
Einige der 36 baden-württembergischen Anlagen über 100.000 EW liegen jedoch als übergreifende
Verbandslösungen in dünner besiedelten Gebieten (siehe hierzu auch Abb. 7).Kommunales Abwasser 11
In Tabelle 1 ist dargestellt, welche Klärverfahren bei den jeweiligen Größenklassen zur Anwendung
kommen.
Tabelle 1: Zahl der kommunalen Kläranlagen nach Ausbaugröße und Hauptklärverfahren (Stand:
31.12.2015) bzw. Filtrations- oder Aktivkohle-Adsorptionsanlagen (Stand 04/2017)
Ausbaugröße ≤ 1.000 > 1.000 > 2.000 > 5.000 > 10.000 > 100.000 Alle
(EW) – – – – Größen-
2.000 5.000 10.000 100.000 klassen
Art des Haupt-
klärverfahrens
Anzahl
Belebungsanlagen 15 9 29 40 223 33 349
Belebungsanlagen mit
120 63 109 96 54 -- 442
Schlammstabilisation
Tropfkörperanlagen 2 5 6 4 9 2 28
Tauchkörperanlagen 25 2 -- -- -- -- 27
Mehrstufige Kläranlagen 4 -- 4 6 17 1 32
Abwasserteiche 40 3 3 -- -- -- 46
Gesamtanzahl 206 82 151 146 303 36 924
Davon Kläranlagen mit weitere Reinigungsstufen
Filtrationsanlagen 2 3 8 6 17 6 42
Aktivkohle-Adsorption-
-- -- -- 1 6 5 12
Anlagen
Als weitere Reinigungsstufe sind bei 42 Kläranlagen Filtrationsanlagen teilweise mit Aktivkohle-Adsorp-
tionen aufgrund weitergehender, gewässerbezogener Anforderungen (z. B. Spurenstoffkonzeption)
oder mitbehandelten industriellen Abwässern (z. B. Textilindustrie) nachgeschaltet.
Die zeitliche Entwicklung der Anzahl der Kläranlagen und die der Klärverfahren zeigt Abbildung 8. Darin
wird auch aufgezeigt, dass die Anzahl von Kläranlagen, auch kleineren Kläranlagen, die über entspre-
chende Reinigungsstufen zur Nährstoffelimination verfügen, in den letzten Jahren stetig gestiegen ist.
Gleichzeitig hat sich die Gesamtzahl der Kläranlagen verringert. Das Land Baden-Württemberg hat
gezielt die Zusammenschlüsse von Kläranlagen bzw. die Aufgabe von kleineren Kläranlagen und An-
schluss an größere Kläranlagen vorangetrieben. Hintergrund sind wirtschaftliche Aspekte (i. d. R. kos-
tengünstigerer Betrieb der Kläranlagen) sowie betriebliche Gründe (gestiegene Anforderungen an das
Kläranlagenpersonal, oftmals stabilerer Betrieb der größeren Kläranlagen). Daneben spielt aber auch
der Gewässerschutz eine wesentliche Rolle, da die größeren Kläranlagen oftmals an einem leistungs-
fähigeren Gewässer liegen. Wenn dies nicht der Fall ist, können auf einer größeren Kläranlage die
erhöhten Anforderungen an die Reinigungsleistung finanziell und betrieblich besser umgesetzt werden.
Die Abbildung 9 zeigt auf, welcher Anteil der Schmutzfracht, angegeben als Ausbaugröße (EW), mit
den einzelnen Verfahrensstufen behandelt wird.12 Kommunales Abwasser
Stand: 31.12.2015
Kläranlagen insgesamt: 924 (938)
Nitrifikation: 849 (862)
Nitrifikation und Denitrifikation: 747 (754)
Phosphorelimination: 622 (620)
Stand: 04.2017
Filtration: 42 (41) 1400
Spurenstoffentfernung: 12 (9)
Anzahl der Kläranlagen (Klammer: Vorjahreswert)
1200
1000
Anzahl der KA
800
600
400
200
0
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Abbildung 8: Entwicklung der Nährstoffelimination und der weitergehenden Verfahren in Baden-Würt-
temberg nach Anzahl Kläranlagen [DWA Leistungsvergleich 2015, modifiziert]
20,8 20,4 20,0 19,8
20,0
Ausbaugröße [Mio. EW]
15,0
10,0
5,0
3,3
1,6
0,0
Alle Anlagen Nitrifikation Nitrifikation und Phosphorelimination Filtration Spurenstoffentfernung
Denitrifikation
Abbildung 9: Ausbaugrößen bezogen auf die einzelnen Verfahrensstufen (Stand 31.12.2015)Kommunales Abwasser 13
In den nachfolgenden Tabellen und Abbildungen werden folgende Abkürzungen verwendet:
CSB Chemischer Sauerstoffbedarf als Maß für die organische Gesamtverschmutzung
Nges Gesamtstickstoff als Summe aus organischem und anorganischem Stickstoff
Pges Phosphor gesamt
Die Kommunalabwasserrichtlinie, umgesetzt in Deutschland durch die Abwasserverordnung, stellt Min-
destanforderungen an die Ablaufkonzentrationen für CSB, Stickstoff und Phosphor aus Kläranlagen;
für Stickstoff und Phosphor gilt dies ab einer Ausbaugröße von mehr als 10.000 EW. Alternativ lässt
die Kommunalabwasserrichtlinie bei Stickstoff und Phosphor zu, dass anstelle der Reinigungsleistung
der einzelnen Kläranlagen (ab 2.000 EW) ein gebietsbezogener Frachtabbau von mindestens 75 %
nachgewiesen wird.
Die ROkA und im Einzelfall auch Wasserrechtsbescheide einzelner Anlagen enthalten jedoch, teilweise
auch für Anlagengrößen kleiner gleich 10.000 EW, weitergehende lokale oder regionale Anforderun-
gen, vorrangig an die Nährstoff-Reduktion (Parameter Stickstoff und Phosphor).
Die Einhaltung der anlagenbezogenen Anforderungen ist für die baden-württembergischen Kläranlagen
in Abhängigkeit von der Ausbaugröße in Tabelle 2 dargestellt.
Tabelle 2: Einhaltung der Mindestanforderungen der Abwasserverordnung bzw. von weitergehenden
lokalen/regionalen Anforderungen (Stand: 31.12.2015)
Größen- Anzahl der Behandelte Anzahl der Kläranlagen,
klasse Kläranla- Schmutz- die die Mindestanforderun- die ergänzende lokale/regio-
gen fracht gen nicht einhalten nale Anforderungen nicht
einhalten
(Mehrfachnennung möglich)
EW - EW CSB Nges Pges CSB Nges Pges
≤ 2.000 288 212.016 -- -- -- 1 2 5
>2.000 -
1.385.424 -- -- -- 0 1 5
10.000 299
>10.000 -
7.431.045 -- -- -- 1 1 5
100.000 303
> 100.000 36 6.380.907 -- 1 -- -- -- --
Bezüglich der Parameter CSB und Phosphor halten alle Anlagen die Mindestanforderungen ein. Im
Berichtsjahr 2015 hält eine Kläranlage die Mindestanforderungen bei der Stickstoffelimination nicht ein.
Diese Anlage hat langanhaltende verfahrenstechnische Betriebsstörungen. Maßnahmen zur Behebung
der Betriebsstörungen sind eingeleitet.
Entsprechende Maßnahmen zur Behebung der lokalen/regionalen Anforderungen (Anzahl und Para-
meter siehe Tabelle 2) sind ebenfalls geplant. Es ist aber auch darauf hinzuweisen, dass infolge der14 Kommunales Abwasser
Maßnahmen zur Zielerreichung des guten ökologischen Zustands nach WRRL (vgl. Abschnitt 4.2) bei
einer großen Anzahl an kommunalen Kläranlagen weitergehende Anforderungen definiert wurden und
geplant sind.
In der nachfolgenden Abbildung ist die Entwicklung über die Einhaltung der Mindestanforderungen
nach Kommunalabwasserrichtlinie seit 2010 zusammengestellt.
Anforderungen nicht eingehalten
350 Anforderungen eingehalten
2 1
4
338 339 338 339
338
332 332 336 332 332
325 332 328
Anlagenanzahl
300
275
250
2010 2012 2014 2015 2010 2012 2014 2015 2010 2012 2014 2015
CSB Nges Pges
Abbildung 10: Einhaltung der Mindestanforderungen von Kläranlagen mit einer Ausbaugröße über
10.000 EW in den Jahren 2010, 2012, 2014 und 2015 (Stand 31.12.2015)
In Tabelle 3 und Abbildung 11 ist der Frachtabbau für alle baden-württembergischen kommunalen Klär-
anlagen für CSB, Nges und Pges dargestellt. Die gesamte, den Kläranlagen zugeleitete Stickstofffracht
wird durchschnittlich um ca. 79 %, die Phosphorfracht um ca. 92 % reduziert. Damit wird der nach der
Kommunalabwasserrichtlinie geforderte gebietsbezogene Frachtabbau von mindestens 75 % für Stick-
stoff und Phosphor eingehalten.Kommunales Abwasser 15
Tabelle 3: Frachtabbau der Kläranlagen in Baden-Württemberg Grundlage: Messungen von Zu- und
Ablaufkonzentrationen (Stand 31.12.2015)
Größen-
CSB Nges Pges
klasse
EW Zulauf Ablauf Abbau Zulauf Ablauf Abbau Zulauf Ablauf Abbau
[kg/d] [kg/d] [%] [kg/d] [kg/d] [%] [kg/d] [kg/d] [%]
≤ 2.000 25.442 1.406 94 3.060 797 74 432 139 68
> 2.000
163.514 7.288 96 17.301 3.265 81 2.624 459 83
- 10.000
> 10.000
894.463 40.084 96 83.459 19.008 77 13.259 975 93
- 100.000
> 100.000 765.709 30.788 96 67.702 13.271 80 10.516 523 95
alle Anlagen 1.849.127 79.566 96 171.522 36.341 79 26.831 2.096 92
Anlagen
1.823.685 78.160 96 168.462 35.545 79 26.400 1.957 93
EW > 2.000
Insbesondere beim Phosphorabbau ist eine deutlich höhere Leistungsfähigkeit größerer Anlagen fest-
zustellen
100
CSB Nges Pges
95,5 95,5 96,0 95,0
94,5
90 92,7
Abbauleistung [%]
80 82,5
81,1 80,4
77,2
73,9
70
67,8
60
50
≤2.000 >2.000-10.000 >10.000-100.000 >100.000
Anlagengröße [Ausbau-EW]
Abbildung 11: Abbau der Nährstoff-Frachten unterschiedlich großer Kläranlagen (Stand 31.12.2015)
Der Gewässerzustand wird bei Stickstoff und Phosphor mehr durch die eingeleiteten Frachten als durch
die Ablaufkonzentrationen der Kläranlagen beeinflusst. Die eingeleiteten Frachten aus Kläranlagen
werden durch die Abbauleistung der Kläranlagen bestimmt. Die Abbauleistungen sind trotz Einhaltung
der Ablaufkonzentrationen bei einem Teil der Kläranlagen vergleichsweise gering. Einer der Gründe
hierfür kann ein hoher Anteil an Fremdwasser sein. So zeigt eine Abschätzung, dass mehr als ein Drittel16 Kommunales Abwasser
der Kläranlagen in Baden-Württemberg einen Fremdwasseranteil von über 50 % hat. Der Reduzierung
des Fremdwassers kommt deshalb eine hohe Bedeutung zu.
4.2. Abwassermaßnahmen zur Zielerreichung der WRRL
Landesweit wurden im ersten Bewirtschaftungszyklus (2009-2015) insgesamt etwa 640 Maßnahmen
mit Schwerpunkt Abwasser umgesetzt. Neben konzeptionellen Maßnahmen wurden rund 270 Maßnah-
men an kommunalen Kläranlagen sowie rund 340 Maßnahmen an Regenwasserbehandlungsanlagen
durchgeführt. Auch im zweiten Bewirtschaftungszyklus (2016-2021) sind insgesamt etwa 590 Maßnah-
men im Abwasserbereich geplant. Etwa ein Drittel dieser Maßnahmen sind an kommunalen Kläranla-
gen und zwei Drittel an Regenwasserbehandlungsanlagen geplant. Wie in der nachfolgenden Abbil-
dung zu erkennen ist, führten die bislang umgesetzten Maßnahmen insbesondere im Neckareinzugs-
gebiet zu einer Reduktion der jährlichen Phosphoremissionen aus kommunalen Kläranlagen um etwa
250 Tonnen Pges/a gegenüber 2009 (siehe Abb. 12). Durch verfahrenstechnische Optimierungen hat
sich in den Bearbeitungsgebieten Neckar, Oberrhein und Donau auch die Abbauleistung beim Para-
meter CSB geringfügig verbessert, während sich die Nges–Fracht nur im Bearbeitungsgebiet Neckar
nennenswert reduziert hat.
Alpenrhein/Bodensee Donau Hochrhein Main Neckar Oberrhein
700.000
600.000
500.000
Pges-Fracht [kg/a]
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Abbildung 12: Entwicklung der eingeleiteten Pges-Fracht kommunaler Kläranlagen in den Bearbeitungs-
gebieten nach WRRL (Stand 31.12.2015)
Die aktuellen Bewertungen – insbesondere bei der Qualitätskomponente Makrophyten und Phyto-
benthos (MuP) – zeigen dennoch in weiten Landesteilen Defizite auf und weisen darauf hin, dass wei-
tere Anstrengungen bei der Nährstoffreduktion notwendig sind, um die gewässerbezogenen Ziele zu
erreichen. Einen Schwerpunkt bilden deshalb auch im zweiten Bewirtschaftungszyklus – neben demKommunales Abwasser 17
Ausbau und der Optimierung der Regenwasserbehandlung – die Maßnahmen zur Phosphorreduktion
an kommunalen Kläranlagen.
Die Maßnahmenplanung sieht eine abgestufte Vorgehensweise vor. In der 1. Stufe werden die Zielvor-
gaben aus dem Neckareinzugsgebiet landesweit auf alle defizitären Wasserkörper bei der Qualitäts-
komponente MuP, bei denen als Ursache die Einleitung aus einer oder mehrerer Kläranlagen identifi-
ziert wurde, ausgedehnt. Hierbei sind nachfolgende Ablaufkonzentrationen mindestens einzuhalten:
x Kläranlagen der Größenklasse 3: 0,8 mg/l Pges im Jahresmittel
x Kläranlagen der Größenklasse 4 und 5: 0,5 mg/l Pges im Jahresmittel
x Filtrationsanlagen bei Kläranlagen der GK 3 – 5: 0,3 mg/l Pges im Jahresmittel
Anlagen, die infolge regionaler oder lokaler Vorgaben bereits jetzt eine geringere Ablaufkonzentration
einhalten, dürfen sich nicht verschlechtern.
Parallel hierzu wird durch die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW) eine
Studie erstellt, die zur Identifizierung und Festlegung von weitergehenden Maßnahmen dienen soll. Die
Umsetzung dieser Maßnahmen bildet die zweite Stufe der geplanten Vorgehensweise.
4.3. Einfluss von Abwasser auf die Gewässerqualität bei Niedrigwasser
Grundsätzlich führt eine Niedrigwasserphase mit geringen Abflüssen zu einer „Aufkonzentrierung“ von
Abwasserinhaltsstoffen in den Gewässern, wie beispielsweise Salze und Spurenstoffe, die in den Rei-
nigungsstufen der Kläranlagen aus dem Abwasser nicht bzw. schlecht entfernt werden können. Gleich-
zeitig führen lokale Starkniederschlagsereignisse („Sommergewitter“) in dieser Zeit dazu, dass es zu
einem (erhöhten) Eintrag von Nähr- und Schadstoffen über Mischwasserentlastungen aus der Sied-
lungsentwässerung und diffusen Einträgen über Abschwemmungen kommen kann.
Vergleicht man die Jahre mit ausgeprägten Niedrigwasserphasen 2003 und 2015 miteinander, so kann
man feststellen, dass die Belastung der Fließgewässer durch höhere Anteile von Kläranlagenabflüssen
und damit eine Aufkonzentrierung von einigen Abwasserinhaltsstoffen in 2015 weniger ausgeprägt war
als im Jahr 2003. Beispielhaft sind in Abbildung 13 die Belastung (90-Perzentile) der Nebengewässer
im Neckareinzugsgebiet mit ortho-Phosphat-Phosphor im Vergleich der beiden Jahre dargestellt.18 Kommunales Abwasser
Belastung
1 sehr hoch
0,9
0,8 hoch
o-Phosphat_P [mg/l]
0,7 2003
0,6 2015
0,5
0,4 erhöht
0,3
0,2 deutlich
0,1 mäßig
gering bis
0
unbelastet
Abbildung 13: Belastung (90-Perzentile) der Nebengewässer im Neckareinzugsgebiet mit ortho-Phos-
phat-Phosphor in den Jahren 2003 und 2015
Besonders die „Körsch“ ist durch hohe Abwasseranteile geprägt. Im Jahr 2003 war die Belastung durch
Phosphor noch als hoch einzustufen, in 2015 ist sie erhöht. In vielen Nebengewässern des Neckars
wurde eine deutliche Belastung durch Phosphor in 2015 festgestellt, jedoch weniger erhöhte Belastun-
gen als im Vergleichsjahr 2003. Diese positive Entwicklung zeigt, dass sich die Maßnahmen zur Phos-
phorreduktion an kommunalen Kläranlagen im Neckareinzugsgebiet bereits bemerkbar machen.
4.4. Spurenstoffe
Baden-Württemberg hat unter dem Gesichtspunkt der Vorsorge bereits vor einigen Jahren damit be-
gonnen, Kläranlagen an besonders empfindlichen Gewässern oder an Belastungsschwerpunkten mit
einer weitergehenden Reinigungsstufe zur Spurenstoffelimination auszurüsten. Das Konzept verfolgt
einen konsensorientierten Ansatz mit den Betreibern unter Einsatz von Fördermitteln.
Insgesamt sind in Baden-Württemberg bereits 13 Kläranlagen (einschließlich einer Anlage in Bayern,
die überwiegend baden-württembergisches Abwasser behandelt) mit einer Aktivkohleadsorptionsstufe
zur gezielten Spurenstoffentfernung in Betrieb. Weitere fünf Anlagen sind derzeit in Bau oder Planung.
Nach deren Inbetriebnahme werden ca. 20 % der gesamten Abwassermenge in Baden-Württemberg
in einer Reinigungsstufe zur Spurenstoffelimination behandelt (siehe Abb. 14).Kommunales Abwasser 19
Abbildung 14: Übersicht der Kläranlagen in Baden-Württemberg mit der 4. Reinigungsstufe
[Kompetenzzentrum Spurenstoffe BW, Stand 04/2017]
Zur Unterstützung und Beratung von Kläranlagenbetreibern, Behörden und Planern bei der Einführung
der neuen Technologien wurde in Baden-Württemberg im Jahr 2012 das Kompetenzzentrum Spuren-
stoffe Baden-Württemberg (KomS) gegründet.
Baden-Württemberg unterstützt nicht nur den Ausbau von Kläranlagen zur Spurenstoffelimination („end
of pipe - Ansatz“), sondern auch das Vorhaben der EU-Kommission, eine europäische Arzneimittelstra-
tegie zu entwickeln (quellenbezogener Ansatz). Eine solche europäische Strategie entspricht dem Vor-
sorgegedanken in der Umweltpolitik. Baden-Württemberg ist diesbezüglich u.a. mit entsprechender
Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Workshops und Kongresse) aktiv.
4.5. Energieeffizienz / Energiegewinnung bei kommunalen Kläranlagen
Kläranlagen sind große Stromverbraucher in den Gemeinden mit einem durchschnittlichen Anteil von
20 % am kommunalen Strombedarf. Bei größeren Kläranlagen (> 10.000 EW) sind zumeist schon Maß-
nahmen, zur Wärme- und Stromerzeugung auf der Kläranlage (siehe auch Abb. 15 und 16), z. B. mit
Blockheizkraftwerken, umgesetzt. Die Darstellung zeigt deutlich die Vorteile größerer Anlagen.20 Kommunales Abwasser
Damit auch die kleineren und mittleren Kläranlagen die Einsparpotentiale und Energiegewinnungspo-
tentiale nutzen, fördert das Land Studien zur Energieeinsparung und Energiegewinnung auf Kläranla-
gen. Mit diesen Studien sollen die Kläranlagenbetreiber unterstützt werden, Maßnahmen zu identifizie-
ren und diese dann auch umzusetzen. Es handelt sich dabei sowohl um kleinere Maßnahmen, wie zum
Beispiel die Wiederbeschaffung von energieeffizienten Aggregaten als auch größere Maßnahmen, wie
zum Beispiel Verfahrensumstellungen. Baden-Württemberg legt dabei Wert darauf, dass durch Ener-
gieeinsparungen und Nutzung von Energiepotenzialen die Reinigungsleistung der Abwasseranlagen
keinesfalls gemindert wird und bei diesen ökonomischen und energetischen Betrachtungen der Ge-
wässerschutz Vorrang hat.
In Baden-Württemberg wird das Thema Energiesparen und Energiegewinnung auf Kläranlagen schon
seit vielen Jahren verfolgt. Dieser Aspekt wurde nunmehr auch in die letzte Novellierung der Abwas-
serverordnung, Anhang 1, aufgenommen: „Abwasseranlagen sollen so errichtet, betrieben und benutzt
werden, dass eine energieeffiziente Betriebsweise ermöglicht wird. Die bei der Abwasserbeseitigung
entstehenden Energiepotenziale sind, soweit technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar, zu nut-
zen.“
450
400
Spezifischer Stromverbrauch [kWh/E*a]
350
300
250
200
150
100
50
0
≤2.000 >2.000-10.000 >10.000-100.000 >100.000
Ausbaugröße [EW]
Abbildung 15: Spezifischer Stromverbrauch der Kläranlagen nach Ausbaugröße (Stand 31.12.2015)Kommunales Abwasser 21
Gesamtstromverbrauch Stromerzeugung
250.000
Gesamtstromverbrauch [MWh/a]
200.000
150.000
100.000
50.000
0
≤2.000 >2.000-10.000 >10.000-100.000 >100.000
Ausbaugröße [EW]
Abbildung 16: Gesamtstromverbrauch und Eigenstromerzeugung der Kläranlagen nach Ausbaugröße
(Stand 31.12.2015)22 Kommunales Abwasser 5. Industrielle Einleiter In Baden-Württemberg leiten drei Betriebe aus den in Anlage III „Industriebranchen“ der Kommunalabwassserrichtlinie genannten Branchen mit biologischer Abwasserbehandlung über 4.000 EW Abwasser direkt in ein Gewässer ein. Es handelt sich hierbei um Betriebe aus der Nahrungs- und Genussmittelerzeugung (Brauerei, Milchverarbeitung, Obst- und Gemüseverarbeitung). Die Betriebe haben für die Direkteinleitung eine wasserrechtliche Erlaubnis. Die Anforderungen nach dem Stand der Technik für diese Betriebe sind in den Anhängen 1, 5 und 11 der Abwasserverordnung geregelt und sind bei diesen Betrieben vollständig umgesetzt. Die Anforderungen des Artikel 13 in Verbindung mit Anlage III der Kommunalabwasserrichtlinie sind somit erfüllt. 5.1. PRTR-Sonderuntersuchungsprogramm Für Kläranlagen mit einer Ausbaugröße über 100.000 EW besteht entsprechend der PRTR-Verordnung (EG) Nr. 166/2006 vom 18. Januar 2006 eine Berichtspflicht über die Freisetzung bestimmter Schad- stoffe (prioritäre Stoffe), wenn die in der Verordnung genannten Schwellenwerte überschritten werden. Neben der Information der Öffentlichkeit über die Emissionssituation fließen diese Daten ebenfalls in die Bestandsaufnahme prioritärer Stoffe nach der Richtlinie 2008/105/EG zu Umweltqualitätsnormen im Bereich der Wasserpolitik ein und werden auch auf europäischer Ebene für strategische Überlegun- gen herangezogen. Die Ergebnisse der ersten Bestandsaufnahme haben gezeigt, dass bei den PRTR-Daten eine hohe Variabilität bzgl. der angewandten Probenahmestrategie und Sensitivität der Analyseverfahren besteht. Dies kann oft zu einer fehlerhaften Einschätzung bei der Bilanzierung von Stoffströmen aus kommuna- len Kläranlagen führen. Um valide und vergleichbare Ergebnisse aus künftigen Messkampagnen zu erhalten, hat das Umweltbundesamt im Rahmen eines Vorhabens „Handlungsempfehlungen zur Pro- benahmestrategie und Analyseverfahren für prioritärer Stoffe in urbanen Entwässerungssystemen“ ent- wickeln lassen. Das Land Baden-Württemberg hat dies zum Anlass genommen, die tatsächliche Emis- sionssituation für kommunale Kläranlagen über 100.000 EW auf Grundlage dieser Handlungsempfeh- lungen zu erfassen und auf den jeweiligen Standort bezogene valide Daten zu ermitteln. Die Teilnahme an dem Sonderuntersuchungsprogramm ist freiwillig und die Kosten werden weitgehend vom Land getragen. Landesweit haben sich 33 Kläranlagen > 100.000 EW und weitere zwei Anlagen – die infolge von Ausbaumaßnahmen in naher Zukunft eine Ausbaugröße > 100.000 EW erreichen werden – dazu bereiterklärt an dem Projekt teilzunehmen.
Kommunales Abwasser 23 Im Rahmen des Sonderuntersuchungsprogramms wird vorranging der Ablauf der Kläranlagen auf 38 Einzelsubstanzen untersucht. Bei den Substanzen handelt es unter anderem um Industriechemikalien, Pflanzenschutzmittel, Schwermetalle und polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK). Bei ei- ner kleinen Anzahl von Anlagen wird ebenfalls der Zulauf beprobt, um den gesamten In- und Output- strom abbilden zu können. Das Sonderuntersuchungsprogramm wird im Zeitraum September 2016 bis Juli 2017 mit insgesamt sechs Messkampagnen durchgeführt.
24 Kommunales Abwasser
6. Klärschlamm
In Baden-Württemberg fielen im Jahr 2015 rund 230.000 t Klärschlamm (Trockensubstanz, TS) an. Der
Hauptentsorgungspfad des anfallenden Klärschlammes ist mit 95,1% die energetische Verwertung
(siehe Abb. 17). Diese erfolgt in Baden-Württemberg in vier Zementwerken, in zwei Klärschlamm-Mo-
noverbrennungsanlagen, in zwei Klärschlammvergasungsanlagen, in einem Kohlekraftwerk und in ei-
ner Papierfabrik. Darüber hinaus werden Klärschlämme auch außerhalb von Baden-Württemberg mit-
verbrannt. Daneben spielen die Verwendung im Landschaftsbau (mit 3,2%) und landwirtschaftliche
Verwertung (mit 1%) eine untergeordnete Rolle.
Sonstige Landwirtschaft
Verfahren 2,4 Tsd t Landschaftsbau
1,6 Tsd t 1,0 % 7,4 Tsd t
0,7 % 3,2 %
Verbrennung
221,2 Tsd t
95,1 %
Abbildung 17: Verwertung von Klärschlamm in Baden-Württemberg (Stand: 31.12.2015)
Der Anteil der energetischen Nutzung hat erneut weiter zugenommen. Dies ist insbesondere darauf
zurückzuführen, dass sich das Land Baden-Württemberg bereits 2001 für den Ausstieg aus der land-
wirtschaftlichen und landbaulichen Verwertung und damit für die energetische Nutzung des Klär-
schlamms ausgesprochen und auch entsprechende Maßnahmen gefördert hat.Kommunales Abwasser 25
Verbrennung Landschaftsbau Landwirtschaft Deponierung Sonstige Verfahren
100% 3% 2%
1% 2% 1%
2% 1%
2% 3% 4% 3%
5% 7% 6% 6%
90% 9%
14%
16%
80%
70%
27%
60%
50%
95% 95%
87% 90% 91%
40%
75%
30%
51%
20%
10%
0%
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015
Abbildung 18: Zeitliche Entwicklung der Verwertung von Klärschlamm in Baden- Württemberg
(Stand: 31.12.2015)
Bei der energetischen Klärschlammverwertung muss, in Abhängigkeit von der gewählten Verbren-
nungsanlage, eine vorherige Entwässerung und ggf. auch Trocknung der Klärschlämme erfolgen. Dazu
können verschiedene Verfahren, von der mechanischen Entwässerung über solare oder solarunter-
stützte Trocknung bis hin zur thermischen Trocknung mit Biomasse oder fossilen Brennstoffen, einge-
setzt werden. In Baden-Württemberg sind etwa 50 Klärschlammtrocknungsanlagen in Betrieb.
Durch Veränderungen der Marktbedingungen für Kohlekraftwerke und den Bundesweit steigenden Be-
darf an Klärschlamm-Verbrennungskapazitäten wird es in der Folge von Kraftwerksschließungen zu
einer Überprüfung der Verwertungswege für Klärschlämme und zur Schaffung zusätzlicher Verbren-
nungskapazitäten kommen müssen. Diese Überprüfung wird durch das Umweltministerium bis zum
Jahresende 2017 vorgenommen. Das Ergebnis bleibt abzuwarten und wird in die Neufassung des Teil-
plans Siedlungsabfall zum Abfallwirtschaftsplan Baden-Württemberg Eingang finden.
Der aus Vorsorgegründen sinnvolle Verzicht auf eine landwirtschaftliche Klärschlammverwertung hat
zur Folge, dass der Nährstoffkreislauf unterbrochen wird. Klärschlamm enthält den Pflanzennährstoff
Phosphor, der für die Landwirtschaft wichtig ist, um ausreichend Nahrungsmittel für die Bevölkerung
produzieren zu können. Bisher muss der benötigte, mineralische Phosphor vollständig importiert wer-
den, da es in Deutschland keine natürlichen Lagerstätten gibt. Aufgrund der weiter wachsenden Erd-
bevölkerung, der Abhängigkeit von wenigen Lieferländern und der steigenden Verunreinigungen von26 Kommunales Abwasser Rohphosphaten muss überlegt werden, wie langfristig die Versorgung mit Phosphor sichergestellt wer- den kann. Das größte Phosphorrückgewinnungspotenzial liegt dabei im Klärschlamm. Einsatzfähige Technologien zur Phosphorrückgewinnung stehen mittlerweile zur Verfügung. Die Neufassung der Klärschlammverordnung sieht Regelungen für die Rückgewinnung des Phosphors vor. In Abhängigkeit der Größe der Kläranlage und nach Ablauf bestimmter Übergangsfristen (12 bis 15 Jahre) werden die Betreiber zukünftig verpflichtet sein, Phosphor aus dem Klärschlamm oder aus dem Abwasser zurückzugewinnen. Diese Rückgewinnung kann alternativ nach einer Klärschlammver- brennung in Monoverbrennungsanlagen aus der Klärschlammasche erfolgen. Hierzu gestattet die Ver- ordnung eine Zwischenlagerung von Klärschlammaschen, um später die Phosphorrückgewinnung durchzuführen. Dies dürfte aufgrund der hohen Kosten für Zwischenlagerung und Rückholung der Klär- schlämme jedoch nur in wenigen Ausnahmefällen in Betracht kommen. Das Umweltministerium hat Ende 2012 die Phosphor-Rückgewinnungsstrategie Baden-Württemberg veröffentlicht, auf deren Grundlage langfristig eine ökologisch und wirtschaftlich verträgliche Versor- gung mit Phosphor für Baden-Württemberg gewährleistet werden soll. Zur Umsetzung der Phosphor- Rückgewinnungsstrategie des Landes werden in der aktuellen Förderperiode 2014-2020 des Europäi- schen Fonds für regionale Entwicklung (ERFE) die Untersuchung, Weiterentwicklung sowie großtech- nische Umsetzung unterschiedlicher Phosphor-Rückgewinnungsverfahren in Pilotanlagen an verschie- denen Standorten gefördert. Für das Programm stehen acht Mio. Euro EFRE-Mittel sowie zusätzliche Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds (KIF) des Landes zur Verfügung. Einen weiteren Baustein der Phosphor-Rückgewinnungsstrategie stellt die von Baden-Württemberg fi- nanzierte großtechnische Anlage zur Rückgewinnung von Phosphor auf dem Gelände der Kläranlage des Abwasserzweckverbandes Offenburg dar. Die nach dem „Stuttgarter Verfahren“ arbeitende Anlage läuft seit November 2011. Mit der Pilotanlage wird ein in etwa 5.000 Einwohnerwerten entsprechender Teilstrom des Klärschlamms behandelt. Das „Stuttgarter Verfahren“ zeichnet sich dadurch aus, dass kommunaler Klärschlamm von Kläranlagen mit simultaner Phosphat-Elimination mit Eisensalzen ver- wendet werden kann und keine Verfahrensumstellung seitens der Abwasserreinigung erforderlich ist. Das erzeugte Produkt Magnesium-Ammonium-Phosphat (MAP) kann nach bisherigen Erkenntnissen direkt als Mehrnährstoffdünger in der Landwirtschaft verwendet werden. Bislang gemessene Schwer- metallgehalte von MAP sind als unkritisch zu bewerten und liegen größtenteils unter den Gehalten von Rohphosphaten.
Kommunales Abwasser 27
7. Investitionen und staatliche Förderung
Die Förderung von Abwasseranlagen in Baden-Württemberg war eine wesentliche Voraussetzung für
die Erreichung und den Erhalt des heutigen Standes des Ausbaus von Kanalisation, Regenwasserbe-
handlung und Abwasserreinigung. Im Jahre 1994 wurde die Förderung auf eine gebührenorientierte
Basis umgestellt. Dies bedeutet, dass eine Förderung nur noch bei Überschreiten einer bestimmten
Belastung der Bürger durch die Wasser- und Abwassergebühren erfolgt.
Die nachfolgende Abbildung 19 zeigt die seit 2000 geförderten Investitionen der Kommunen und Ab-
wasserverbände für Kanalisation, Regenwasserbehandlung und Kläranlagen. Der Anteil der Fördermit-
tel ist mit angegeben.
350
314 Gesamtkosten Fördermittel
300
255
245
250
199
200
Mio. Euro
161
145 142
150
121
111 112 112 112
105 105
98 95 94
100
78 79 83
59 64 54 57 58 55
45 45 50 47 47 49 49
50 42
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Abbildung 19: Geförderte Investitionen und Fördermittel in der Abwasserentsorgung in
Baden-Württemberg seit 2000 (Stand 31.12.2016)28 Kommunales Abwasser
Auch in den kommenden Jahren müssen in die Abwasserbeseitigung noch erhebliche Sum-
men investiert werden. Diese Kosten werden wie folgt geschätzt:
1. Neubau, Modernisierung, Sanierung und Ausbau von Abwasserbehandlungsanlagen, An-
schluss kleinerer Einheiten an größere Kläranlagen: 0,5 Mrd. €
In Baden-Württemberg müssen viele Kläranlagen, die bereits in den 1970-er Jahren zur biologi-
schen Abwasserreinigung ausgebaut wurden, dringend saniert werden. In diesem Zusammen-
hang sollen aus betrieblichen und betriebswirtschaftlichen Gründen kleinere Kläranlagen aufge-
geben und die Siedlungsflächen an größere Einheiten angeschlossen werden.
Daneben ist der Restausbau der Regenwasserbehandlung und der Sanierung älterer Regenwas-
seranlagen erforderlich, deren Errichtung zum Teil auch in die 1970-er Jahre zurückreicht. Auch
ist die Ausstattung von Regenbecken mit Mess- und Regeltechnik zur betrieblichen Optimierung
notwendig.
Zur Verbesserung der Energieeffizienz sind weitere Energieoptimierungsmaßnahmen auf Klär-
anlagen notwendig.
2. Gewässerbezogene Anforderungen, insbesondere zur
Umsetzung der EG-WRRL: 1,0 Mrd. €
Gewässerbezogene Anforderungen, insbesondere zur Umsetzung der EG-WRRL erfordern zu-
sätzliche Maßnahmen zur Reinigung des Abwassers in Kläranlagen und Regenwasserbehand-
lungsanlagen.
3. Kanalisation: 3,3 Mrd. €
Ungefähr 12.000 km (rd. 20 % der Mischwasserkanäle und rd. 14 % der Schmutzwasserkanäle
in Baden-Württemberg) sind so schadhaft, dass sie zeitnah saniert werden müssen.
Ferner sind Maßnahmen zur Verminderung von Fremdwasser erforderlich.Kommunales Abwasser 29 8. Ausblick In den letzten Jahrzehnten wurden in Baden-Württemberg viele Maßnahmen zum Neu- und Ausbau sowie zur Modernisierung von Abwasseranlagen verwirklicht. Dadurch hat sich die Wasserqualität in den Gewässern wesentlich verbessert. Trotzdem müssen in den kommenden Jahren noch erhebliche Summen in die Abwasserbeseitigung investiert werden, um unter anderem den guten Zustand nach Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen. Erforderlich werden insbesondere Maßnahmen zur Phosphor- Elimination auf Kläranlagen. Der Bau und Betrieb von Abwasseranlagen ist mit erheblichen Aufwendungen verbunden. Deshalb gilt es weiterhin, die Struktur der Abwasserbeseitigung durch Konzentration in größeren, leistungsfähige- ren Abwasseranlagen zu verbessern. Unter Beibehaltung der Reinigungsleistung sind auch anlagen- bezogene Optimierungsmöglichkeiten zu nutzen; etwa Energieeinsparung und Nutzung von Energie- gewinnungspotenzialen auf den Anlagen. Eine anlagenübergreifende Zusammenarbeit beim Betrieb kann ebenfalls zu wirtschaftlicheren Ergebnissen führen. Mit fortschreitender Leistung der Kläranlagen rücken die Einleitungen aus Entlastungsanlagen im Mischsystem, z. B. Regenüberlaufbecken – aber stoffbezogen auch im Trennsystem – immer mehr in den Vordergrund. Neben dem Bau der noch erforderlichen Anlagen ist deren verfahrenstechnische Aufrüstung und betriebliche Optimierung eine wichtige Aufgabe. Der genaueren Ermittlung des Be- triebsverhaltens kommt dabei eine große Bedeutung zu. Eine große Bedeutung haben hier die Nach- rüstung von Regenbecken mit Messeinrichtungen zum Messen des Entlastungsverhalten und deren dauerhaften Betrieb sowie der Umgang mit den gewonnenen Erkenntnissen. Ein wichtiges Handlungsfeld ist auch die Reduzierung von Fremdwasser in der Kanalisation. Die Sa- nierung undichter Kanäle wird deshalb weiterhin hohe Investitionen erfordern. Die inzwischen erfolgte flächendeckende Einführung der gesplitteten Abwassergebühr wird dazu beitragen, die Reduzierung des Niederschlagswasserabflusses in der Kanalisation durch Flächenentsiegelung und Abkoppelungs- maßnahmen zu beschleunigen. Durch die Fortschritte bei der Analytik ist es möglich, immer geringere Konzentrationen von Stoffen in der Umwelt nachzuweisen. Neben Arzneimittelrückständen werden auch Industriechemikalien und Pflanzenbehandlungsmittel in den Gewässern nachgewiesen.
Sie können auch lesen