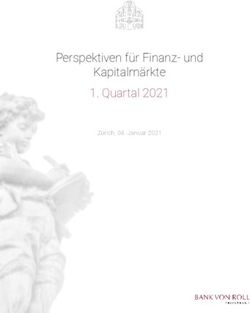Umwelterklärung 2020 Fernwasserversorgung Oberfranken (FWO)
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
-^^
'ä^l
Fernwasserversorgung ca-~t
Fernwasserversorgung Oberfranken (FWO)
Umwelterklärung 2020
Stand: September 2020
Berichtsjahr: 2019
Für die Standorte:
Betriebs- und Verwaltungsgebäude
Ruppen 30, 96317 Kronach
Trinkwasseraufbereitungsanlage
Rieblich 5, 96349 Steinwiesen
Netzbetrieb Fernwasserleitungen,
Hochbehälter und Pumpwerke im
Versorgungsgebiet der FWO
ÄVorwort
Die Fernwasserversorgung Oberfranken (FWO) richtet sich durch eine umweltbezogene
Unternehmenspolitik in allen betrieblichen Aktivitäten und Strukturen nach den Anforderungen des
Umweltmanagementsystems gemäß EMAS und DIN EN ISO 14001 aus.
Die vorliegende aktualisierte Umwelterklärung 2020 mit Stand 10/2020 umfasst als Berichtszeitraum
das Jahr 2019. Ziel ist es, über bisher erzielte Ergebnisse und aktuelle Entwicklungen im Bereich des
Umweltmanagements zu informieren.
Bericht erstattet wird über die Standorte Betriebs- und Verwaltungsgebäude Kronach (Ruppen), die
Trinkwasseraufbereitungsanlage (TWA) Rieblich sowie über alle Fernwasserleitungen, Hochbehälter
und Pumpwerke im Versorgungsgebiet.
Das Umweltmanagementsystem der FWO unterliegt einer ständigen Weiterentwicklung. Festgelegte
Ziele und zugehörige Maßnahmen werden im laufenden Betrieb umgesetzt, im Arbeitssicherheits-
und Umweltausschuss regelmäßig auf ihre Wirksamkeit überprüft und gegebenenfalls angepasst.
Im Oktober 2019 erfolgte die letzte Begutachtung des UMS durch die Umweltgutachter.
Generelles Ziel der Fernwasserversorgung Oberfranken ist es, durch ein aktiv gelebtes
Managementsystem die hervorragende Produktqualität des Trinkwassers sowie das hohe
Qualitätsniveau in allen Arbeitsbereichen zu garantieren und auch für die Zukunft sicher zu stellen.
Das Thema Versorgungssicherheit hat oberste Priorität. Durch die Einführung des Betriebs- und
Organisationshandbuches (BOH), die Implementierung eines Risikomanagementsystems (RMS) sowie
die Teilnahme an einem nationalen Benchmarkingprojekt ist die FWO für die Zukunft gut aufgestellt.
Die Fernwasserversorgung Oberfranken hat sich aus ihrer Tätigkeit als Trinkwasserversorger zum Ziel
gesetzt, die Umweltleistungen über die einschlägigen Vorschriften hinaus nachhaltig zu verbessern.
Kronach, im Oktober 2020
;^OJ
Dr. Heinz Köhler Markus Rauh Denis Sonntag
Verbandsvorsitzender Verbandsdirektor Umweltmanagementbeauftragter
Seite 2Inhaltsverzeichnis
Seite
Vorwort 2
Das Unternehmen / Verbandsmitglieder / Aufgaben des Unternehmens 4
Organigramm der FWO 5
Umweltmanagementsystem / FWO-Umweltleitbild 6
Aufbauorganisation 9
Ablauforganisation 10
Umweltaspekte - Umweltauswirkungen 11
Umweltkennzahlen und Kernindikatoren 11
l. Wasser und Abwasser 12
2. Abfall 17
3. Energieeffizienz 21
4. Emissionen 32
5. Hilfs- und Betriebsstoffe 33
6. Biologische Vielfalt 35
7. Kennzahlen und Kernindikatoren 38
FWO - Umweltprogramm 2019 -2022 42
Erklärung der Umweltgutachter zu den Begutachtungs-
und Validierungstätigkeiten 49
Seite 3 • v^^ji}
.Das Unternehmen
Der Zweckverband Fernwasserversorgung Oberfranken (FWO) ist eine Körperschaft des öffentlichen
Rechts. Er wird geführt nach dem Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit, der
Eigenbetriebsverordnung, der Verbandssatzung und der Geschäftsordnung.
Verbandsmitglieder
Verbandsmitglieder sind die Landkreise Bamberg, Bayreuth, Coburg, Haßberge, Hof, Kronach,
Kulmbach, Lichtenfels sowie die Städte Bamberg, Bayreuth, Coburg, Hof, Kulmbach, Neustadt bei
Coburg und Selb. Die Verbandsmitglieder entsenden Landräte bzw. Oberbürgermeister in die
Verbandsversammlung.
Aufgaben des Unternehmens
Aufgaben der FWO sind der Bezug von Rohwasser, die Aufbereitung zu Trinkwasser und die
Versorgung der Verbandsmitglieder über ein Rohrnetzsystem. Die Fernwasserversorgung
Oberfranken liefert für Regionen mit unzureichendem Grundwasservorkommen Trinkwasser,
welches aus sehr weichem, nährstoffarmem Talsperrenwasser gewonnen wird. Die FWO deckt ihr
Wasserdargebot zu ca. 81 % aus der Trinkwassertalsperre Mauthaus, die vom Wasserwirtschaftsamt
Kronach betrieben wird. 1991 wurde aus Gründen der Versorgungssicherheit mit dem Zweckverband
Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum (WFW) ein Wasserlieferungsvertrag abgeschlossen.
Im Jahr 2000 wurde zusätzlich ein Wasserlieferungsvertrag mit der Stadt Kulmbach geschlossen.
Die grundsätzlichen Aufgaben zur Unternehmensstruktur, Organisation, Personalsituation,
Aufbereitungstechnik und Anlagenbeschreibung haben sich in den letzten Jahren nicht wesentlich
geändert und sind in der konsolidierten Umwelterklärung 2019 zu finden.
Die FWO unterstützt seit einigen Jahren im Landkreis Kronach die örtliche Wasserversorgung im
Rahmen einer kommunalen Kooperation bei der Betriebsführung. Dies hat hauptsächlich
Auswirkungen auf die Gesamtkilometerleistung sowie energetische Aspekte.
Insgesamt sind 78 Mitarbeiter (Stand: 01.09.2020) für die Fernwasserversorgung Oberfranken
beschäftigt. Die Gesamtbelegschaft teilt sich wie folgt auf:
• 66 technische Angestellte
• 10 kaufmännische Angestellte
• 2 Auszubildende
• Standort Kronach: 55 Mitarbeiter
• Standort Rieblich: 23 Mitarbeiter
Se/to 4Organigramm
Fernwasserversorgung
Oberf ranken
±
Stand: 01.06.2020
VD Rauh
1/1 Sager 11/1 Vokal 11/2 Rüger ll/3Brandl
Netz/Mechanil
1/1-1 Stadei mann
Buchhaftung
l Sachgebietslertui
In Personalunlon
W = Verbandsvorsitzender
VD = Verbandsdirektor
Sek = Sekretariat
BL = Betriebsleiter
DL = Dienstleistungen
Kaufm. Verw. = Kaufmännische Verwaltung
TWA = Trinkwasseraufbereitungsanlage
Se/te 5Umweltmanagementsystem
Die Fernwasserversorgung Oberfranken, als größter Trinkwasserversorger in Oberfranken, hat sich
zum Ziel gesetzt, den Umweltschutz als wesentlichen Bestandteil aller betrieblichen und
organisatorischen Abläufe im Unternehmen aufzunehmen und die Umweltleistungen über die
einschlägigen Vorschriften hinaus dauerhaft zu verbessern.
Hierzu wurde ein Umweltmanagementsystem auf der Grundlage von EMAS und DIN 14001
eingeführt, das stetig weiterentwickelt und den zukünftigen Erfordernissen angepasst wird.
EMAS steht für „Eco-Management and Audit Scheme" und hat sich als Kurzbezeichnung für das EU-
Umweltmanagementsystem eingebürgert, das in der aktuellen dritten Fassung (EMAS III) auf der
Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November
2009 „über die freiwillige Teilnahme von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für das
Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung" beruht. EMAS enthält über die
Anforderungen der DIN EN 14001 hinaus, zusätzliche Anforderungen wie etwa die Veröffentlichung
dieser Umwelterklärung.
Energiemanagement
Energiemanagement der FWO ist schon von Beginn an ein integraler Bestandteil des
Umweltmanagementsystems. Seit der Einführung, haben wir uns zum Ziel gesetzt die
Energieverbräuche detailliert zu erfassen und Optimierungen durchzuführen. Hierfür werden
kontinuierlich neue Messstellen installiert. Der tägliche Betrieb wird auf die Effizienz der Anlagen
abgestimmt.
Zur Bewertung der Hauptstromverbraucher mittels Energieleistungskennzahlen, den sogenannten
ENPIs (Energy Performance Indicators), werden jetzt weitere Einflussgrößen wie z. B.
Anlagenauslastung, -alter, Energieanteil am Gesamtverbrauch, herangezogen.
Im Zuge von Modernisierungsmaßnahmen werden neuste Antriebstechnologien eingesetzt.
Mittlerweile hat sich der Einsatz von IE4-Motoren in Verbindung mit Frequenzumrichtern
durchgesetzt. Somit kann bedarfsgerecht die Drehzahl der Trinkwasserförderpumpen geregelt
werden.
Zur Einbeziehung und Information unserer Mitarbeiter in das Energiemanagementsystem wird
jährlich ein „Energie-Flyer" herausgegeben.
Energiebeauftragter
Als Energiebeauftragter fungiert Herr Marco Brandl (Abteilungsleiter 11/3), der auch den
Umweltmanagementbeauftragten (UMB) unterstützt.
Seite 6Technisches Sicherheitsmanagement
Vom Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) erhielt die FWO nach erfolgreich
bestandener Überprüfung erneut im Jahr 2016 die Bestätigung für ihr Technisches
Sicherheitsmanagement (TSM). Hier wird die Einhaltung der relevanten technischen Regelwerke und
rechtlichen Vorgaben zertifiziert.
Die FWO ist damit eines der wenigen Wasserversorgungsunternehmen in Oberfranken, das über
diese Zertifizierung verfügt.
Risikomanagementsystem
Das auf Basis des Leitfadens des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK)
initiierte Risikomanagementsystem (RMS) wurde implementiert. Nach der Identifikation
strategischer Risiken und der Aufnahme und Analyse von Kernprozessen des Unternehmens wurde
ein Risikoprofil für das Unternehmen insgesamt erstellt. Weitere Phasen der Prüfung waren die
Durchführung einer umfassenden Gefahrenanalyse, die Identifizierung relevanter Szenarien und
anschließend die Bestimmung von Schadensausmaß und Eintrittswahrscheinlichkeit.
Daneben wurden die seit Jahren eingeleiteten Maßnahmen zur Risikominimierung weiter
vorangetrieben. Insbesondere umfasste dies:
• die Umsetzung des Betriebs- und Organisationshandbuch (BOH)
• die Mitarbeit in der Arbeitsgemeinschaft ArGe Ausgleich + Verbund
• die Durchführung von Überwachungsaudits im Rahmen von EMAS und des Labors nach DIN
EN ISO 17025
• die Teilnahme am technischen Sicherheitsmanagement (TSM) nach DVGW Arbeitsblatt W
1000
Darüber hinaus hat die FWO eine erste Studie zum Themenkomplex langfristige
Versorgungssicherheit vorgelegt. Da derzeit kaum Leitungsschäden zu verzeichnen sind, liegt der
Fokus der Studie auf Maßnahmen, die eine zusätzliche Absicherung des Leitungssystems und der
Speichervolumina berücksichtigen.
.—SOv
/'
;-—
.'''
-^\^\
Lk^.. )i)
Seite 7 — — ^^"....^
^^FWO-Umweltleitbild
Das Umweltleitbild definiert die Handlungsgrundsätze und Gesamtziele des Unternehmens. Durch
regelmäßige Kontrollen wird eine stetige Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes gefördert
und gewährleistet.
Das seit 2000 existierende Umweltleitbild wurde in 2014 durch Energierelevante Aspekte erweitert.
Das Umweltleitbild hat seit dem Bestand und ist in dieser Form gültig.
Präambel
Die FWO sichert für weite Teile Frankens die Versorgung mit Wasser - Trinkwasser von höchster
Qualität. Das Unternehmen trägt vorrangig Verantwortung für die dauerhafte Sicherung des
Versorgungsauftrages in der Region und der hiermit verbundenen Maßnahmen zum Schutz des
Wassers in seiner sauberen Umwelt. Durch den Versorgungsauftrag ist eine Einflussnahme auf die
Umwelt nicht auszuschließen. Die FWO will durch eine kontinuierliche Verbesserung die
Umweltleistungen über die einschlägigen Umweltvorschriften hinaus dauerhaft verbessern.
Grundsätze
l. Ziel der FWO ist bei allen unternehmerischen Aktivitäten, negative Einwirkungen auf die Umwelt so gering
wie möglich zu haften und mit eigenem Engagement an der Optimierung der örtlichen, regionalen und
globalen Umweltprobleme mitzuwirken.
2. Ziel der FWO ist die dauerhafte Versorgung der Region mit Trinkwasser aus einer gesunden Umwelt,
insbesondere dort, wo keine ausreichenden örtlichen Wasservorräte vorhanden sind.
3. Zur langfristigen Sicherung der Wasserversorgung überwacht, prüft und bewertet die FWO kontinuierlich
und nachhaltig das Produkt Wasser, das Aufbereitungsverfahren, das Rohrnetz und die
Trinkwasserbehälter, sowie die hiermit verbundenen direkten und indirekten Auswirkungen auf die
Umwelt.
4. Das FWO - Umweltmanagement gewährleistet auf der Basis dieses Umweltleitbildes, dass gemeinsam mit
Partnern und Lieferanten die umweltfreundlichen, sowie energieeffizienten Aufbereitungs- und
Verteilungsverfahren gesichert und soweit wirtschaftlich vertretbar, nach dem Stand der Technik, weiter
entwickelt werden.
5. Die FWO informiert die Kunden und die Öffentlichkeit regelmäßig über die Umweltaspekte ihres Handelns
sowie über den sorgfältigen Umgang mit dem Naturgut Wasser. Die Zusammenarbeit mit Politik und
Verwaltungen beruht auf einer handlungsorientierten und vertrauensvollen Basis und bezieht die
Notfallversorgung und Gefahrenabwehr mit ein.
6. Die FWO überprüft unter Beachtung der umweltrelevanten Daten regelmäßig der Einhaltung des
Umweltleitbildes, der Umwelt- und Energieziele und damit die Wirksamkeit des
Umweltmanagementsystems.
7. Alle zur erfolgreichen Erfüllung des Umweltleitbildes, des Umweltprogramms mit seinen Umwelt- und
Energiezielen notwendigen Ressourcen werden bereitgestellt. Der Erwerb energieeffizienter Produkte und
Dienstleistungen bilden hierbei eine wesentliche Grundlage.
8. Die Mitarbeiter der FWO werden entsprechend ihren Aufgaben im Umweltschutz informiert, qualifiziert
und motiviert. Die FWO und deren Mitarbeiter sind damit zur Umsetzung dieser Grundsätze und zur
Erfüllung der gesetzlichen und behördlichen Auflagen und weiterer, durch die Organisation eingegangenen
Anforderungen auch hinsichtlich des Energieeinsatzes, des Energieverbrauchs und der Energieeffizienz im
Rahmen ihrer jeweiligen Verantwortung befähigt und verpflichtet.
Kronach, den 18.12.2013
Seite 8Aufbauorganisation
Die Aufbauorganisation stellt im Rahmen des Umweltmanagementsystems die Zuordnung von
Aufgaben und Verantwortungen sicher. Sie lehnt sich an die betriebliche Organisation an.
Als Beauftragter der obersten Leitung für das Umweltmanagementsystem wurde Herr Denis Sonntag
mit Wirkung vom 06.05.2015 bestellt.
Sein Stellvertreter ist Herr Michael Wunder, der seit 01.06.2007 das Amt des stellvertretenden
Umweltmanagementbeauftragten ausübt.
Dem Umweltmanagementbeauftragten (UMB) sind die beiden Gewässerschutzbeauftragten (Thomas
Deuerling mit Stellvertreter Michael Rüger) sowie der Energiebeauftragte (Marco Brandl)
zugeordnet.
Die Stelle der Fachkraft für Arbeitssicherheit wird seit dem 01.09.2018 durch eine externe Firma
ausgeführt. Zeitgleich ist ein Mitarbeiter der FWO in Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit.
In gemeinsamen Sitzungen des Arbeitsschutz- und Umweltausschusses wird unter anderem auch an
der stetigen Weiterentwicklung des Umweltmanagementsystems und seiner praktischen Umsetzung
im Unternehmen gearbeitet. Hierbei sind die Werkleitung und die Abteilungsleiterebene sowie der
Personalrat stets eingebunden.
fV Dr. Köhler Organigramm - Umwelt
T Fernwasserversorgung
VD Rauh Oberf ranken
Stand 01.06.2020
1/lSager 11/1 Vokal 11/2 Rüger 11/3 Brandl
Abteilungsleitung
Kaufm.Verw. Netz-Media Elektro
*z.Zt.externerDL
W = Verbandsvorsitzender Beauftragte Personen im
I/O = Verbandsdirektor Gefahrgutrecht:
FaSI = Fachkraft für Arbeitssicherheit o Thomas Deuerting
UMB = Umweltmanagementbeauftragter o Michael Wunder
SIGeKo = Sicherheits- und Gesundheitskoordinator o Frank Blimler ',:
Bi = Betriebsleiter ,^~~~'Ablauforganisation
Die Ablauforganisation beinhaltet die Regelungen zum Umweltmanagementsystem. In allen
Organisationseinheiten der FWO werden regelmäßig interne Umweltbetriebsprüfungen
durchgeführt, mit dem Ziel, die Einhaltung der Umweltmanagementanforderungen und der
rechtlichen Vorgaben zu überprüfen. Die Werkleitung kontrolliert jährlich den Stand der Entwicklung
sowie die Eignung und Wirksamkeit des Systems im Management - Review (Bericht der obersten
Leitung).
Alle Vorgaben des Umweltmanagementsystems sind im Betriebs- und Organisationshandbuch (BOH)
der FWO dokumentiert.
Seite 10Umweltaspekte - Umweltauswirkungen
Die Fernwasserversorgung Oberfranken ist sich bewusst, dass sie sich mit ihren Tätigkeiten und
Aktivitäten in einer Wechselbeziehung mit der Umwelt befindet. Das Umweltmanagementsystem
spricht hierbei von den Umweltaspekten eines Unternehmens, die mehr oder weniger starke
Auswirkungen auf die Umwelt haben können. Dabei wird zwischen direkten und indirekten Aspekten
unterschieden.
Direkte Umweltaspekte und deren Auswirkungen (z. B. Lagerung von wassergefährdenden Stoffen,
Energieverbrauch, Wassereinleitungen in Gewässer, Abfallentsorgung usw.) können vom
Unternehmen unmittelbar beeinflusst werden.
Indirekte Aspekte können Auswirkungen haben, die unter anderem durch die Nutzung von Waren
und Dienstleistungen hervorgerufen werden.
Auf indirekte Umweltaspekte hat die Fernwassen/ersorgung Oberfranken nur begrenzten Einfluss.
Dem Zweckverband ist es aber sehr wichtig, seine Umweltleistung auch in diesem Bereich zu
verbessern.
So wird etwa im Prozess Beschaffung die Auswahl von Lieferanten nach Umweltgesichtspunkten mit
einbezogen.
Durch Weitergabe des Know-hows auch im Bereich des Umweltschutzes z. B. im Zuge der erbrachten
Dienstleistungen (Kommunale Kooperation usw.) für Gemeinden kann an einer Optimierung der
Umweltleistungenvon Kunden und Vertragspartnern mitgewirkt werden.
Ziel des angewandten Umweltmanagementsystems ist es, alle auftretenden bzw. relevanten
Umweltaspekte und deren Auswirkungen zu ermitteln, zu bewerten und wenn erforderlich deren
Auswirkung zu minimieren. Zu diesem Zweck wird regelmäßig im Rahmen interner
Umweltbetriebsprüfungen (Audits) eine Bewertung aller Umweltaspekte vorgenommen.
Bei der Beurteilung der Umweltaspekte werden nachfolgende Kriterien berücksichtigt, wobei hier
der bestimmungsgemäße Betrieb im Unternehmen sowie mögliche umweltschädigende Ereignisse /
Betriebsstörungen betrachtet werden:
• gesetzliche Vorgaben
• Gefährdungspotential (Art und Menge)
• Umwelt- und gesellschaftspolitische Relevanz
• Umweltkosten
Umweltkennzahlen und Kernindikatoren
Seit 2010 werden von der Fernwasserversorgung Oberfranken gemäß EMAS Angaben zu festgelegten
Kernindikatoren dokumentiert und jährlich fortgeschrieben (siehe auch Tabelle 11, Seite 37).
Se/te 11l. Wasser und Abwasser
1.1 Wasser
Abbildung l: Betriebsdaten und Wassereigenverbrauch 2012 - 2019
Gewinnung und Bezug
fffl
16.000
10.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
i Oberflächenwasser Talsperre • Trinkwasserbezug (WFW und Kulmbach)
^
Abbildung 2:
Nutzbare Abgabe - Vertragskunden
I 8.000
1±1
§
^ 6.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
• Zusatzwasserbezieher ** • Vollabnehmer • Sonstige *
f./
Sefte 12
^Abbildung 3:
Wassereigenverbrauch
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
• Wassereigenverbrauch • Bestandsveränderung ***
Erläuterung:
Versorgung außerhalb Liefervertrag
Teilströme der Wasserversorgung durch Lieferung der FWO
(neben Eigenwasser der Kunden)
Differenzwassermenge aus Hochbehältern
(im Verhältnis zum Vorjahr)
Abbildung 4:
Wasserverlust mit Eigenverbrauch
900 10%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
• Wasserverlust, mit Eigenverbrauch • Anteil in % Gesamtbezug
\ •-,
Se/fe .13Abbildung 5:
Wasserverlust ohne Eigenverbrauch
0
0
0
Ti
c
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
• Wasserverlust, ohne Eigenverbrauch • Anteil in % Gesamtbezug
Im Jahr 2019 hat sich der Gesamtwasserbezug (Talsperre Mauthaus, Stadtwerke Kulmbach und
Zweckverband Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum) um 250.000 m3 gegenüber 2018
verringert.
Die Abgabemenge an die Vertragskunden ist folglich seit dem Jahr 2018 leicht gesunken.
1.2 Kontrolle der Wasseraualität, Analysen
Die Trinkwasserqualität wird durch das eigene akkreditierte Betriebslabor und durch externe
Untersuchungsstellen überwacht. Am 28./29.01.2020 konnte das Uberwachungs- und
Reakrreditierungsaudit gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 erfolgreich abgeschlossen werden.
Die Grenzwerte nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV) wurden im Berichtsjahr stets eingehalten.
Hier ein Beispiel vom 02.06.2020:
Parameter Befund Grenzwert nach TrinkwV
Natrium 8,1 mg/1 200 mg/1
Chlorid 11,1 mg/1 250 mg/1
Sulfat 16,9 mg/1 250 mg/1
Nitrat 4,6 mg/1 50 mg/1
Mangan < 0,005 mg/1 0,05 mg/1
Eisen < 0,005 mg/1 0,20 mg/1
Aluminium < 0,02 mg/1 0,20 mg/1
Der Gehalt an Pflanzenschutzmitteln liegt unterhalb der Nachweisgrenze.
Für Uran ist der Grenzwert in der Trinkwasserverordnung mit 10 ^g/1 vorgegeben. Der Analysewert
für das Trinkwasser aus der Trinkwasseraufbereitungsanlage Rieblich liegt mit < 0,1 ^g/1 ^eit^-^
unterhalb dieses Grenzwertes. /^/^~' -~s^!' \
Seite 14Die Trinkwasseranalyse, die Uranuntersuchung und der Prüfbericht des Technologiezentrums
Karlsruhe finden sich auch im Internet unter www.fwokronach.de/news/trinkwasseranalyse.
Die umfassenden Untersuchungen werden im Rhythmus von 2 Monaten wiederholt.
1.3 Abwasser
Der Abwassermenge:
a Spülwasser bei Baumaßnahmen
Spülwasser im Netzbetrieb
Filterrückspülwasser in derTrinkwasseraufbereitungsanIage Rieblich
Abwasseram Standort Kronach
Abwasseram Standort TWA Rieblich
ist gegenüber dem Jahr 2018 insgesamt um 114.607 m3 gesunken.
Aus der Abbildung 6 wird ersichtlich ist, dass in 2019 der Verbrauch des Spülwasser im Netzbetrieb
von 97.277 im Jahr 2018 auf 19.536 m3 gesunken.
Die Summe der Abwassermenge resultiert aus Leitungsspülung des Hofer, Bayreuther und Coburger
Astes, Spülung der Filterstufe l und II der Trinkwasseraufbereitungsanlage Rieblich (TWA Rieblich)
und die Reinigung von verschiedenen Wasserkammern im FWO Netz.
Im Bereich der Betriebszentrale Kronach / Ruppen ist der Wasserverbrauch konstant geblieben.
Seite 15Abbildung 6: Abwassermenge 2012 - 2019
Abwassermenge
323
•3l
400.000
314
350
350.000 -5S&.
307 574
300.000
321
m
250.000
c
£
u
3 200.000
n
l<
J3
^ 150.000
100.000
50.000
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
HSpülwasser Netzbetrieb i FilterspülwasserTWA Rieblich • Betriebszentrale Kronach
Serte 162. Abfall
Nach Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) wird zwischen gefährlichen und nicht gefährlichen Abfällen
unterschieden.
Die nachfolgend genannten Abfallschlüssel-Nummern richten sich nach der Verordnung über das
Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung - AVV).
Seit 2004 werden die Verpackungs- und Kunststoffabfälle an den Standorten Rieblich und Kronach
getrennt erfasst (gelbe Tonne). Da die anfallenden Mengen jedoch sehr gering sind werden sie in der
Abfallbilanz nicht aufgeführt.
In Kronach wird der Gewerbeabfall ungewogen im so genannten Umleerverfahren abgeholt. Eine
Umstellung auf Containerentleerung mit Verwiegung ist auf Grund der geringen anfallenden
Gewerbeabfallmengen in Kronach unpraktikabel und unwirtschaftlich.
2.1 Gefährliche Abfälle
Wie aus der Abfallbilanz ersichtlich wird, fallen für das Jahr 2019 in der Sparte gefährliche Abfälle nur
drei Abfallgruppen an.
Diese sind:
l. AVV-Nr. 15 0110* Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten
2. AVV-Nr. 16 06 Öl* Bleibatterien
3. AVV-Nr. 13 05 03* Schlämme aus Einlaufschächten
Die Menge der entsorgten Bleibatterien (AVV-Nr. 16 06 01*) ist auf die Erneuerung der Batterien an
den verschiedenen Standorten im Netz zurückzuführen.
Die Entleerung des Olabscheiders am Standort der TWA Rieblich ist die Menge der AVV-Nr. 13 05 03*
Schlämme aus Einlaufschächten begründet.
2.2 Nicht gefährliche Abfälle
Die Menge der Abfälle der „AVV-Nr. 17 04 11" Kupferkabel ist auf den Leitwartenumbau der TWA
Rieblich zurückzuführen.
Auf Grund der Anschaffung einer neuen Pumpe fällt am Standort Rieblich der Abfall „AVV-Nr. 16 02
16 Elektromotoren der alten Pumpe der Elektromotor mit 1680 kg an.
Größte Abfallmenge ist nach wie vor der Trinkwasserschlamm „AVV-Nr. 19 09 02", was durch die
natürlichen Schwankungsbreite der Qualität des Rohwassers begründet ist.
Seite 17 — —^—^'
^" "•^~"Abbildung 7: Abfallbilanz 2019:
gefährliche Abfälle:
2018
Schlämme aus
13 05 03* KC 5,00 x
Einlaufschächten ma
Rieblich m3 0,00
Netz m3 0,00
Verpackungen, die Rückstände
15 0110* KC 0,00
gefährlicher Stoffe enthalten kg
Rieblich kg 1480,00 x
Netz 0,00
_kg_
15 02 02* Aufsaug- u. Filtermaterial
KC 0,00
(ölhaltig) t
RIeblich t 0,00
Netz t 0,00
160601- Bleibatterien KC kg 0,00
Rieblich kg 0,00
kg 216,00 x
Netz
Stk 0,00
KC = Verwaltung Kronach
Rieblich = Trinkwasseraufbereitung Rieblich
Netz = Netzbetrieb
Seite 18nicht gefährliche Abfälle:
07 0104 Lösemittel KC m3 0,00
Riebllch m3 0,00
Netz m3 0,00
13 07 01 Heizöl und Diesel KC Itr 0,00
Rieblich Itr 900,00 x
Netz Itr 0,00
16 02 16 Elektromotoren KC kg 0,00
Rieblich kg 0,00
Netz kg_
567,00 x
17 0101 Beton - recyclfähig KC t 0,00
Rieblich t 0,00
Netz t 9,23 x
17 02 02 Altglas KC m3 0,00
Rieblich m3 7,00 x
Netz m3 0,00
17 0107 vermischter Bauschutt - recyclfähig KC t 0,00
Rieblich t 3,36
Netz t 3,76
17 04 01 Kupfer, Bronze, Messing KC kg 0,00
Rieblich kg 7,00 x
Netz Jnicht gefährliche Abfälle:
2018
19 09 02 Trinkwasserschlamm KC t 0,00
Rieblich t 254,78 x
Cont. 0,00
Netz t 0,00
19 12 03 Schrott mit NE-Anteil KC kg 0,00
Rieblich kg 300,00 x
Netz 0,00
J3. Energieeffizienz
3.1 Elektrische Energie
Von der Aufbereitung des Trinkwassers über die Speicherung und Verteilung bis hin zur Versorgung
unserer Kunden wird elektrische Energie für nur alle denkbaren Prozesse benötigt.
GESAMTENERGIEVERBRAUCH 2019
Kraftstoffe Fernwärme
Heizöl 6,33 ,1,82%
6,59%.
Strom
85,26%
Abbildung 8 - Gesamtenergieverbrauch der FWO
In vielen Versorgungsbereichen der FWO muss das Trinkwasser zunächst geodätische
Höhenunterschiede überwinden. Hierfür stehen rund 60 Pumpen zur Verfügung.
h in
Energieverbrauch in Anteil am
Energieträger Energieverbrauch Einheit [kWh] Gesamtverbrauch
Strom 7.129.889 kWh 7.129. 889 85,26%
Heizöl 55.108 l 551. 080 6,59%
Kraftstoffe 49.934 529. 592 6,33%
Fernwärme 152.300 kWh 152. 300 1,82%
Gesamt 8.362.861 100,00%
Tabelle 1.1 Aufstellung der Gesamtenergieverbräuche
Die Energieflüsse im Blick zu haben ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Um die Stromverbrauchs
der elektrischen Betriebsmittel in den einzelnen Bauwerken zu erfassen, wird seit Jahren auf die
Installation von elektronischen Energiezählern gesetzt. Die somit erfassten Daten werden über
unsere Fernwirktechnik zum Leitsystem übertragen und ausgewertet werden.
Serte 213.2 Stromverbrauch 2019
Im Jahr 2019 wurden 7.123 MWh an elektrischer Energie benötigt. Das sind rund 3,2 % weniger als
im besonders trockenen und warmen Jahr 2018.
Gesamtstromverbrauch und
Wasserbezug
18.000 15.642
T3 14.421 14.699 15.078 14.742 14.870 14.920
E: 16.000
3 ST
?E 14.000
Is
äs 12.000
10.000
6.579 6.725 7.068 7.167 7.063 7-357 7.123
3 äAst-Anteile der Wasserversorgung und
Stromverbrauch
Verbundleitung ^™ 1'61%
14,83%
25,30%
Scheßlitzer-Ast
8,97%
Rentweinsdorfer-Ast " nlo°o%
»/<
Maintal-Ast 2,92%
4,47%
Jura-Ast _ °A1%.
• 0,33%
Hofer-Ast
16,84%
6,55%
20,76%
Frankenwald-Ast
6,38%
Coburger-Ast
8,43%
18,90%
Bayreuther-Ast
20,74%
24,19%
Bamberger-Ast
2,39%
14,54%
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%
• Stromanteil [%] • Wasseranteil [%]
Abbildung 11 - Aufteilung der Stromverbräuche und Wasserlieferungen der einzelnen Versorgungsäste
In den Leitungsästen, in denen das Trinkwasser nicht im Freigefälle zum Kunden hin verteilt werden
kann, muss es gepumpt werden. Zum Teil sind hier geodätische Höhenunterschiede von bis zu 300 m
zu überwinden. Moderne Pumpen im Zusammenspiel mit neuster Antriebstechnik sorgen für
Versorgungssicherheit.
3.3 Regenerative Energieerzeugung
Um einen Beitrag zum Umwelt- und Ressourcenschutz zu leisten, setzt die FWO seit nun mehr über
zehn Jahren auf den Ausbau von regenerativen Stromerzeugungsanlagen.
Se/te 23Regenerative Stromerzeugung [kWh/a]
1.514,401
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Abbildung 12 - Darstellung der Gesamtstromerzeugung aus regenerativen Energien
Neun Photovoltaikanlagen und die Energierückgewinnung aus Wasserkraft leisten ihren Anteil zur
regenerativen Stromerzeugung. Alle Anlagen zusammen produzierten bis zum Jahresende 2019
insgesamt 13,3 GWh ökologischen Strom.
Regenerative Stromerzeugung 2019 [kWh/a]
29.805 _ 29.133
49.403
• PV Ruppen Dach
• PWTrainau l
• PV Eichenbühl
• PV Ruppen Carport
27.903.
H EE Zobelberg
• PV Oberrodach
•PVStraßdorf
• PV Rugendorf
• PVTrainau II
• PVScheuerfeld
Abbildung Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im Dokument.13 - Anteile der einzelnen PV-Anlagen an der
gesamten regenerativen Stromerzeugung
Sefte 24Seit dem Jahr 2014 wird der erzeugte Photovoltaikstrom nicht nur in das öffentliche Stromnetz
eingespeist, sondern an fünf Standorten auch direkt zum Eigenverbrauch genutzt.
Eigenverb rauch von Photovoltaikstrom 2019
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0% . ^^^™ . ^^™ _ . ^^^™ _ ^^^
PVOberrodach • PVStraßdorf PVRugendorf PVTrainaull PV Scheuerfeld
• • Netzeinspeisung [%] 21% : 65% 33% 30% : 33%
• Eigenverbrauch [%] : 79% ' 35% 67% 70% 67%
l
Abbildung Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im Dokument.14 - Anteile des Eigenverbrauchs an PV-Strom
\^
[:\
serte25 —~7^@^y/
/A'3.4 Heizöl
In Abbildung 8-11 sind die Aufteilung des Heizölverbrauchs der FWO und die Entwicklung der
Verbrauchsmengen dargestellt. Die prozentuale Aufteilung des Verbrauchs aus dem Jahr 2019
(48.849 Liter) ist in Abbildung 12 ersichtlich.
Der Verbrauch in 2019 ist gegenüber dem Jahr 2018 um 62.590 kWh, das sind 12,81 %, gestiegen.
Der größte Heizölverbraucher bleibt die Heizung in der TWA in Rieblich mit einem Anteil von 78 %.
Bei den Werkswohnungen in Rieblich ist der Heizölverbrauch gegenüber dem Jahr 2018 wieder auf
34.200 kWh angestiegen.
Der Heizölverbrauch für die Notstromaggregate ist von 10.884 l auf 8.660 l wieder gesunken.
Abbildung 15:
Heizölverbrauch Gesamt 2012 - 2019
700.000 -i
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Se/te 26Abbildung 16:
Heizölverbrauch TWA 2012 - 2019
500.000
450.000 -\
400.000 -j
350.000 -|
300.000 -1
£.
i 250.000 -|
c
200.000 -l
150.000 -\
100.000 -l
50.000 -|
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Abbildung 17:
Heizölverbrauch Wohnung 2012 - 2019
40.000 -i
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sefte 27Abbildung 18:
Heizölverbrauch Notstrom 2012 - 2019
200.000 i
180.000 -|
160.000 -]
140.000 -|
120.000 -\
-c
i 100.000 -l
c
80.000 -l
60.000 -|
40.000 -|
20.000 -]
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Umrechnung: l Liter Heizöl (leicht) = 10,00 kWh
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Heizöl
Abbildung 19: Heizölverbrauch 2019 (Prozentuale Aufteilung)
Heizölverbrauch 2019
Gesamtverbrauch = 55.108 Liter (551.080 kWh)
ITWA • Wohnung •Notstrom
Wohnung
6%
Sefte 28
^/
'.^yv.3.5 Fernwärmebezufi
Für das Jahr 2019 wurden an Fernwärme für den Standort Kronach 152.300 kWh von einem
Nachbarbetrieb bezogen (Abbildung 13).
Zur Senkung des Energiebedarfs für das Verwaltungsgebäude in Kronach-Ruppen wurde eine
energetische Sanierung durchgeführt und Ende des Jahres 2014 abgeschlossen. Seitdem stellt sich
der Fernwärmebezug über die letzten Jahre konstant um die 152.000 kWh ein.
Abbildung 20:
RWh Fernwärmebezug 2012 - 2019
250.000
200.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Seite 29Tabelle 9: Treibstoffverbrauch
Treibstoffverbrauch in Liter 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Diesel (Pkw) 43.052,27 43.843,22 52.208,22 50.007,74 50.043,31 43.418,43 46.757,87 48.015,96
Diesel (sonst. Maschinen) 2.073,71 1.367,06 1.549,46 1.332,74 1.946,83 1.302,14 335,42 858,33
Benzin (sonst. Maschinen) 1.327,74 1.265,99 1.895,03 1.334,88 1.816,33 681,32 732,® 793,36
(davon Öko - Mix) -520,00 -595 -789,00 -S04,00 -630,00 -380,00 -MQßB 280,00
Treibgas Gabelstapler KC Propan 66,00 44,00 99,00 22,00 44,00 44,00 66,00 132,00
* Umrechnung 38,28 25,52 57,42 12,76 25,52 25,52 37,88 76,56
Gesamtverbrauch 45.972,00 45.906,79 54.921,13 52.184,12 53.201,99 45.017,41 47.524,02 49.934,21
Dienst-Kfz
mit Diesel betrieben: 19 22 25 26 28 26 27 31
mit Biodiesel betrieben: 0 0 0 0 0 0 0 0
mit Erdgas betrieben: l l l l l l 0 0
mit Strom betrieben: 0 0 0 l l l 2 3
Gesamtzahl Dienst-Kfz 20 23 26 28 30 28 29 34
Gefahrene Kilometer
FWO-Dienstfahrzeuge km 458.895 467.823 569.326 561.659 502.384 469.224,73 488.261,00 498.777,90
Privat-Pkw km 66.790 62.927 59.430 50.274 26.527 315,00 0,00 0,00
Gesamtkilometer km 525.685 530.750 628.756 611.933 528.911 469.540 488.261 498.778
Umrechnungsfa ktor:
* = l kg Propan = 0,58 l
Der zentrale Standort für den Netzbetrieb ist das Betriebs- und Verwaltungsgebäude in Kronach.
Hier beginnen und enden alle Dienstfahrten.
Die Außendienst-, Wartungs-, Instandsetzungs- und sonstigen Arbeiten müssen in einem ca. 7.800
km2 großen Versorgungsgebiet ausgeführt werden, wodurch sich eine sehr hohe jährliche
Gesamtfahrleistung der Dienstfahrzeuge von 498.778 km ergibt.
Die Gesamtzahl der Dienst-Kfz hat sich im Laufe des Jahres 2019 um 3 Fahrzeuge auf 34 erhöht.
Dabei wurde für die kurzen Dienstwege und Behördengänge zusätzlich ein Elektrofahrzeug für den
Standort Rieblich im Jahr 2018 angeschafft.
Der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch des FWO-Dienstfahrzeuges auf 100 km Fahrleistung ist im
Jahr 2019 leicht angestiegen und liegt bei 9,63 l.
Der Dieselverbrauch für Dienst-Pkws ist 2019 um 1.258,09 Liter angestiegen. Dabei wurdert .'.:-iDer Treibstoffverbrauch ist auch weiterhin ein wesentliches Entscheidungskriterium bei der
Neuanschaffung von Dienstfahrzeugen.
Abbildung 21: Treibstoffverbrauch 2019 (Prozentuale Aufteilung)
Treibstoffverbrauch 2019
Gesamt: 49.934,21 Liter
l 99% l
• Diesel (Pkw + sonstige
1%1 Maschinen)
• Benzin (Erdgas Pkw +
sonst. Maschinen)
Se/to 314. Emissionen
Durch die Verwendung fossiler Energieträger z. B. für die Gebäudeheizung (Heizöl), für den Betrieb
von Notstromaggregaten (Heizöl, Diesel), für Betriebsfahrzeuge (Diesel, Benzin) und vor allem durch
den Verbrauch von elektrischer Energie für Pumpen, Heizung, Mess-Steuertechnik usw. wird das
Treibhausgas Kohlendioxid (002) emittiert.
Durch den Umstieg auf 100 % Ökostrom fallen diese C02-Emission nicht mehr an und in der Bilanz ist
ein deutlicher Rückgang zu verbuchen.
Abbildung 22:
COz Bilanz 2012 - 2019
Umrechnungsauellen für COz:
Strom: 6EMIS3.0/UBA99
ab 2017: e.on Bayern 100 % Ökostrom (Energiemix)
Erdgas: UBA2004/FGLBT.2004
Heizäl: UBA 99 / RAVEL 93
Diesel: BUWAL/SR 132 / RAVEL 93
Benzin: UBA 99 / RAVEL 93
Gas (Pkw): FGLBT/UBA2004
/ ,'
Sefte 32Abbildung 23: Aufteilung C02 für 2019
COz - Emission 2019
Gesamt: 2761 COz
<
5. Hilfs- und Betriebsstoffe
Als wesentlicher Massenstrom bei den Einsatzmaterialien ist für den Betrieb der
Fernwassen/ersorgung Oberfranken der Verbrauch an Hilfs- und Betriebsstoffen in der
Trinkwasseraufbereitungsanlage in Rieblich maßgebend.
Die Verbrauchsmengen der notwendigen Aufbereitungschemikalien stehen in direktem
Zusammenhang mit der aufbereiteten Wassermenge.
Die Mengen im Einzelnen sind nachfolgend dargestellt:
Seite 33Tabelle 10: Hilfs- und Betriebsstoffe TWA Rieblich 2012 - 2019
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
into into into in to in to in to in to into
außer außer außer außer außer außer außer außer
*) in l *) in l *) in l *) in l *) in l *) in l *) in l *) in l
Hydrokarbonat
827 876 931 972 864 916 974 946
(Juraperle)
Aluminiumsulfat 78 59 81 83 79 72 83 83
Aktivkohle Hydraffin 3 0 0 0 0 0 0 0
Chlorbleiche 2,3 1,7 2,6 1,2 1,2 1,0 1,1 0,9
Kalkhydrat 137 125 109 130 140 115 109 118
Kaliumpermanganat 4,55 4,275 5,7 5,675 4,5 5,775 6,1 5
Natriumsulfat 0,225 0,15 0,35 0,2 0,25 0,35 0,2 0
Soda 44 37 36 9 18 7 25 26
Salzsäure [techn. 31/33] 0,5 0,4 0,5 0,6 1,2 0,2 0,5 0,2
Salzsäure (rein, DIN
59 63 49 92 66 57 56 28
19610)
Salztablettenfür 11 9 10 11 11 10 13 8
Chlorelektrolyseanlage
Betriebsöle* 268 1.244 1.344 1.296 1.023 1.136 121 277
(KC+Rieblich)
Kohlensäure 460 449 442 457 441 437 470 421
Gesamt in to 1.626,6 1.623,3 1.666,2 1.762,1 1.625,0 1.620,6 1.737,9 1.636,4
Die Mengen der verbrauchten Hilfs- und Betriebsstoffe orientieren sich am Gesamtwasserbezug und
an der Qualität des Rohwassers. Im Vergleich zu den letzten Jahren (ab 2012) sind keine
Besonderheiten erkennbar.
\^£^-- ^i
l ;;' !
Seite 34
\ .'>•' Jul
^ ^-^IL^'W6. Biologische Vielfalt
Tabelle 10: Grundstückskataster 2020
befestigter
Bau-
Grundstücks- befestigte Fläche Anteil
werks- Bauwerke
fläche in m2 Dachfläche Befestigter Gesamtversiegelte in %
Nr.
in m2 Weg in m2 Fläche in m2
BI Rieblich 28.636 7.143 5.836 12.979 45,3%
Werkswohnung
5.122 167 252 419 8,2%
Rieblich
B2 HBTschirn 3.134 79 176 255 8,1%
HB-PW
88.337 132 252 384 0,4%
Steinbach-W.
FB-3 H B Kleintettau 3.648.088 62 48 110 0,0%
B5 HB-PWStraßdorf 6.251 448 936 1.384 22,1 %
FB-7 HB Döbra 2.421 67 40 107 4,4%
B7 HB Bugspitze 5.114 402 547 949 18,6 %
B8-1 PW Viereth 902 87 129 216 23,9 %
B8-2 HB Viereth 902 24 0 24 2,7 %
B9 HB 6.676 59 96 155 2,3%
Tütschengereuth
B10 PW Steinwiesen 525 135 199 334 63,6 %
Bll HBSteinwiesen 3.349 101 249 350 10,5 %
B12 HBKümmlberg 8.119 173 185 358 4,4 %
B13 PWTrainau 4.826 890 702 1.592 33,0%
B14 HB-PW 12.079 324 426 750 6,2 %
Scheuerfeld
B15 HBZobelberg 8.344 130 986 1.116 13,4 %
BIG HB-PW Birkach 3.646 100 65 165 4,5 %
B17 HB Ummersberg 3.711 66 42 108 2,9 %
HB
3.009 52 167 219 7,3 %
Rentweinsdorf
B19 ^B:pw. 2.627 131 354 485 18,5 %
Drosendorf
HB-PW
3.703 404 326 730 19,7 %
B21 HBGorkum 2.477 82 42 124 5,0%
B22 HB:PW„ 6.019 1.130 129 1.259 20,9%
Rugendorf
B23 H B Bayreuth 42.787 80 61 141 0,3%
B24 HBGörau 2.671 12 0 12 0,4 %
B25 HBWatzendorf 1.000 40 22 62 6,2 %
B26 PW Oberrodach 3.616 155 73 228 6,3 %
B27 HB-PWPödeldorf 5.637 173 16 189 3,4%
B28 HB-PW. 3.753 196 136 332 8,8 %
Hüttendorf
B29 PW Buchenrod 124 13 13 26 21,0 %
B30 Fwo-. 7.695 1.804 1.202 3.006 39,1 %
Betriebsgebäude
Se/te 35 'mB31 PWStrullendorf 1.186 119 152 271 22,8 %
B32 PW Crottendorf 4.769 33 5 38 0,8%
B33 PW See 625 65 90 155 24,8 %
B34 PW Kleinwaldbur 19.990 36 50 86 0,4 %
B35 H B Effelter 440.592 43 14 57 0,0 %
B36 HB Lauenhain 1.112 18 6 24 2,2%
B37 PW Reichenbach 3.064 23 404 427 13,9 %
B38 HB Kehlbach 1.498.200 24 0 24 0,0 %
B39 HBBuchbach 592 24 5 29 4,9 %
Durch die Errichtung von Bauwerken und Schächten mit zugehörigen Pflaster- und Asphaltflächen
liegt die Flächenversiegelung bei 31.919 m2. Diese Fläche teilt sich auf in Bauwerke mit 29.679 m2
und Schächte mit ca. 2.240 m2.
Bei den Bauwerken Hochbehälter (HB) Kleintettau und HB Kehlbach liegt der Standort in der
Grundstücksfläche der Bayrischen Staatsforsten, dadurch ist die große Grundstücksfläche begründet.
Bisherige Werte bezogen sich auf geschätzte Hochrechnungen und fielen in der Vergangenheit höher
aus. Im Rahmen des kontinuierlichen Verbesserungsprozess wurden die Daten explizit erfasst.
Beim Rohrleitungsbau werden Flächeneingriffe nach Ende der Baumaßnahme wieder in den
ursprünglichen Zustand versetzt. Bei notwendigen Rodungsmaßnahmen im Waldbestand wird die
Baufeldbreite auf ein Mindestmaß reduziert.
Daneben leistet die Fernwasserversorgung Oberfranken auch einen Beitrag zum biologischen
Artenschutz. Viele Bauwerksgrundstücke sind mit standortgerechten Gehölzen und Bäumen
bepflanzt worden.
Im Netzbetrieb sowie an weiteren Standorten sind Nist- und Unterschlupfmöglichkeiten für Singvögel
und Fledermäuse geschaffen worden.
/; /
/',.• ^-
-^
[U ^7 ^
Seite 36 Awy^
v^
/ v^Diagrai nm zurr Gn ind: itüc cskatasl er 2 020
l
HB Buchbach
HB Kehlbach
PW Reichenbach
HB Lauenhain
H B Effelter
PW Kleinwaldbur
PW See
PW Crottendorf
PWStrullendorf
FWO-Betriebsgebäude
PW Buchenrod
HB-PW Hüttendorf
HB-PW Pödeldorf
PW Oberrodach
HB Watzendorf
HBGörau
HB Bayreuth
HB-PW Rugendorf
HB Gorkum
HB-PW Giechburg
HB-PW Drosendorf
HB Rentweinsdorf
HB Ummersberg
HB-PW Birkach
HB Zobelberg
HB-PWScheuerfeld
PWTrainau
HB Kümmlberg
HBSteinwiesen
PW Steinwiesen
HBTütschengereuth
H B Viereth
PW Viereth
H B Bugspitze
HB Döbra
HB-PWStraßdorf
HB Kleintettau
HB-PW Steinbach-W.
HBTschirn
Werkswohnung Rieblich
Rieblich
% 7( % 8( % 9( % 10 )%
0 S K % 2( % 3( % 4( % 5( % 60%
•D; :hfläch •B< festigte -Weg Fläche
• Grünfläche
Seite 37
-;';:i"EM»7. Kennzahlen für Kernindikatoren
Die Auswertung zeigt grundsätzlich, dass der überwiegende Anteil der Umweltkennzahlen stark
durch die abgegebene Trinkwassermenge beeinflusst wird.
Tabelle 11: Kennzahlen für Kernindikatoren 2012 - 2019
Mio m3/a l Kernindikator - Wasser!
1/1 1,06
BEgg Bi - 1,06
1,05
- 1,05
'^ ./
- 1,04
- 1,03
- 1,03
14,0 1,02
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
^« Wasserbezug Wasserbezug / Liefermenge
Kernindikator - Abwasser
0,04
200.000
100.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
^N Abwassermenge Abwassermenge / Liefermenge
Se/fe 38Kernindikator - gefährliche Abfälle kg /1.000 m3
kg/a
20.000
1,0
15.000
10.000
h 0,5
5.000
0,0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Menge gefährliche Abfälle Verbrauch Menge gefährliche Abfälle / Wasserliefermenge
kWh/a Kernindikator - Stromeffizienz kWh /1.000 m3
10.000.000 600
500
r- 400
5.000.000 300
- 200
100
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Gesamtstromverbrauch •Gesamtstromverbrauch / Wasserliefermenge
Sefte 39t C02/a Kernindikator - Emissionen t COz/1.000 m3
0,120
h 0,100
h 0,080
0,060
- 0,040
- 0,020
0,000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
^«C02 Emmissionen Gesamtemissionen / Wasserliefermenge
t/a Kernindikator - Materialeinsatz t ,1.000 m3
2.000 0,125
1.900
1.800
1.700 +
1.600
1.500
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
^« Verbrauchsstoffe Gesamtverbrauch / Liefermenge
Serte 40m' Kernindikator - Biologische Vielfalt m2 ,1.000 m3
50.000
40.000
30.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
^« überbaute Fläche —überbaute Fläche/ Liefermenge
\
-.. \
Se/te 4lFWO - Umweltprogramm 2019 - 2022:
l. Umweltproaramm TWA Rieblich:
Ziel: Publikation der Öffentlichkeitsarbeit
Maßnahmen: Fortführung des Projektes Wasserschule im Eingangsbereich der
Trinkwasseraufbereitungsanlage Rieblich; Darstellung des
Wasserkreislaufes und Informationen zur Fernwasserversorgung
Oberfranken
Termin: 2019-2022
Termin realisiert am:
Verantwortung: WL,ALII/1
Status in %: 50% | — ] | | ] 100%
Bemerkung: Pandemiebedingt wurden die Führungen in der TWA ausgesetzt. Ansonsten
werden zahlreiche Schulklassen mit insgesamt bis zu 1.000 Schülerinnen
und Schülern pro Jahr aus dem Verbandsgebiet anschaulich und interaktiv
über den Wasserkreislauf informiert.
Ziel: Erhöhung Notfall- und Gefahrenabwehr
Maßnahmen: Aufschaltung des Alarmes auf die Leitstelle
Termin: 2020
Termin realisiert am: Nicht realisierbar
Verantwortung: SG 11/3.2
Status in %: 50% l l l l l 100%
Bemerkung: Ein direktes Aufschalten des Alarms auf die Integrierter Leitstelle (ILS) ist
nicht möglich.
Ziel: Reduzierung des Strom-/ Energieverbrauchs
Maßnahmen: Pumpenerneuerung am Standort PW Rieblich
Termin: 2019 - 2022
Termin realisiert am:
Verantwortung: BL, AL 11/3, SG 11/3.1
Status in %: 50% l | | t | 100%
Bemerkung: Es wurden 3 Pumpen erneuert.
Berechnete Einsparung voraussichtlich ca. 63.420 kwh/Jahr.
\ -:- \
\Vi
[A-.L^;!s]
Seite 42 ^Ziel: Reduzierung des Strom-/ Energieverbrauchs
Maßnahmen: Erneuerung von Beleuchtungsanlagen an derTWA Rieblich
Termin: 2019 - 2022
Termin realisiert am:
Verantwortung: BL, AL 11/3, SG 11/3.1
Status in %: SO % l l l l l 100%
Bemerkung: Bei 120 LEDs beträgt die Einsparung voraussichtlich ca. 8.400 kwh/Jahr.
125 Stück werden insgesamt ausgetauscht.
Ziel: Verbesserung des Gewässerschutzes
Maßnahmen: Erneuerung des Wasserrechtes in der TWA Rieblich:
l.) Erneuerung des Olabscheider
2.) Erneuerung der Kleinkläranlage
3.) Regenwasserbehandlung der Dachflächen
Termin: 2019 - 2022
Termin realisiert am:
Verantwortung: BL, AL 11/1, SG 11/2.1
Status in %: 50% l l l l | 100%
Bemerkung: Antrag für beschränkte Erlaubnis zum Prozesswasser liegt dem Amt
zur Bescheidungvor.
Für die Beantragung einer gehobenen Erlaubnis werden derzeit die
Planungen für die Punkte 1-3 mit dem Ingenieurbüro
ausgearbeitet.
Ziel: Optimierung IT-Sicherheit
Maßnahmen: Erneuerung der Leitwarte
Termin: 2019 - 2022
Termin realisiert am:
Verantwortung: BL, AL 11/1, AL 11/3
Status in %: 50% l l l l | 100%
Bemerkung: Baumaßnahmen haben begonnen und Fertigstellung ist für Ende
2020 geplant.
Se/te 432. Umweltprogramm Netz:
Ziel: Reduzierung des Strom-/ Energieverbrauchs im Netzbetrieb
Maßnahmen: Pumpenerneuerung am Standort Straßdorf
Termin: 2020
Termin realisiert am:
Verantwortung: B L, AL 11/3, SG 11/2.2
Status in %: 50% l l l l | 100%
Bemerkung: Voraussichtlich keine Einsparung durch die Installation von 2 redundanten
Pumpen, allerdings Erhöhung der Versorgungssicherheit.
Pumpe ist bestellt und wird im November 2020 eingebaut.
Ziel: Reduzierung des Strom-/ Energieverbrauchs im Netzbetrieb
Maßnahmen: Pumpenerneuerung am Standort Trainau
Termin: 2020
Termin realisiert am:
Verantwortung: BL, AL 11/3, SG 11/2.2
Status in %: 50% 100%
Bemerkung: Voraussichtlich keine Einsparung durch die Installation von 2 redundanten
Pumpen, allerdings Erhöhung derVersorgungssicherheit.
Pumpe ist bestellt und wird im November 2020 eingebaut.
Ziel: Gewährleistung der Versorgungssicherheit
Maßnahmen: Neubau des Hochbehälters Rötelsberg
Termin: 2019 - 2022
Termin realisiert am:
Verantwortung: B L, AL 11/3, SG 11/2.1, SG 11/2.2
Status in %: 50% l l l l l 100%
Bemerkung: Der Neubau wurde Anfang 2020 begonnen.
Fertigstellung für 2024 geplant.
Ziel: Erhöhung der Arbeitssicherheit an Schachtbauwerken
Maßnahmen: Weitere Einbau von Wasserzähler mit Fernauslesung
Termin: 2019-2022
Termin realisiert am:
Termin realisiert am:
Verantwortung: AL 11/3, SG 11/2.2
Status in %: 50% l l l l l 100%
Bemerkung: Im Jahr 2019 sind noch weitere 120 Wasserzähler mit Fernauslesung
installiert worden. Der kontinuierliche Ausbau wird weiterhin angestrebt.
^>\
x-%
Sefte 44
^s.Ziel: Durchgehende EDV-Anlage zur Wartung und Prüfung von Anlagen
Maßnahmen: Das eingeführte Wartungstool „Waldwasser" soll sukzessive weise im
laufenden Betrieb gepflegt und angewandt werden.
Termin: 2019 - 2022
Termin realisiert am:
Verantwortung: B L, AL 11/3
Status in %: 50% | ~ | | ] 100 %
Bemerkung: Das Wartungstool Waldwasser ist eingeführt worden. Die Prüfungen
werden sukzessive weise eingepflegt. Die verschiedenen Abteilungen sollen
für das Jahr 2020 das Programm im laufenden Betrieb testen.
Ziel: Einführung einer vorbeugende Instandhaltung des Netzes
Maßnahmen: Prüfung des Rohrnetzsystems auf zusätzliche Installation von
Betriebswasserzählern.
Termin: 2019 - 2022
Termin realisiert am:
Verantwortung: BL,ALII/3, SG 11/2.2
Status in %: 50% 100%
Bemerkung: Aktuell erfolgt die Prüfung, ob zusätzlich zu den Hochbehältern auch die
Installation in diversen Schächten sinnvoll ist.
Se/fe 453. Umweltprogramm FWO - qesamt
Ziel: Gewährleistung der Versorgungssicherheit
Maßnahmen: Erstellung einer Studie zum Ringschluss des BA-Bayreuther und Scheßlitzer
Astes
Termin: 2019-2022
Termin realisiert am: 12/2019
Verantwortung: WL,BL
Status in %: 50% 11111 100%
Bemerkung: Die Studie zum Ringschluss liegt der FWO vor. Derzeit werden die
Ingenieurleistungen ausgeschrieben.
Ziel: Gewährleistung der Versorgungssicherheit
Maßnahmen: Erhöhung der Speicherkapazität im südl. Versorgungsgebiet
Termin: 2019 - 2022
Termin realisiert am:
Verantwortung: WL, BL, AL 11/3, SG 11/2.1, SG 11/2.2
Status in %: 50% l l l l | 100%
Bemerkung: Ingenieurbüro ist beauftragt und es läuft eine Untersuchungsstudie mit
dem Ziel einen geeigneten Standort mit entsprechender Behältergröße zu
finden.
Ziel: Weiterführung Öffentlichkeitsarbeit „Trinkwasser ist auch zum Trinken
da"
Maßnahmen: Bereitstellung von ca. 3 bis 5 Wasserspendern an Schulen
Termin: 2019-2022
Termin realisiert am:
Verantwortung: WL, SG 11/2.2
Status in %: 50% ||||| 100%
Bemerkung: Entsprechend dem seitens derVerbandsversammlung beschlossenen
jährlichen Budget i.H. v. bis zu 25.000 € werden regional verteilt weiterhin
Wasserspender in den Schulen installiert.
Derzeit sind ca. 50 Wasserspender im Einsatz.
/\.:^
:^
^
l -^
Seite 46 ~7^7^<Ziel: Regenerative Stromerzeugung
Maßnahmen: Errichtung einer PV Anlage am Hochbehälter Kehlbachsberg
Termin: 2019-2022
Termin realisiert am:
Verantwortung: B L, AL 11/3
Status in %: ^^M [ l | 50% | | | | | 100%
Bemerkung: PV-Fläche ca. 60 m2
Durchschnittliche Stromerzeugung ca. 140 kWh/m2
Voraussichtliche Einsparung ca. 8.400 kWh/Jahr
Erst, wenn der Behälter fertig gebaut ist, kann mit der Errichtung der PV
Anlage begonnen werden. Voraussichtliche Inbetriebnahme geplant im
Jahr 2022.
Ziel: Anschlussvertrag für Ökostrom
Maßnahmen: Vertragsprüfung
Termin: 2019 - 2022
Termin realisiert am: 11/2019
Verantwortung: WL, SG 1/1
Status in %:
Bemerkung: Im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung wurde der Strombezug für
die Jahre 2020 - 2022 ausgeschrieben. Der Stromliefervertrag über 100 %
Strom aus erneuerbaren Energien wurde am 25.11.2019 unterzeichnet.
Sorte 47Weitere über das Umweltprogramm 2019 - 2022 hinausgehende Maßnahmen
Ziel: Vorbeugende Instandhaltung von bestehenden Anlagen
Maßnahmen: Optimierung der Turbine am Standort des Hochbehälters Zobelberg
Termin: 2020-2022
Termin realisiert am:
Verantwortung: AL 11/3
Status in %: 50% l l l l l 100%
Bemerkung: Im Zuge des Umbaus des Hochbehälters soll die Turbine hinsichtlich der
Energieeffizient überprüft und optimiert werden.
Seite 48
/Erklärung des Umweltgutachters zu den
Begutachtungs- und Validierungstätigkeiten
Die Unterzeichner, Dr. Axel Romanus, EMAS-Umweltgutachter, mit der
Registrierungsnummer DE-V-0175, akkreditiert oder zugelassen für den Bereich 36 (NACE-
Code) und Dr. Hans-Josef Dünnwald, EMAS-Umweltgutachter mit der
Registrierungsnummer DE-V-0257, bestätigen, begutachtet zu haben, dass die Standorte
der gesamten Organisation, wie in der Umwelterklärung der Fernwasserversorgung
Oberfranken mit der Registrierungsnummer D-106-00039 angegeben, alle Anforderungen
der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009, in Verbindung mit derÄnderungsversordnung 2010-
2016 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 über die
freiwillige Teilnahme von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für
Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung (EMAS) zu erfüllen.
Mit der Unterzeichnung dieser Erklärung wird bestätigt, dass
• die Begutachtung und die Validierung in voller Übereinstimmung
mit den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 durchgeführt wurden,
• das Ergebnis der Begutachtung und Validierung bestätigt,
dass keine Belege für die Nichteinhaltung der geltenden Umweltvorschriften
vorliegen,
• die Daten und Angaben der Umwelterklärung ein verlässliches, glaubhaftes,
wahrheitsgetreues Bild sämtlicher Tätigkeiten der Organisation innerhalb des in der
Umweltklärung angegebenen Bereichs geben.
Diese Erklärung kann nicht mit einer EMAS-Registrierung gleichgesetzt werden. Die
EMAS-Registrierung kann nur durch eine zuständige Stelle gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 1221/2009 erfolgen. Diese Erklärung darf nicht als eigenständige Grundlage für die
Unterrichtung der Öffentlichkeit verwendet werden.
' /,
Kronach, .c.^.... /^-ü^^ch, ....l^.AD:..^.^
//y^ ^^3
-^--y ^C^/^ 6?^
^vk^—--0^
Unterschrift ^-^!^^fiterschrift
Dr. Hans-Josef-Dünnwald Dr. Axel Romanus
Umweltgutachter Umweltgutachter
Herbert-Lew-Str. 4 Preetzer Straße 75
50931 Köln 24143 Kiel
Zul.Nr. DE-V-0257 Zul.Nr. DE-V-0175
Se/te 49Sie können auch lesen