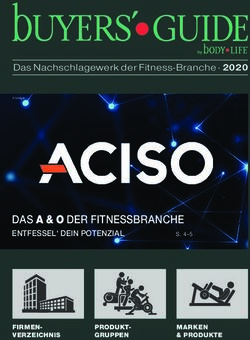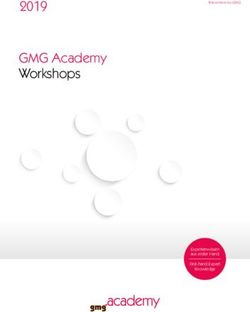MUSKELKATALOG BODYWEIGHT-TRAINING - Q-Fitness Academy Stand: 19.07.17
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
BODYWEIGHT-TRAINING MUSKELKATALOG MODULE BAS-ANO/ANU Q-Fitness Academy Stand: 19.07.17 © Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 1
Inhaltsverzeichnis GRUNDHALTUNGEN / AUSGANGSPOSITIONEN 5 ZU 1. AUFRECHTER STAND 6 ZU 2. STAND IM AUSFALLSCHRITT / LUNGE-POSITITION (SPRICH: "LANSCH"-POSITION) 7 ZU 3. KNIESTAND 7 ZU 4. 4-PUNKT STAND 7 ZU 5. BAUCHLAGE 7 ZU 6. RÜCKENLAGE 7 OBERKÖRPER – SCHULTERGELENKSMUSKULATUR 8 M. DELTOIDEUS PARS CLAVICULARIS (VORDERER ANTEIL) 8 M. DELTOIDEUS PARS ACROMIALIS (MITTLERER ANTEIL) 10 M. DELTOIDEUS PARS SPINALIS (HINTERER ANTEIL) 12 ROTATORENMANSCHETTE 14 M. SERRATUS ANTERIOR 16 OBERKÖRPER BRUSTMUSKULATUR M. PECTORALIS MAJOR 17 OBERKÖRPER - ARMMUSKULATUR 20 M. BICEPS BRACHII 20 M. TRICEPS BRACHII 22 RÜCKEN - M. LATISSIMUS DORSI 25 OBERKÖRPER – OBERER RÜCKEN 30 M. TRAPEZIUS PARS DESCENDENS 30 M. TRAPEZIUS PARS TRANSVERSA 31 M. TRAPEZIUS PARS ASCENDENS 33 MM. RHOMBOIDEI MAJOR/ MINOR 34 OBERKÖRPER - RÜCKENSTRECKER M. ERECTOR SPINAE 36 RUMPFMUSKULATUR 40 M. TRANSVERSUS ABDOMINIS 40 M. RECTUS ABDOMINIS 42 M. OBLIQUUS EXTERNUS ABDOMINIS 46 M. OBLIQUUS INTERNUS ABDOMINIS 48 UNTERKÖRPER – HÜFTGELENKSMUSKULATUR 52 M. GLUTEUS MAXIMUS 52 M. ILIOPSOAS 55 MM. ADDUCTORES 57 MM. ABDUCTORES 59 UNTERKÖRPER ROTATORENMANSCHETTE, SCHWERPUNKT M. PIRIFORMIS 61 UNTERKÖRPER BEINMUSKULATUR 63 M. QUADRICEPS FEMORIS 63 ISCHIOCRURALE GRUPPE 65 M. GASTROCNEMIUS 68 M. SOLEUS 70 M. TIBIALIS ANTERIOR 72 © Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 2
Die Professionelle Übungsanleitung
Die Einweisung folgt idealerweise immer einem bestimmten Muster:
1. Vorinstruktion
a. Worum geht es bei der folgenden Übung?
i. Mobilisation, Stabilisation, Koordination?
ii. Kraft, Kraftausdauer, Ausdauer?
iii. Wahrnehmung / Propriozeption / Präzision?
b. Welche Muskeln oder Systeme sind beteiligt?
i. Muskelisolation
ii. Muskelschlinge / -kette
iii. neuronales System?
c. Worauf ist besonders zu achten?
i. Haltung?
ii. Bewegung?
iii. Atmung?
2. Demonstration
a. Ausgangsposition und -haltung
i. Ausrichtung der Füße, der Knie und der Hüfte
ii. Stabilisierung des Rumpfes / Core / Rücken
iii. Ausrichtung von BWS, Schultergürtel und HWS / Kopf
b. Bewegungsausführung bzw. Stabilisationsaufgabe
i. Anfangspunkt
ii. Bewegungsablauf (Ebenen, Achsen, Richtungen)
(bei statischen Übungen: welche Bereiche des Körpers sollen besonders
stabil gehalten werden?)
iii. Endpunkt
c. Atmung während der Übungsausführung
3. Instruktion
Der Teilnehmer führt die Übung selbst aus, der Trainer beobachtet Haltung, Bewegung
und Atmung. Korrekturen erfolgen nun auf den drei Wahrnehmungsebenen:
a. Visuell
Dem Teilnehmer wenn möglich parallel zur Übungsausführung zeigen worauf er
besonders achten sollte.
b. Auditiv
Verbal Korrigieren, dabei immer positiv formulieren! Negationen können visuell
nicht verarbeitet werden
c. Taktil
Führe den Klienten durch geschicktes Handling in die richtige Position.
© Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 3Beachte bei der taktilen Korrektur: Druck erzeugt immer Gegendruck. Wenn ich versuche, ein
Gelenk durch Druck neu auszurichten, erreiche ich genau die falsche (weil entgegengesetzte)
Ansteuerung im Körper. Besser ist es, den Klienten selbst die korrekte Haltung einnehmen zu
lassen, in dem ich Zielpunkte vorgebe, die taktil zu erreichen sind ("Drücke gegen meine Hand"
/ "Führe Deinen Rücken zu meiner Hand")
Wenn die Instruktion nicht zum gewünschten Ziel führt werden die drei Punkte neu
durchlaufen mit dem Fokus auf der Fehlerkorrektur:
1. erneute Vorinstruktion
Was waren die Hauptfehler, woran lag es? Wie kann es korrigiert werden?
2. Demonstration
Hier kann jetzt gezeigt werden, was bei der falschen Haltung oder Übungsausführung
geschieht und - der wichtigste Part - wie man aus der falschen Variante in die Richtige
kommt! (vom bekannten zum unbekannten)
3. Instruktion
Auf der Basis neu gewonnener Informationen (visuell, auditiv, taktil) wird ein neuer
Versuch unternommen, die Übung korrekt auszuführen.
Gute Formulierungen in der Trainingsanleitung
Vermeide Verwende stattdessen:
Die Knie sind geknickt Die Knie sind (leicht) gebeugt
"nicht durchdrücken" immer leicht gebeugt halten, auch im
Endpunkt
Die Knie dürfen nicht über die Fußspitze Die Knie bleiben immer über der Ferse bzw.
gehen über der Fußmitte
Kniebeuge: Kniebeuge:
Beuge die Knie Schiebe das Gesäß weit nach hinten aus der
Hüfte heraus
Spanne den Bauch an Ziehe die Bauchdecke nach innen (oben),
halte das Becken / den Rücken dabei stabil
Halte den Rücken gerade Formuliere präzise!
gerade = abgeflacht / ent-lordosiert?
gerade = natürliche Krümmung?
Nicht die Luft anhalten Ruhig weiteratmen während der
Übungsausführung
© Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 4Grundhaltungen / Ausgangspositionen
Wir unterscheiden verschiedene Grundpositionen:
1. Aufrechter Stand
a. Füße hüftbreit geöffnet
b. Füße schulterbreit geöffnet
c. Füße mehr als schulterbreit geöffnet
2. Stand im Ausfallschritt / Lunge-Positition (sprich: "lansch"-Position)
3. Kniestand
a. auf einem Knie
b. auf beiden Knien
4. Vierfüßler-Stand / 4-Punkt-Stand
5. Bauchlage
6. Rückenlage
Für jeden Körperabschnitt gibt es spezifische Anweisungen, die sich oft wiederholen.
Diese solltest Du auswendig kennen und können. Je nach Kursformat / Übung /
Koordinationsfähigkeit Deines Klienten ergeben sich Abwandlungen.
Körperbereich Anweisung Anmerkungen
Füße 3-Punkt-Belastung: Fußgewölbe angehoben / aktiviert
Großzehballen,
Kleinzehballen, Ferse
Knie (im Stand) "leicht gebeugt"
"locker gestreckt"
"Kniescheibe aktiv nach Aktivierung des M. Quadrizeps und
oben ziehen" damit Entlastung des Gelenks
Hüfte und ISG*1 Zur "Öffnung" der ISG- Das hat nur leider oft zur Folge, dass
Gelenke die Oberschenkel Knie und / oder Füße nicht mehr richtig
leicht nach innen zu stehen. Es erfordert daher insgesamt
rotieren. ein sehr präzises Alignment2 (A-Lizenz
und PT)
ISG in Bauchlage "Fersen nach außen fallen dadurch werden die ISG-Gelenke
lassen" "geöffnet"
Becken "Becken aufrichten" wirkt einer Hyperlordose (Hohlkreuz)
Schambein nach oben entgegen. Die Kraft für die
ziehen Beckenaufrichtung kommt aus Bauch
Steißbein sinken lassen (M. rectus abdominis), Beckenboden
und Gesäß (M. Gluteus maximus)
Lendenwirbelsäule Becken aufrichten, Vor allem wichtig für Klienten mit
(LWS) Lendenwirbelsäule "Hohlkreuz", wird oft bei Übungen in
abflachen Rückenlage verwendet.
1 ISG = Ilio-sakral-gelenk, die gelenkhafte Verbindung der beiden Hüftknochen mit dem Sacrum, dem Endstück der Wirbelsäule
2 Alignment (engl) = korrekte Ausrichtung der Gelenke
© Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 5Lendenwirbelsäule "leichtes Hohlkreuz - Bei manchen Übungen bewirkt eine
(LWS) gleichzeitig aber den leichte Verstärkung der natürlichen
Bauchnabel nach innen Lordose (ugs. Hohlkreuz) eine höhere
oben ziehen Aktivierung und damit Sicherung der
Wirbelsäule durch die umliegende
Muskulatur
Bauch Bauchnabel nach innen Stützt und stabilisiert die
oben ziehen Lendenwirbelsäule (auch in
Fehlpositionen! - aber wenigstens ist
dann trotzdem gesichert)
Diese Anweisung muss immer
erfolgen!
Brustwirbelsäule Brustbein nach schräg ohne dabei ins Hohlkreuz zu gehen!
(BWS) vorne oben heben Durch das Heben des Brustbeins wird
der Schultergürtel in eine bessere
Position gebracht.
Schultergürtel Schulterblätter nach unten Wenn die Haltung von den Füßen aus
gleiten lassen nach oben hin korrekt eingerichtet
Schlüsselbeine öffnen und wurde und keine muskulären
zur Seite ziehen Dysbalancen vorliegen (also fast nie),
ist diese Anweisung nicht mehr
notwendig.
Halswirbelsäule "Scheitel nach oben ziehen Halswirbelsäule strecken
(HWS) / Kopf "
"Kinn nach innen ziehen /
Doppelkinn"
"Kopf in Verlängerung der Axiale Ausrichtung der gesamten
Wirbelsäule" Wirbelsäule
zu 1. Aufrechter Stand
Körperbereich Anweisung
Füße parallel
"5 vor 1" - leicht außenrotiert
Knie leicht gebeugt
Core (LWS / Abs) Becken leicht aufgerichtet
Rücken flach oder
natürliche Krümmung
Bauchnabel nach innen oben ziehen
BWS Brustbein gehoben
Schultergürtel Schultern tief
HWS / Kopf "Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule"
"leichtes Doppelkinn"
© Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 6zu 2. Stand im Ausfallschritt / Lunge-Positition (sprich: "lansch"-Position)
Füße Ausfallschritt, Füße hüftweit, parallel
Knie vorderes Knie leicht gebeugt, hinteres Bein gestreckt.
Core (LWS / Abs) Becken leicht aufgerichtet
Rücken flach oder natürliche Krümmung
Bauchnabel nach innen oben ziehen
BWS Brustbein gehoben, Oberkörper leicht in Vorlage
Schultergürtel / Arme Abstützen auf dem vorderen Bein!
HWS / Kopf "Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule"
zu 3. Kniestand
Füße Vorderer Fuß aufgestellt
Knie Hinteres Knie abgelegt.
Core (LWS / Abs) Becken leicht aufgerichtet
Rücken flach oder natürliche Krümmung
Bauchnabel nach innen oben ziehen
BWS Brustbein gehoben, Oberkörper aufgerichtet
Schultergürtel Schultern tief
HWS / Kopf "Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule"
zu 4. 4-Punkt Stand
Füße parallel
Knie hüftweit geöffnet unter dem Becken
Core (LWS / Abs) Becken leicht aufgerichtet
Rücken flach oder natürliche Krümmung
Bauchnabel nach innen oben ziehen
BWS Brustbein gehoben
Schultergürtel Schultern tief, Schulterblätter zusammen
HWS / Kopf "Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule"
zu 5. Bauchlage
Füße Fußspitzen aufgestellt, oder Fersen locker nach außen fallen
lassen
Core (LWS / Abs) Becken aufrichten ("Po anspannen")
Rücken abflachen oder natürliche Krümmung
Bauchnabel nach innen oben ziehen
Schultergürtel Schultern nach hinten unten ziehen, Schulterblätter
zusammen
HWS / Kopf "Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule"
zu 6. Rückenlage
Füße hüftweit aufgestellt
Core (LWS / Abs) Rücken flach oder natürliche Krümmung
Bauchnabel nach innen oben ziehen
HWS / Kopf "Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule"
© Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 7Oberkörper – Schultergelenksmuskulatur
M. deltoideus pars clavicularis (vorderer Anteil)
Ursprung: Schlüsselbein
Ansatz: Außenseite des Oberarms
Verlauf: eingelenkig, über das Schultergelenk
siehe Sport Anatomie S. 130
3
Gelenk/ Verbindung Aktion Synergist Antagonist
Schulterblatt / Anteversion des M. pectoralis major M. latissimus dorsi
Oberarm Armes M. biceps brachii M. deltoideus pars
spinalis
Schulterblatt / Innenrotation des M. latissimus dorsi M. deltoideus pars
Oberarm Armes M. pectoralis major acrominalis
Schulterblatt / Abduktion des Armes M. deltoideus spinalis M. pectoralis major
Oberarm M. biceps brachii M. latissimus dorsi
(Caput longum)
Schulterblatt / Adduktion des Armes M. pectoralis major M. deltoideus pars
Oberarm M. latissimus dorsi acrominalis
M. deltoideus spinalis M. biceps brachii
M. biceps brachii
Anmerkungen:
• Zusammen mit den Anteilen pars spinalis und acrominalis bildet dieser Muskel eine
Manschette.
• Sie stabilisieren das Schultergelenk.
3 Quelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Arm_muscles_front_superficial.png (gemeinfrei)
© Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 8Kräftigung: Dehnung: © Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 9
M. deltoideus pars acromialis (mittlerer Anteil)
Ursprung: Akromion
Ansatz: Außenseite des Oberarms
Verlauf: eingelenkig, über das Schultergelenk
siehe Sport Anatomie S. 130
4
Gelenk/ Verbindung Aktion Synergist Antagonist
Schulterblatt Abduktion des M. deltoideus pars M. pectoralis major
(Schulterhöhe = Armes clavicularis und pars M. latissimus dorsi
Acromion) / spinalis
Oberarm M. biceps brachii
(Caput longum)
Schulterblatt / Rotation des Armes M. deltoideus pars M. deltoideus pars
Oberarm (innen / außen) clavicularis und pars clavicularis und pars
spinalis spinalis
Anmerkungen:
• Zusammen mit den Anteilen pars clavicularis und acrominalis bilden die drei Muskeln
eine Manschette, um das Schultergelenk.
• Sie stabilisieren das Schultergelenk.
4 Quelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Arm_muscles_front_superficial.png (gemeinfrei)
© Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 10Kräftigung: Dehnung: © Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 11
M. deltoideus pars spinalis (hinterer Anteil)
Ursprung: Schulterblattgräte
Ansatz: Oberarm
Verlauf: eingelenkig, über das Schultergelenk
siehe Sport Anatomie S. 130
Gelenk/ Verbindung Aktion Synergist Antagonist
Schulter Retroversion des M. latissimus dorsi M. pectoralis major
Armes M. triceps brachii M. deltoideus
(Caput longum) clavicularis
M. pectoralis major M. biceps brachii
(nur aus der
Elevationsstellung)
Schulter Außenrotation des Rotatorenmanschette M. latissimus dorsi
Armes M. pectoralis major
Schulter Adduktion des M. latissimus dorsi M. deltoideus
Armes M. deltoideus pars acrominalis
clavicularis M. biceps brachii
M. triceps brachii (Caput longum)
(Caput longum)
Schulter Abduktion des M. deltoideus M. pectoralis major
Armes clavicularis M. latissimus dorsi
M. biceps brachii M. biceps brachii
(Caput longum) (Caput breve)
Anmerkungen:
© Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 12Kräftigung: Dehnung: © Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 13
Rotatorenmanschette
M. supraspinatus, M. infraspinatus, M. teres minor und major, M. subscapularis
Ursprung: Schulterblatt
Ansatz: Oberarmknochen
siehe Sport Anatomie S. 138
5
Gelenk/ Verbindung Aktion Synergist Antagonist
Schulterblatt mit Innenrotation des M. pectoralis major Rotatorenmanschette
Oberarm Armes M. latissimus dorsi M. deltoideus spinalis
M. deltoideus M. biceps brachii (Caput
clavicularis longum)
Schulterblatt mit Außenrotation des M. teres minor M. subscapularis
Oberarm Armes M. deltoideus M. pectoralis major
spinalis M. deltoideus
M. biceps brachii clavicularis
(Caput longum) M. latissimus dorsi
M. teres major
Schulterblatt mit Sicherung des M. infraspinatus M. deltoideus
Oberarm Humeruskopfes M. teres minor
gegen abgleiten M. teres major
nach kranial M. subscapularis
M. latissimus dorsi
M. pectoralis major
Anmerkungen:
• Die Muskelgruppe der Rotatorenmanschette ist essentiell wichtig für die Sicherung und
Stabilität des Schultergelenks, das daher wichtig ist, da das Schultergelenk an sich eines
der beweglichsten ist.
• Zudem ist das Schultergelenk bzw. die Muskeln durch eine Faszie „ fascia brachii“
umgeben, die den Arm zusätzlich sichert und unterstützt.
5https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Teres-minor.png
© Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 14Kräftigung: Dehnung: © Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 15
M. serratus anterior
Ursprung: 1.-9 Rippe in einem Bogen unterhalb der
Achselhöhle entspringend
Ansatz: Schulterblatt
Verlauf: mehrgelenkig
siehe Sport Anatomie S. 128
Gelenk/ Verbindung Aktion Synergist Antagonist
Schulterblatt mit Fixierung des M. pectoralis major M. trapezius
Rippen Schulterblatts am M. trapezius Mm. rhomboidei
Brustkorb M. pectoralis major
Anmerkungen:
• Er gilt auch als Atemhilfsmuskel
Kräftigung:
Dehnung:
© Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 16Oberkörper Brustmuskulatur M. pectoralis major
(pars clavicularis, pars sternocostalis, pars abdominalis)
Ursprung: Schlüsselbein und Brustbein
Ansatz: Oberarmkopf
siehe Sport Anatomie S. 134
6
Gelenk/ Aktion Synergist Antagonist
Verbindung
Schulter Adduktion des M. latissimus dorsi M. deltoideus acrominalis
Armes M. biceps brachii M. deltoideus spinalis und
M. deltoideus spinalis clavicularis (bei
und clavicularis (bei abduziertem Arm)
abduziertem Arm) M. biceps brachii (Caput
M. triceps brachii longum)
Schulter Innenrotation des M. subscapularis M. deltoideus spinalis
Armes M. deltoideus M. biceps brachii (Caput
clavicularis longum)
M. latissimus dorsi
Schulter Anteversion des M. latissimus dorsi M. deltoideus pars
Armes M. triceps brachii clavicularis
M. deltoideus spinalis M. biceps brachii
Schulter Retroversion des M. latissimus dorsi M. deltoideus clavicularis
Armes M. teres major M. biceps brachii
M. triceps brachii
M. deltoideus pars
spinalis
Schulter Protraktion Keine M. trapezius transversa
M. deltoideus pars spinalis
Mm. rhomboidei
Anmerkungen:
• Bildet die vordere Achselfalte.
• Ist im Ansatz zum Humerus gedreht.
6https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Gray410.png
© Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 17Kräftigung: Dehnung: © Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 18
Push Up / Liegestütz
Anfangsposition Endposition
Beteiligte Gelenke / Handgelenke, Ellenbogengelenke, Schultergelenke
Drehpunkte
Aktiv Zu Schultergelenk, LWS
stabilisierende
Gelenke
Beteiligte m. pectoralis major, m. triceps brachii, m. deltoideus pars
Muskulatur clavicularis
dynamisch
Beteiligte m. erector spinae, mm. abdominis
Muskulatur statisch
Ausgangsposition Stützposition, Becken in neutraler Position, Wirbelsäule sortiert,
und Haltung Hände weiter als Schulterbreit, Unterarme senkrecht zum Boden
Bewegung Bis zum Boden absenken und wieder hochdrücken
Endposition Brust berührt den Boden, Arme ca. 45°-60° abgespreizt
Zu beachten Wirbelsäule behält ihre natürliche Form, Schwachstelle: LWS
Variationen Knie auf den Boden, Hände weit/eng, Hände versetzt, Hände
erhöht, Füße erhöht, Hände oder Füße auf exercise Ball
Kontraindikationen Probleme mit Hand- und Schultergelenken, Probleme mit der
Beckenaufrichtung (neutrale LWS)
Hilfsmittel Hände erhöht auf einem Block, Knie auf den Boden
© Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 19Oberkörper - Armmuskulatur
M. biceps brachii
Ursprung: 1. Oberrand der Schulterpfanne 2.
Rabenschnabelfortsatz
Ansatz: Unterarm (Speiche)
Verlauf: zweigelenkig (Schulter / Ellbogen)
siehe Sport Anatomie S. 150
7
Gelenk/ Aktion Synergist Antagonist
Verbindung
Ellenbogengelenk Flexion des des M. brachialis M. triceps brachii
Unterarms M. brachioradialis M. anconeus
Ellenbogengelenk Supination des M. supinator Mm. pronatores
Unterarms
Schulter Anteversion M. pectoralis major M. latissimus dorsi
des Armes M. deltoideus pars M. triceps brachii
clavicularis
Schulter Abduktion des M. deltoideus M. pectoralis major
Armes (bei acrominalis M. latissimus dorsi
außenrotiertem M. deltoideus pars
Arm) spinalis und pars
clavicularis (bei
abduziertem Arm)
Anmerkungen:
• Er neigt zur Verkürzung und ist ein tonischer Muskeltyp.
• Funktion Nahrungsheranführung vom Aufheben und Greifen zum Mund.
7https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Biceps_brachii.png
© Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 20Kräftigung: Dehnung: © Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 21
M. triceps brachii
Ursprung: 1. Unterrand des Schulterblatts
Schulterpfanne 2. Innenrand des Oberarms 3.
Außenrand des Oberarms
Ansatz: Unterarm (Elle)
Verlauf: zweigelenkig (Schulter, Ellbogen)
siehe Sport Anatomie S. 154
8
Gelenk/ Verbindung Aktion Synergist Antagonist
Ellenbogen Extension des M. anconeus M. biceps brachii
Unterarms M. brachialis
M. brachioradialis
Schulter Retroversion des M. latissimus dorsi M. pectoralis major
Armes (nur caput M. teres major M. deltoideus pars
longum) M. deltoideus pars clavicularis
spinalis M. biceps brachii
Schulter Adduktion des Armes M. pectoralis major M. deltoideus pars
M. latissimus dorsi acromialis
M. biceps brachii M. deltoideus pars
spinalis
Schulter Außenrotation des Rotatorenmanschette Rotatorenmanschette
Armes M. deltoideus pars M. pectoralis major
spinalis M. deltoideus pars
clavicularis
M. biceps brachii
M. latissimus dorsi
Anmerkungen:
8 Quelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Gray412.png (gemeinfrei)
© Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 22Kräftigung: Dehnung: © Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 23
Bench Dips
Anfangsposition Endposition
Beteiligte Gelenke Handgelenke, Ellenbogengelenke, Schultergelenke
/ Drehpunkte
Aktiv Zu Schulter
stabilisierend:
Beteiligte m. triceps brachii, m. deltoideus pars clavicularis
Muskulatur
dynamisch
Beteiligte M. Erector spinae, M. abdominis (alle), Rotatorenmanschette
Muskulatur
statisch
Synergisten m. deltoideus pars clavicularis
Ausgangsposition Hände und Füße auf zwei Bänken, Unterarme senkrecht zum
und Haltung Boden, aktivierter Rücken und Schultergürtel
Bewegung Arme beugen und strecken
Endposition Unterarme senkrecht, so absenken, dass die Spannung im
Schultergürtel und Rücken noch gehalten werden kann
Zu beachten Schultergürtel und Rücken müssen stets aktiviert sein
Variationen Füße auf dem Boden ablegen
Kontraindikationen Probleme mit Hand- oder Schultergelenken
Hilfsmittel
© Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 24Close Triceps Push Up
Anfangsposition Endposition
Beteiligte Gelenke Handgelenke, Ellenbogengelenke, Schultergelenke
/ Drehpunkte
Aktiv Zu Schultergelenk, LWS
stabilisierende
Gelenke
Beteiligte m. triceps brachii, m. deltoideus pars clavicularis, m. pectoralis
Muskulatur major
dynamisch
Beteiligte m. erector spinae, mm. abdominis
Muskulatur
statisch
Synergisten m. deltoideus pars clavicularis, m. pectoralis major, m. serratus
anterrior
Ausgangsposition Stützposition, Becken in neutraler Position, Wirbelsäule sortiert,
und Haltung Hände unter den Schultergelenken, Arme eng am Körper
Bewegung Bis zum Boden absenken und wieder hochdrücken
Endposition Brust berührt den Boden, Arme eng am Körper
Zu beachten Wirbelsäule behält ihre natürliche Form, Schwachstelle: LWS
Variationen Knie auf den Boden
Kontraindikationen Probleme mit Hand-, Schultergelenken, fehlende Ansteuerung der
Beckenaufrichtung (neutrale LWS)
Hilfsmittel Hände erhöht auf einem Block, Knie auf den Boden
© Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 25Rücken - M. latissimus dorsi
Ursprung: LWS, BWS, Schambein
Ansatz: Innenseite vorne am Oberarmknochen
siehe Sport Anatomie S. 144
9
Gelenk/ Verbindung Aktion Synergist Antagonist
Schulter Retroversion des M. triceps brachii M. pectoralis major
Armes (Caput longum) M. deltoideus clav.
M. teres major M. biceps brachii
M. deltoideus spinalis M. infraspinatus
M. subscapularis
Schulter Adduktion des Armes M. pectoralis M. deltoideus
M. rotatores M. rotatores
M. biceps brachii M. biceps brachii
M. deltoideus spinalis (Caput longum)
und clavicularis (bei
abduziertem Arm)
M. triceps brachii
(Caput longum)
Schulter Innenrotation des M. levator scapulae M. serratus anterior
Armes (nur schwach)
M. latissimus dorsi
M. pectoralis major
Anmerkungen:
• Bildet die hintere Achselfalte.
• Ist der größte Rückenmuskel und gilt zudem als Atemhilfsmuskel („Hustenmuskel“).
• treibende Kraft bei Rudern, Hackbewegungen, Schwimmen.
• wichtig, um Gehhilfen benutzen zu können oder beim Klettern
9https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Latissimus_dorsi_muscle_back.png
© Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 26Kräftigung: Dehnung: © Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 27
Body Row
Anfangsposition Endposition
Beteiligte Gelenke / Schultergelenke, Ellenbogengelenke
Drehpunkte
Aktiv Zu Wirbelsäule, Becken
stabilisierende
Gelenke
Beteiligte m. latissimus dorsi, m. biceps brachii, m. deltoideus pars spinalis,
Muskulatur m. rhomboideus major/minor
dynamisch
Beteiligte m. erector spinae, mm. Abdominis
Muskulatur statisch
Ausgangsposition Unter einer Stange hängend, Körper gestreckt und in Spannung,
und Haltung Wirbelsäule gesichert, Schultergürtel aktiviert, weiter als
Schulterbreit gegriffen
Bewegung Von unten hängend nach oben ziehen
Endposition Mit der Brust die Stange berühren
Zu beachten Wirbelsäule bleibt stets gesichert, Becken und Wirbelsäule in
neutraler Position
Variationen Griffvariationen: Untergriff, Obergriff, Kreuzgriff
Kontraindikationen Fehlende Haltekraft
Hilfsmittel Beine erhöhen
© Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 28Pull Up / Klimmzug
Anfangsposition Endposition
Beteiligte Gelenke / Schultergelenk, Ellenbogengelenk, Schulterblatt
Drehpunkte
Aktiv Zu Schultergelenk, Schulterblatt
stabilisierende
Gelenke
Beteiligte m. latissimus dorsi, m. trapezius pars ascendens & horizontalis, m.
Muskulatur rhomboideus major/ minor
dynamisch
Beteiligte m. erector spinae, mm. Abdominis
Muskulatur statisch
Ausgangsposition An der Klimmzugstange komplett ausgehangen, Wirbelsäule und
und Haltung Becken in neutraler Position, etwas weiter als Schulterbreit
gegriffen, Obergriff
Bewegung Brust zur Stange führen
Endposition Brust so nah wie möglich an der Stange,
Zu beachten Aus der Ausgangsposition (dead hang) erfolgt als erstes eine
Aktivierung im Schultergürtel um die Schulterblätter zum
Brustkorb zu führen und die Schulter in eine gesicherte Position zu
bringen (active hang)
Variationen Obergriff, Untergriff, Kreuzgriff
Kontraindikationen Fehlende Ansteuerung des Schultergürtels um in den active hang
zu gelangen
Hilfsmittel
© Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 29Oberkörper – oberer Rücken
M. trapezius pars descendens
(Verbindung Schulterblatt mit BWS)
Ursprung: HWS
Ansatz: Schlüsselbein
siehe Sport Anatomie S. 124
10
Gelenk/ Verbindung Aktion Synergist Antagonist
Schulterblatt mit Elevation der M. trapezius
Wirbelsäule BWS Schulter ascendens
Schulterblatt mit Lateralflexion der
Wirbelsäule BWS HWS
Anmerkungen:
• Überdeckt mit den Anteilen pars descendens und transversa die darunter liegenden M.
rhomboidei.
• viele Triggerpunkte
Kräftigung:
Dehnung:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Trapezius_Gray409.PNG
10
© Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 30M. trapezius pars transversa
(Verbindung Schulterblatt mit BWS und HWS)
Ursprung: BWS
Ansatz: Schulterhöhe (Akromion)
siehe Sport Anatomie S. 124
11
Gelenk/ Verbindung Aktion Synergist Antagonist
Schulterblatt mit Verschiebung der M. rhomboidei M. serratus anterior
Wirbelsäule HWS und Scapula nach medial M. trapezius
BWS descendens und
ascendens
M. latissimus dorsi
M. pectoralis major
Schulter Retraktion der M. rhomboidei M. pectoralis major
Schulter M. trapezius
descendens und
ascendens
Anmerkungen:
• Überdeckt mit den Anteilen pars descendens und transversa die darunter liegenden M.
rhomboidei.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Trapezius_Gray409.PNG
11
© Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 31Kräftigung: Dehnung: © Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 32
M. trapezius pars ascendens
(ein-, und mehrgelenkig, Verbindung Schulterblatt mit BWS)
Ursprung: Brustwirbelsäule
Ansatz: Schulterblatt
siehe Sport Anatomie S. 124
12
Gelenk/ Aktion Synergist Antagonist
Verbindung
Schulterblatt Verschiebung der M. rhomboidei M. trapezius ascendens
mit Wirbelsäule Scapula nach M. levator scapulae M. serratus anterior
HWS kaudal M. serratus anterior (kaudaler Anteil)
(kranialer Anteil) M. latissimus dorsi
M. pectoralis major
Anmerkungen:
Kräftigung:
Dehnung:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Trapezius_Gray409.PNG
12
© Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 33Mm. rhomboidei major/ minor
(Verbindung Schulterblatt mit BWS und HWS)
Ursprung: BWS
Ansatz: Schulterblattwinkel
siehe Sport Anatomie S. 126
13
Gelenk/ Verbindung Aktion Synergist Antagonist
Schulterblatt mit Verschiebung der M. trapezius M. trapezius
Wirbelsäule (BWS) Scapula nach kranial descendens ascendens
M. levator scapulae M. serratus anterior
M. rhomboideus (kaudaler Anteil)
minor M. pectoralis minor
M. serratus anterior (nur indirekt über
Ansatz am Humerus)
M. latissimus dorsi
Verschiebung der M. trapezius M. serratus anterior
Scapula nach medial M. rhomboideus
minor
M. pectoralis major
M. latissimus dorsi
M. levator scapulae
(indirekt über Ansatz
am Humerus via
Adduktion)
Anmerkungen:
• Überdeckt von M. trapezius.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Rhomboideus_major.png
13
© Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 34Kräftigung: Dehnung: © Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 35
Oberkörper - Rückenstrecker M. erector spinae
(M. iliocostalis, M. intertransversarii mediales/lateralis lumborum, M. multifidus lumborum,
Mm rotatores breves und longi)
(Verbindung Schulterblatt mit BWS und HWS)
Ursprung: Becken, Kreuzbein, Wirbel
Ansatz: Rippen, Quer- und Dornfortsätze, Schädel
siehe Sport Anatomie S. 96
14
Gelenk/ Aktion Synergist Antagonist
Verbindung
Wirbel Extension der alle anderen M. rectus abdominis
Wirbelsäule autochtonen M. obliquus externus
Rückenmuskeln M. obliquus internus
Wirbel Neigung zur alle anderen M. rectus abdominis
gleichen Seite autochtonen M. obliquus externus
Rückenmuskeln M. obliquus internus
M. rectus abdominis
M. obliquus externus
M. obliquus internus
2 Wirbel / Rotation zur Mm. rotatores Mm. rotatores
Dornfortsatz zu gleichen Seite M. obliquus externus
Querfortsatz
Rippen mit Kippung des
Beckenkamm Beckens nach
ventral
Anmerkungen:
• Die wichtigste Aufgabe der Rückenstrecker ist die Streckung der Wirbelsäule und eine
aufrechte Haltung
• Zudem sind sie zuständig für die Sicherung und Stabilisierung während einer Druck-,
Scher- oder Rotationsbelastung
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Gray389_-_Erector_spinae.png
14
© Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 36Kräftigung: Dehnung: © Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 37
Back Extension
Anfangsposition Endposition
Beteiligte Gelenke / LWS
Drehpunkte
Aktiv Zu Hüftgelenk, Wirbelsäule
stabilisierende
Gelenke
Beteiligte m. erector spinae
Muskulatur
dynamisch
Beteiligte m. erector spinae (BWS, HWS)
Muskulatur statisch
Ausgangsposition Bauchlage auf einem Exercise Ball, Hüfte liegt auf dem Ball,
und Haltung Oberkörper soweit überhängen wie möglich (Balance halten)
Bewegung Oberkörper aufrichten
Endposition Oberkörper aufgerichtet, natürliche Doppel-S-Form der
Wirbelsäule ist nahezu erreicht
Zu beachten Wirbelsäule nicht überstrecken
Variationen Bauchlage auf einem Step, einer Bank und vorne überhängen
Kontraindikationen Probleme mit der Balance
Hilfsmittel
© Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 38Flutter Kicks
Anfangsposition Endposition
Beteiligte Gelenke / Hüftgelenk
Drehpunkte
Aktiv Zu Wirbelsäule, speziell LWS
stabilisierende
Gelenke
Beteiligte m. gluteus maximus, mm. Ischiocrurales
Muskulatur
dynamisch
Beteiligte m. erector spinae, mm. Abdominis
Muskulatur statisch
Ausgangsposition Bauchlage, Wirbelsäule sortiert, aktivierte Rumpfmuskulatur,
und Haltung Beine vom Boden anheben
Bewegung Auf- und Abbewegung im Hüftgelenk, abwechselnd
Endposition Ein Bein angehoben, das andere unten gestreckt
Zu beachten Überstrecken der Wirbelsäule vermeiden, möglichst die neutrale
Doppel-S-Form beibehalten
Variationen Bauchlage auf einem Step, einer Bank
Kontraindikationen Probleme mit der Stabilisierung der LWS
Hilfsmittel
© Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 39Rumpfmuskulatur
M. transversus abdominis
Ursprung: Wirbelsäule
Ansatz: Linea alba
siehe Sport Anatomie S. 112
15
Gelenk/ Verbindung Aktion Synergist Antagonist
Wirbelsäule/ Rippen Bauchpresse M. obliquus externus keine
mit Beckenkamm/ (beidseitig) M. obliquus internus
Linea alba M. rectus abdominis
Wirbelsäule/ Rippen Rotation des M. obliquus externus M. obliquus externus
mit Beckenkamm/ Rumpfes zur der Gegenseite M. obliquus internus
Linea alba Gegenseite M. obliquus internus der Gegenseite
M. iliocostalis M. multifidus
lumborum lumborum
M. longissimus Mm. rotatores
thoracis lumborum
Wirbelsäule/ Rippen Einziehen der M. obliquus externus M. rectus abdominis
mit Beckenkamm/ Bauchwand M. obliquus internus
Linea alba
Anmerkungen:
• Der Muskel wird vom M. obliquus externus/ internus abdominis, M. rectus abdominis
überdeckt.
• Hilft bei der Stabilisierung der Wirbelsäule
• Reduziert bei gezielter Anspannung bei Belastung den Druck auf Weichteile im
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Transversus_abdominis.png
15
© Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 40Kräftigung: Dehnung: © Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 41
M. rectus abdominis
Ursprung: 3. – 7. Rippe, Schwertfortsatz des Brustbeins
Ansatz: Schambein
siehe Sport Anatomie S. 110
16
Gelenk/ Verbindung Aktion Synergist Antagonist
Wirbelsäule / Flexion (beidseitig) M. obliquus externus Alle autochtonen
Rippenpaare mit der Wirbelsäule abdominis Rückenmuskeln der
dem Becken M. obliquus internus Region
abdominis
Wirbelsäule / Kippung des M. gluteus maximus M. iliopsoas
Rippenpaare mit Beckens nach dorsal
dem Becken (beidseitig)
Wirbelsäule / Bauchpresse M. transversus keine
Rippenpaare mit (beidseitig) abdominis
dem Becken M. obliquus externus
abdominis
M. obliquus internus
abdominis
Anmerkungen:
• Der M. rectus abdominis ist repräsentativ für ein Sixpack, durch die Sichtbarkeit der
Sehnenplatte.
• Er hat eine besondere Bedeutung bei der Expression beim Sprechen.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Rectus_abdominis.png
16
© Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 42Kräftigung: Dehnung: © Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 43
Crunch
Anfangsposition Endposition
Beteiligte Gelenke BWS/LWS
/ Drehpunkte
Aktiv Zu LWS
stabilisierende
Gelenke
Beteiligte m. rectus abdominis (aber auch alle anderen Bauchmuskeln)
Muskulatur
dynamisch
Beteiligte mm. abdominis
Muskulatur
statisch
Ausgangsposition Rücklage, LWS aktiviert, Beine erhöht, Hände sind auf der Brust
und Haltung oder hinter dem Kopf verschränkt
Bewegung Schulterblätter vom Boden lösen und Oberkörper einrollen
Endposition Soweit heben wie die Hüftgelenke unbeweglich bleiben
Zu beachten LWS hält ständig Kontakt zum Boden, Hände ruhen entspannt
hinter dem Kopf
Variationen Füße aufstellen, Beine auf einem Ball ablegen, Oberkörper auf
einem Ball ablegen und Füße aufstellen
Kontraindikationen Fehlende Ansteuerung der Beckenaufrichtung (LWS neutral)
Hilfsmittel
© Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 44Bent Knee Hip Raise Anfangsposition Endposition Beteiligte Gelenke Hüftgelenke / Drehpunkte Aktiv Zu Rumpf, Hüfte stabilisierende Gelenke Beteiligte m. rectus abdominis (aber auch die andere Bauchmuskeln) Muskulatur dynamisch Beteiligte mm. abdominis Muskulatur statisch Synergisten m. iliopsoas (gering) Ausgangsposition Rücklage, Arme neben dem Körper platziert, Füße sind aufgestellt, und Haltung LWS aktivieren Bewegung Hintern vom Boden lösen und zur Brust ziehen Endposition Hintern vom Boden gelöst Zu beachten LWS hält die ganze Zeit Kontakt zum Boden Variationen Knie komplett flexen Kontraindikationen Fehlende Ansteuerung der Beckenaufrichtung (LWS neutral) Hilfsmittel © Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 45
M. obliquus externus abdominis
Ursprung: 5. – 8. Rippe
Ansatz: Darmbeinkamm, Rektusscheide
siehe Sport Anatomie S. 110
17
Gelenk/ Verbindung Aktion Synergist Antagonist
Wirbelsäule/ Rippen Rotation des M. obliquus externus M. transversus
mit Beckenkamm Rumpfes zur Mm. rotatores abdominis
Gegenseite lumborum M. obliquus internus
M. multifidus abdominis der
lumborum Gegenseite
Wirbelsäule/ Rippen Flexion (beidseitig) M. obliquus externus Alle autochthonen
mit Beckenkamm der Wirbelsäule abdominis Rückenmuskeln der
M. obliquus internus Region
abdominis
Wirbelsäule/ Rippen Neigung zur Seite M. obliquus internus Alle kontralateralen
mit Beckenkamm abdominis autochthonen
M. quadratus Rückenmuskeln
lumborum
Wirbelsäule/ Rippen Bauchpresse M. transversus keine
mit Beckenkamm (beidseitig) abdominis
M. obliquus internus
M. rectus abdominis
Wirbelsäule/ Rippen Einziehen der M. transversus M. rectus abdominis
mit Beckenkamm Bauchwand abdominis
M. obliquus internus
abdominis
Anmerkungen:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Gray392.png
17
© Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 46Kräftigung: Dehnung: © Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 47
M. obliquus internus abdominis
Ursprung: Darmbeinkamm, Rektusscheide
Ansatz: 5. – 8. Rippe
siehe Sport Anatomie S. 186
18
Gelenk/ Verbindung Aktion Synergist Antagonist
Wirbelsäule/ Rippen Rotation des M. obliquus externus M. obliquus externus
mit Beckenkamm Rumpfes zur der Gegenseite abdominis
Gegenseite M. transversus M. multifidus
abdominis lumborum
M. iliocostalis Mm. rotatores
lumborum lumborum
Wirbelsäule/ Rippen Flexion (beidseitig) M. obliquus externus Alle autochthonen
mit Beckenkamm der Wirbelsäule abdominis Rückenmuskeln der
M. rectus abdominis Region
Wirbelsäule/ Rippen Neigung zur Seite M. obliquus externus M. obliquus externus
mit Beckenkamm abdominis / internus abdominis
M. quadratus der Gegenseite
lumborum M. quadratus
Mm. rotatores lumborum
lumborum Der Gegenseite
Mm. levatores Alle kontralateralen
costarum autochthonen
Alle autochthonen Rückenmuskeln
Rückenmuskeln
Wirbelsäule/ Rippen Bauchpresse M. transversus keine
mit Beckenkamm (beidseitig) abdominis
M. obliquus externus
M. rectus abdominis
Wirbelsäule/ Rippen Einziehen der M. transversus M. rectus abdominis
mit Beckenkamm Bauchwand abdominis
M. obliquus externus
abdominis
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Gray395.png
18
© Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 48Anmerkungen: • Er hat eine besondere Bedeutung bei der Expression beim Sprechen. • M. obliquus externus abdominis und des M. transversus abdominis die Linea alba. • Der Muskel wird vom M. obliquus externus abdominis überdeckt. Kräftigung: Dehnung: © Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 49
Planking / Side Planking
Anfangsposition Endposition
Beteiligte Gelenke / Wirbelsäule
Drehpunkte
Aktiv Zu Wirbelsäule, Becken, Schultergelenk
stabilisierende
Gelenke
Beteiligte m. erector spinae, m. obliquus externus / internus, mm. Multifidi
Muskulatur
dynamisch
Beteiligte m. erector spinae, m. obliquus externus / internus, mm. Multifidi
Muskulatur statisch
Ausgangsposition Seitlage, unterer Arm auf dem Unterarm aufgestützt, Wirbelsäule
und Haltung und Becken in neutraler Position
Bewegung Becken vom Boden lösen, gerade Linie zwischen Fuß und Schulter
bilden
Endposition Becken vom Boden lösen, gerade Linie zwischen Fuß und Schulter
bilden
Zu beachten Neutrale Position der Wirbelsäule und des Beckens beibehalten,
Schultergürtel aktiviert um das Schultergelenk zu sichern
Variationen Bauch zeigt zum Boden, beide Unterarme sind gleichzeitig
aufgestützt à Planking
Kontraindikationen Fehlende Balance und Ansteuerung der neutralen Wirbelsäule
Hilfsmittel
© Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 50Side bend
Anfangsposition Endposition
Beteiligte Gelenke LWS
/ Drehpunkte
Aktiv Zu Wirbelsäule, Becken
stabilisierende
Gelenke
Beteiligte m. obliquus externus/internus, m. erector spinae, mm. Multifidi
Muskulatur
dynamisch
Beteiligte Mm. Abdominis
Muskulatur
statisch
Synergisten
Ausgangsposition Seitlage auf einem Ball, Hüfte auf dem Ball, Beine zur Stabilisierung
und Haltung überschlagen
Bewegung Seitlich die Wirbelsäule beugen
Endposition Oberkörper vom Ball angehoben
Zu beachten Die Bewegung langsam und kontrolliert ausführen, ROM ist relativ
klein
Variationen Gewicht in die freie Hand nehmen und hinter dem Kopf halten
Kontraindikationen Fehlende Balance
Hilfsmittel
© Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 51Unterkörper – Hüftgelenksmuskulatur
M. gluteus maximus
Ursprung: Darmbeinschaufel
Ansatz: Außenseite Oberschenkelknochen
siehe Sport Anatomie S. 188
19
Gelenk/ Verbindung Aktion Synergist Antagonist
Hüfte Extension der Hüfte M. semimembranosus M. iliopsoas,
M. semitendinosus M. rectus femoris
M. biceps femoris M. gluteus medius
M. gluteus medius M tensor fascia latae
M. gluteus minimus M. gracilis
Mm. adductores (in Mm. adductores (in
der Neutralstellung) die Naturstellung)
Hüfte Außenrotation des M. gluteus medius M. gluteus medius
Beines M. gluteus minimus M. gluteus minimus
M. quadratus femoris M. tensor fascia latae
Rotatorenmanschette Mm. adductores (in
Mm. adductores (in die Naturstellung)
die Naturstellung)
Hüfte mit LWS Kippung des Beckens M. rectus abdominis M. rectus femoris
nach dorsal M. biceps femoris M. iliopsoas
M. semimembranosus M. longissimus
M. semitendinosus thoracis
M. iliocostalis
Anmerkungen:
• Der gluteus maximus gilt als größter Muskel des Menschen in Bezug auf
Muskelvolumen.
• Er ist für die Stabilisierung des Beckens essentiell.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Gluteus_maximus.png
19
© Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 52Kräftigung: Dehnung: © Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 53
Schulterbrücke
Anfangsposition Endposition
Beteiligte Gelenke / Hüfte, Becken
Drehpunkte
Aktiv Zu Wirbelsäule, Becken
stabilisierende
Gelenke
Beteiligte m. rectus abdominis, m. gluteus maximus, mm. Ischiocrurales
Muskulatur
dynamisch
Beteiligte mm. abdominis
Muskulatur statisch
Ausgangsposition Rücklage, Füße aufgestellt, Arme liegen locker neben dem Körper
und Haltung
Bewegung Becken nach oben rausstrecken, so dass eine gerade Linie von den
Schultern zum Knie entsteht
Endposition Becken angehoben, gerade Linie zwischen Schultern und Knien
Zu beachten Aktivierter Schultergürtel um die nötige Stabilität in der
Auflagefläche zu bieten
Variationen In der Endposition ein Bein wegstrecken, Übung statisch halten
oder dynamische Bewegungen
Kontraindikationen Probleme mit der HWS
Hilfsmittel
© Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 54M. iliopsoas
Ursprung:
20 à m. iliacus: Darmbeinschaufel, Innenseite
à m. psoas major: Seitenflächen der Wirbelkörper 12.
BW – 4. LW
Ansatz: Innenseite des Oberschenkelknochens
siehe Sport Anatomie S. 184
Anmerkungen:
Gelenk/ Verbindung Aktion Synergist Antagonist
Hüftgelenk Flexion des M. rectus femoris M. gluteus maximus
Oberschenkels M. tensor fasciae M.
latae semimembranosus
M. gluteus medius M. semitendinosus
M. Sartorius M. biceps femoris
M. gracilis M. gluteus medius
M. pectineus M. gluteus minimus
Mm. adducotres (aus
Mm. adductors (aus
maximaler Extension)
maximaler Flexion)
M. pectineus
LWS Lordosierung der M. rectus femoris M. gluteus maximus
Lendenwirbelsäule M. sartorius M. biceps femoris
und Kippung des M. tensor fasciae M.
Beckens nach ventral latae semimembranosus
M. semitendinosus
M. rectus abdominis
Hüftgelenk Außenrotation des Rotatorenmanschette Rotatorenmanschette
Oberschenkels
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Gray430.png
20
© Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 55Kräftigung: Dehnung: © Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 56
Mm. adductores
M. adductor magnus, M. gracilis, M. adductor brevis, M. adductor longus, M. pectineus
Ursprung: Schambein und Sitzbein
Ansatz: Rückseite des Oberschenkelknochens
siehe Sport Anatomie S. 200/ 198
21
Gelenk/ Verbindung Aktion Synergist Antagonist
Hüfte Adduktion des M. sartorius Mm. abductores
Beines M. gracilis Rotatoren
Hüfte Innenrotation des M. gluteus maximus Mm. abductores
Beines M. tensor fascia latae Rotatoren
(aus maximaler M. gluteus medius
Außenrotation) M. gluteus minimus
M. adductor brevis
M. adductor magnus
Anmerkungen:
• Die Adduktoren umfassen einen Muskelkomplex aus mehreren einzelnen Muskeln o.g.
• Tragen zur Stabilisierung des Beckens bei, im Stand aber auch im Gehen und Laufen
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Adductores_femoris.png
21
© Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 57Kräftigung: Dehnung: © Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 58
Mm. abductores
M. tensor fasciae latae, M. gluteus medius, M. gluteus minimus, M.piriformis, M. quadratus
femoris
Ursprung: Außenseite Darmbeinschaufel
Ansatz: Oberschenkelaußenseite und äußerer
Schienbeinkopf
siehe Sport Anatomie S. 196/ 190/ 186
Gelenk/ Verbindung Aktion Synergist Antagonist
Hüfte Abduktion des M. sartorius M. gluteus maximus
Beines M. gluteus maximus (kranialer Anteil)
M. rectus femoris M. gluteus medius
M. quadriceps femoris M. gluteus minimus
(bei gestreckter Hüfte) M. tensor fasciae latae
Hüfte Verhinderung des M. gluteus maximus M. tensor fascia latae
Absinkens des M. gluteus medius M. gluteus medius
Beckens auf der M. gluteus minimus (ventraler Anteil)
Standbeinseite (dorsale Anteile der M. gluteus minimus
beiden) (ventraler Anteil)
M. quadratus femoris Mm. adductores (bei
M. pectineus maximaler
M. sartorius Außenrotation)
M. adductor brevis
M. adductor magnus
Mm. obturatorii et
gemelli
Anmerkungen:
© Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 59Kräftigung: Dehnung: © Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 60
Unterkörper Rotatorenmanschette, Schwerpunkt M. piriformis
M. obturator externus, M. gluteus minimus, M. superior gemellus, M. inferior gemellus,
M. piriformis
Ursprung: Kreuzbein/Sitzbein
Ansatz: Oberschenkelkopf
siehe Sport Anatomie S. 186
22
Gelenk/ Verbindung Aktion Synergist Antagonist
Hüftgelenk Außenrotation (bei M. gluteus maximus M. tensor fasciae
gestreckter Hüfte) M. gluteus medius latae
des Beines M. gluteus minimus M. glutes minimus
M. quadratus M. glutes medius
femoris Mm. adductores
Mm. obturatorii et
gemelli
M. pectineus
M. Sartorius
Mm. adductors
Hüftgelenk Abduktion (bei M. gluteus medius Mm. adductores
gebeugter Hüfte) des M. gluteus minimus M. pectineus
Beines M. tensor fasciae M. gracilis
latae M. gluteus maximus
Mm. Obturatorii et M. quadratus
gemelli femoris
M. quadratus
femoris
Anmerkungen:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Posterior_Hip_Muscles_1.PNG
22
© Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 61Kräftigung: Dehnung: © Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 62
Unterkörper Beinmuskulatur
M. quadriceps femoris
23 Ursprung: Oberschenkelknochen und Darmbein (m. rectus
femoris)
Ansatz: Schienbein
siehe Sport Anatomie S. 186
Gelenk/ Verbindung Aktion Synergist Antagonist
Hüfte Flexion des M. iliopsoas M. gluteus
Oberschenkels (nur M. tensor fascia latae m. ischiocrurales
rectus femoris) Mm. adductores (aus semitendinosus
maximaler Extension)
Knie Extension des - M. ischiocrurales
Unterschenkels M. gastrocnemius
Anmerkungen:
• Der M. quadriceps femoris sichert die Patella auf der Fascies patellaris des Femur.
• Die Muskelfasern sind sehr stark gefiedert oberflächlich, die tieferen verlaufen parallel.
• Ist der Muskeltonus sehr stark ausgeprägt und auch in Ruhe beständig, kann dies zu
einer Kippung des Beckens nach ventral (kann zum Hohlkreuz beisteuern)
• Der Anteil vom Muskelverhältnis zum M. biceps femoris ist 3:1
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Rectus_femoris.png
23
© Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 63Kräftigung: Dehnung: © Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 64
Ischiocrurale Gruppe
M. biceps femoris (zweigelenkig), M. semitendinosus, M. semimembranosus
Ursprung: Sitzbeinhöcker
Ansatz: Unterschenkel
siehe Sport Anatomie S. 214/ 216
24
Gelenk/ Verbindung Aktion Synergist Antagonist
Hüfte Extension des M. gluteus maximus M. quadriceps
Oberschenkels
Knie Flexion des M. gracilis M. gluteus maximus
Unterschenkels M. sartorius M. tensor fascia latae
Mm. adductores M. quadratus femoris
M. gastrocnemius M. popliteus
(nicht bei
plantarflektiertem
Fuß)
Aufrichtung des
Beckens nach dorsal
Anmerkungen:
• Bei einem gezieltem Krafttraining trägt der M. biceps femoris zu einer Abflachung der
LWS-Lordose bei.
• Neigt zur Abschwächung und zur Verkürzung.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Gray434.png
24
© Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 65Kräftigung: Dehnung: © Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 66
Leg Lift Anfangsposition Endposition Beteiligte Gelenke / Kniegelenk Drehpunkte Aktiv Zu Sprunggelenk, Hüftgelenk, Wirbelsäule stabilisierende Gelenke Beteiligte mm. ischiocrurales Muskulatur dynamisch Beteiligte m. gastrocnemius, m. tibialis anterior Muskulatur statisch Ausgangsposition Aufrechte Haltung an einer Wand stehend, mit einer Hand an der und Haltung Wand stabilisieren Bewegung Ein Bein im Kniegelenk beugen Endposition Maximale Beugung im Kniegelenk Zu beachten Rücken gerade halten, aufrechte Haltung Variationen Kontraindikationen Probleme mit den Sprunggelenken Hilfsmittel © Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 67
M. gastrocnemius
Ursprung: Innere und Äußere Oberschenkelrolle
Ansatz: Fersenbein
siehe Sport Anatomie S. 248
25
Gelenk/ Verbindung Aktion Synergist Antagonist
Knie Flexion des M. gracilis M. gluteus maximus
Unterschenkels M. sartorius M. tensor fascia
M. biceps femoris latae
M. semimembranosus M. quadratus
M. semitendinosus femoris
Fuß Supination des M. soleus M. peronei
Sprunggelenks M. tibialis posterior M. extensor
M. flexor digitorum digitorum longus
longus
M. flexor hallucis
longus
M. tibialis anterior
Anmerkungen:
• Trägt zum Abrollen des Standbeins essentiell bei.
25 Quelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Image438.gif
© Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 68• Der M. gastrocnemius überdeckt den darunter liegenden M. soleus, mit dem zusammen
er den M. triceps surae bildet.
• Der M. gastrocnemius wird auch Zwillingswadenmuskel genannt.
Kräftigung:
Dehnung:
© Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 69M. soleus
Ursprung: Wadenbeinköpfchen
Ansatz: Fersenbein
siehe Sport Anatomie S. 246
26
Gelenk/ Verbindung Aktion Synergist Antagonist
Fuß Flexion des oberen M. gastrocnemius M. tibialis anterior
Sprunggelenks M. flexor hallucis M. extensor
(Plantarflexion) longus digitorum longus
Mm. peronei M. flexor hallucis
M. tibialis posterior longus
M. flexor digitorum M. peroneus tertius
longus
Fuß Supination des M. gastrocnemius M. peronei
Sprunggelenks M. tibialis posterior M. extensor
M. flexor digitorum digitorum longus
longus
M. flexor hallucis
longus
M. tibialis anterior
Anmerkungen:
• Der M. soleus ist ein Muskel, der von dem M. gastrocnemius verdeckt wird und mit ihm
zusammen den M. triceps surae bildet.
• Er hat eine wichtige Rolle im Stabilisieren des Abrollens im Sprunggelenk.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Gray438.png
26
© Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 70Kräftigung: Dehnung: © Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 71
M. tibialis anterior
Ursprung: Äußere Schienbeinkante
Ansatz: innerer Fußrand
siehe Sport Anatomie S. 234
27
Gelenk/ Verbindung Aktion Synergist Antagonist
Fuß Extension im oberen M. flexor hallucis M. tibialis posterior
Sprunggelenk longus M. flexor hallucis
(Dorsalflexion) M. flexor digitorum longus
longus M. gastrocnemius
M. soleus
M. flexor digitorum
longus
Fuß Supination M. gastrocnemius Mm. peronei
M. tibialis posterior M. pernoneus tertius
M. soleus M. extensor
M. flexor digitorum digitorum longus
longus
M. flexor hallucis
longus
Anmerkungen:
• Besonders beim Laufen ist seine Hauptaufgabe den Fuß anzuheben, was öfters dazu
führt, dass der M. tibialis anterior schneller ermüdet.
• Beim Stehen balanciert er zusammen mit M. soleus, sodass das Sprunggelenk gerade
bleibt.
Quelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Gray437.png
27
© Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 72Kräftigung: Dehnung: © Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 73
Komplexübungen
Air-Squat / Kniebeuge
Anfangsposition Endposition
Beteiligte Gelenke / Sprunggelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk
Drehpunkte
Aktiv Zu Sprunggelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk, Wirbelsäule
stabilisierende
Gelenke
Beteiligte m. quadriceps, m. gluteus maximus, mm. Ischiocrurales
Muskulatur
dynamisch
Beteiligte m. erector spinae, mm. Abdominis
Muskulatur statisch
Ausgangsposition Etwa Hüft- bis Schulterbreiter Stand, Wirbelsäule und Becken in
und Haltung neutraler Position, gesichert und aktivierte Muskulatur, Bein und
Füße leicht außenrotiert
Bewegung In der Hüfte beugen und soweit wie möglich absenken
Endposition Tiefe Hocke, Fersen am Boden
Zu beachten Entweder vor oder über 90° anhalten, gerne so tief wie möglich,
Knie zeigen über die Zehen hinaus und dürfen auch nach vorne
schieben, !Fersen am Boden!
Variationen Squat to Box à Beim Absenken auf einer Bank/ Box absetzen und
wieder aufstehen
Kontraindikationen Fehlende Beweglichkeit im Sprunggelenk, fehlende Ansteuerung
der Außenrotation, fehlende Ansteuerung der neutralen und
stabilisierten Wirbelsäule
Hilfsmittel
© Q-Fitness Academy www.q-fitness.de 74Sie können auch lesen