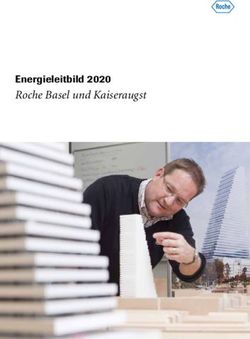PRAKTIKUM SYNTHESE UND CHARAKTERISIERUNG ANORGANISCHER VERBINDUNGEN SOSE 2021 - PROTOKOLL
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Praktikum Synthese und
Charakterisierung anorganischer
Verbindungen
SoSe 2021
Protokoll
V2 - SF 8 Zinnober
Betreuer: PD Dr. K. Zeckert
Franz Thiemann (3750567)
Versuchsdurchführung: 23.06.2021
Protokollabgabe: 20.08.2021Inhaltsverzeichnis
1 Name des Päperates 3
2 Theorie 3
2.1 Modifikationen des Quecksilber(II)sulfids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.2 Pigmentfarben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.3 Zinnober als Farbpigment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3 Reaktionsgleichungen und Ansatzgrößen 4
4 Versuchsvorschrift 4
5 Arbeitsschutz 4
6 Beobachtungen und Bemerkung 6
7 Auswertung und Diskussion 6
7.1 Ausbeuteberechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
7.2 Charakterisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
7.2.1 Aussehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
7.2.2 Löslichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
7.2.3 Herstellung einer Caseinfarbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
7.2.4 Pulverdiffraktogramm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
7.3 Fehlerdiskussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7.4 Diskussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
8 Literatur 11
2V2 - SF 8 Zinnober 2.3
1 Name des Päperates
• Name: α-Quecksilbersulfid
• Trivialname: Zinnober, Cinnabarit
• Formel: α-HgS
• CAS-Nummer: 1344-48-5
2 Theorie
2.1 Modifikationen des Quecksilber(II)sulfids
Quecksilbersulfid kann in drei Modifikationen in der Natur vorkommen: Die rote α-Modifikation,
auch Cinnabarit genannt, ist die thermodynamisch stabilste Modifikation und kristallisiert in ei-
nem hexagonalen Kristallsystem1 in Raumgruppe P 31 21 oder P 32 21. Die β-Modifikation ist bei
Raumtemperatur metastabil und wird in Reaktionen typischerweise kinetisch gebildet. Ab einer
Temperatur von 344 °C ist die β-Modifikation thermodynamisch günstiger. Sie besitzt im Gegen-
satz zur α-Modifikation eine kubisch flächenzentrierte Kristallstruktur mit der Raumgruppe F 43n.
Durch die deutlich kleinere Bandlücke2 von 0,5 eV besitzt die β-Modifikation eine schwarze Farbe.
Die γ-Modifikation, auch Hypercinnabarit genannt, ist eine Hochdruckmodifikation und kristalli-
siert in einem hexagonalen Strukturtyp.3 In der Natur kommt Hypercinnabarit sehr selten und
nur in sehr kleinen Kristallen vor. Um die schwarze β-Modifikation in die rote α-Modifikation
umzuwandeln, muss das Quecksilber(II)sulfid auf einer Temperatur gehalten werden, bei der die
Gleichgewichtseinstellung mit ausreichender Geschwindigkeit ablaufen kann. Gleichzeitig sollte die
Temperatur nicht zu hoch gewählt werden, da mit zunehmender Temperatur das Gleichgewicht
mehr auf die Seite der β-Modifikation verschoben wird.
βHgS αHgS (1)
Alternativ kann die rote α-Modifikation auch direkt aus Quecksilber und Schwefel durch Vermörsern
hergestellt werden:
Mörsern
Hg + S −−−−−→ αHgS (2)
Neben der Herstellung von Zinnober-Pigment wird diese Methode auch verwendet, um Quecksilber
sicher zu entsorgen, da das gebildete Quecksilbersulfid nahezu unlöslich und somit ungiftig ist. Zur
Herstellung im Labormaßstab ist sie aber aufgrund des Arbeitens mit elementarem Quecksilber
wenig geeignet.
2.2 Pigmentfarben
Farben können grundsätzlich in zwei Arten unterschieden werden: Pigmentfarben und Farbstoffe.
Farbstoffe sind Substanzen, die zur Auftragung in einem Lösungsmittel gelöst werden. Dies sorgt
für eine gewisse Transparenz der Farbe. Pigmente sind im Gegensatz zu Farbstoffen feste, meist
unlösliche, Partikel, die in einem Bindemittel aufgenommen werden. Aufgrund der festen, undurch-
sichtigen Partikel können sie nicht transparent aufgetragen werden, weisen dafür aber eine gute
Mischbarkeit auf, da keine chemischen Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Partikeln auftre-
ten. In jedem Fall beruht die Farbigkeit einer Farbe auf der selektiven Absorbtion von Licht der
Komplementärfarbe. Das verbliebene Spektrum wird entweder transmittiert oder reflektiert.
Pigmentfarben wurden bereits in der Prähistorie in der Form von Erdfarben in Höhlenmalereien
verwendet.4 Auch die ersten Verwendungen des Milchproteins Casein sind in Höhlenmalereien zu
finden.5 Casein stellt mit 78,8 % einen Großteil des Milchproteins in Kuhmilch und kann relativ
einfach durch Fällung mit einer Säure aus der Milch erhalten werden. Um Casein als Bindemittel in
Farben zu verwenden, muss dieses zunächst basisch aufgeschlossen werden. Die Farbpartikel werden
anschließend dem so hergestellten Caseinbrei zugegeben. Da der Caseinbrei aufgrund des basischen
Aufschlusses einen hohen pH-Wert besitzt, müssen die verwendeten Farbpartikel basenstabil sein.
3V2 - SF 8 Zinnober 5.0
2.3 Zinnober als Farbpigment
Zinnober wurde wegen seiner kräfigen, hellroten Farbe oft als rote Partikelfarbe eingesetzt. Je-
doch wandelt sich in vielen Kunstwerken das rote α-HgS durch Sonneneinstrahlung in schwarzes
β-HgS um, was zu einem unerwünschten Verdunkeln der Farbe führt. Dies ist jedoch nicht bei
allen Vorkommen von Zinnober der Fall, da einige Werke mehrere hundert Jahre dem Sonnenlicht
ausgesetzt waren und keine Verdunklung aufweisen. Dieser Sachverhalt wurde in der Literatur6 un-
tersucht und festgestellt, dass der Anteil von halogenischen Verunreinigungen ausschlaggebend für
die Photosensitivität ist. Demnach sollte das im Versuch hergestellte Zinnober photostabil sein, da
bei der Synthese keine chloridhaltigen Chemikalien verwendet wurden und so eine Verunreinigung
mit Chlorid-Ionen ausgeschlossen werden kann.
3 Reaktionsgleichungen und Ansatzgrößen
Hg(OAc)2 + (NH4)2Sx →
− β − HgS + Sx–1 + 2NH3 + 2HAc (3)
100 °C,(NH4)2Sx
β − HgS α − HgS (4)
Tabelle 1: Ansatzgrößen zur Herstellung des Nickeloxalats
Quecksilber(II)acetat Hg(OAc)2 0,5 g 1,6 mmol
Ammoniumpolysulfid-Lösung (21 %)* (NH4)2Sx 16 ml 259 mmol
* Davon wurden 10 ml initial zugegeben und weitere 6 ml über den Verlauf der Reaktion zugetropft
4 Versuchsvorschrift
0,5 g (1,6 mmol) Quecksilberacetat werden in 10 ml (162 mmol) einer 21 %igen wässrigen Ammoniumpolysulfid-
Lösung gegeben und bei 100 °C Heizplattentemperatur unter Rühren in einem Erlenmeyerkolben
solange erhitzt (Erlenmeyerkolben mit Uhrglas abdecken), bis eine Rotfärbung des ausgefallenen
HgS zu beobachten ist (Dauer ca. 1-2 Stunden, gegebenenfalls etwas (NH4)2Sx - Lösung trop-
fenweise nachgeben). Nach dem Abkühlen wird das rote Quecksilbersulfid abfiltriert (Trichter +
Filterpapier), mit Wasser und Methanol gründlich gewaschen und an der Luft getrocknet.
5 Arbeitsschutz
Tabelle 2: Wesentliche H- und P-Sätze verwendeter Chemikalien
(CH3COO)Hg - Quecksilber(II)acetat
H300+H310+H330 Lebensgefahr bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung tragen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Sofort
P302+P352+P310 GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
4V2 - SF 8 Zinnober 6.0
BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und
für ungehinderte Atmung sorgen. Sofort GIFTINFORMATIONSZEN-
P304+P340+P310 TRUM/Arzt anrufen.
P314 Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Entsorgung Weißer Kanister
(NH4)2Sx - Ammoniumpolysulfid
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
EUH031 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Schutzhandschuhe/Schutz-kleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tra-
P280 gen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit
P305+P351+P338 entfernen. Weiter spülen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen her-
P301+P330+P331 beiführen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontami-
nierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen
P303+P361+P353 oder duschen.
Entsorgung Weißer Kanister
HgS - Quecksilbersulfid
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
EUH031 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tra-
P280 gen.
Entsorgung Weißer Kanister
CH3OH - Methanol
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H301+H311+H331 Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
H370 Schädigt die Organe.
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen
P210 Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen
P210 Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P233 Behälter dicht verschlossen halten.
Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz/
P280 Gehörschutz Tragen.
BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZEN-
P301+P310 TRUM/Arzt anrufen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontami-
P303+P361+P353 nierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen.
BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für unge-
hinderte Atmung sorgen. GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt an-
P304+P340+P311 rufen.
An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen
P403+P233 halten.
Entsorgung Schwarzer Kanister
5V2 - SF 8 Zinnober 7.2
6 Beobachtungen und Bemerkung
Nach Zugabe des Quecksilbersulfids bildete sich ein schwarzer, feiner Niederschlag. Die Lösung
wurde für zweieinhalb Stunden unter Hitze gerührt. Dabei wurde alle 30 min ein weiterer Milliliter
der Ammoniumpolysulfid-Lösung mit einer Pastuer-Pipette zugegeben. Nach zweieinhalb Stunden
war der Niederschlag intensiv rot gefärbt und begann sich an den Seiten zusammenzuballen. Der
Erlenmeyer-Kolben wurde auf Raumtemperatur abgekühlt, anschließend wurde das hergestellte
Zinnober in einem Büchner-Trichter abfiltriert und mit reichlich kaltem Wasser und Methanol
gewaschen. Es wurden 0,35 g eines orange-roten Pulvers erhalten.
7 Auswertung und Diskussion
7.1 Ausbeuteberechnung
Da Ammoniumpolysulfid-Lösung im Überschuss zugegeben wurde, kann die Ausbeute ausgehend
von der zugegebenen Masse an Quecksilber(II)acetat berechnet werden:
mHgS = (0,35 ± 0,01) g (5)
mHgS (0,35 ± 0,01) g
nHgS = = (6)
MHgS 232,652 g mol−1
nHgS = (1,50 ± 0,04) mmol (7)
(8)
mHg(OAc)2 (0,50 ± 0,01) g
nHg(OAc)2 = = (9)
MHg(OAc)2 318,7 g mol−1
nHg(OAc)2 = (1,57 ± 0,03) mmol (10)
(11)
nHgS (1,50 ± 0,04) mmol
Ausbeute = = (12)
nHg(OAc)2 (1,57 ± 0,03) mmol
Ausbeute = (95,89 ± 3,70) % (13)
Es wurde eine Ausbeute von 96 % erreicht. In der Literatur wird für eine vergleichbare Reaktion
von Quecksilberacetat mit Ammoniumthiocyanat eine Ausbeute von 97,8 % beschrieben.7 Damit
stimmt die Ausbeute in etwa mit der Literaturausbeute überein. Die leicht höhere Ausbeute des
Literaturversuchs ist vor allem auf die deutlich größere Ansatzgröße von 35 g zurückzuführen.
7.2 Charakterisierung
7.2.1 Aussehen
Es wurde ein feines, orange-rotes Pulver erhalten: In der Literatur wird die Farbe als rot8 be-
schrieben und stimmt damit mit dem beobachtetem Aussehen überein. Der Farbton Zinnoberrot“
”
ist nach der Farbe des α-HgS benannt, aber in der Literatur nicht eindeutig definiert. Es wurden
Farbwerte von RGB : (247, 66, 52) und RGB : (255, 83, 73)9 in der Literatur gefunden.
Abbildung 2: Vergleich des Farbtons des hergestellten α-HgS und des Farbtons Zinnoberrot“
”
6V2 - SF 8 Zinnober 7.2
Abbildung 1: Synthetisiertes α-HgS
Die hergestellte Verbindung ist mit einem Farbton von RGB : (145, 48, 34) (ermitelt aus dem Foto)
etwas dunkler als die Farbe Zinnoberrot. Der Farbton stimmt aber weitesgehend überein. Die rote
Farbe basiert auf der im α-HgS-Kristall vorliegenden Bandlücke von (2,02 ± 0,05) eV.10
h·c 6,626 · 10−34 Js · 2,9979 · 108 m s−1
λ= = = 612,2 nm (14)
E 2,02 eV
Diese Bandlücke enstpricht einer Wellenlänge von 612,2 nm, was im orangen Bereich des sichtbaren
Spektrums liegt. Licht höherer Energien (kürzerer Wellenlängen) kann absorbiert werden. Damit
wird nur der rote Bereich des Spektrums reflektiert und der Kristall erscheint rot.
7.2.2 Löslichkeit
Die Löslichkeit von α-Quecksilber(II)acetat wurde in Säuren und Basen im kalten als auch im
heißen Zustand sowie in organischen Lösungsmitteln im kalten Zustand überprüft. Dazu wurde
eine Spatelspitze des Komplexes in 1 ml des Lösungsmittels gelöst.
Tabelle 3: Löslichkeit von α-HgS in verschiedenen Lösungsmitteln
Lösungsmittel kalt heiß
H2O unlöslich unlöslich
HCl unlöslich löslich
HNO3 unlöslich teilweise löslich
CH3COOH unlöslich unlöslich
NH3 unlöslich unlöslich
NaOH unlöslich unlöslich
Methanol unlöslich -
Ethanol unlöslich -
Aceton unlöslich -
7V2 - SF 8 Zinnober 7.2
(a) Löslichkeit in Säuren und (b) Löslichkeit in Säuren und (c) Löslichlkeit in organischen
Basen bei Raumtemperatur Basen bei Siedehitze Lösungsmitteln
Abbildung 3: Löslichkeit von α-Quecksilber(II)acetat in verschiedenen Lösungsmitteln
Quecksilbersulfid ist nahezu unlöslich in den meisten Lösungsmitteln. Die Löslichkeit in starken
Säuren ist durch die Protonierung der mit dem HgS im Gleichgewicht stehenden Sulfidionen zu
erklären.
HgS Hg2+ + S2– KL = 4 · 10−53 mol2 l−2 11 (15)
S2– + H+ SH– pKS = 12,98 12 (16)
– + 12
HS + H H2S ↑ pKS = 7,02 (17)
(18)
Da das Löslichkeitsprodukt von HgS mit 4 · 10−53 mol2 l−211 sehr klein ist, ist die Sulfidionenkon-
zentration sehr gering. Deshalb sehr starke Säuren benötigt, werden um das Gleichgewicht auf die
Seite des Schwefelwasserstoffs zu verschieben. Durch eine Temperaturerhöhung wird die Löslichkeit
von Schwefelwasserstoff im Wasser reduziert, dies erniedrigt die Konzentration der mit H2S im
Gleichgewicht stehenden S2–-Ionen, was das Löslichkeitsgleichgewicht nach rechts verschiebt und
so HgS löst.
7.2.3 Herstellung einer Caseinfarbe
Die Herstellung der Caseinfarbe wurde zunächst analog zur beigelegten Beschreibung13 durch-
geführt, resultierte aber in einer relativ dünnen Caseinmischung, welche eine geringe Deckkraft
besaß. Der Versuch wurde daher wiederholt, wobei die Casein-Mischung mit nur 10 ml Wasser
angesetzt wurde und anschließend für sieben Stunden quellen konnte. Dies resultierte in einer ho-
mogeneren und viskoseren Caseinlösung, welche sich besser für die Herstellung einer Farbe eignete.
Zum Vergleich der Caseinfarbe mit dem reinen Partikel wurden zwei identische Flächen mit bemalt:
8V2 - SF 8 Zinnober 7.2
Abbildung 4: Mit Zinnober-Partikelfarbe bemalte Farbflächen: links ohne Casein, rechts mit Casein.
Bei der ersten Fläche wurde eine Spatelspitze α-HgS-Pigment in Wasser, bei der anderen in der
Caseinlösung aufgenommen. Schon während des Malens fiel auf, dass die Casein-Farbe eine deut-
lich höhere Deckkraft zeigte und sich gleichmäßiger auftragen ließ. Nach einer Trockenzeit von fünf
Minuten waren die Ränder der caseinfreien Fläche bereits getrocknet und zeigten eine mittlere Ab-
riebfestigkeit. Die Caseinfarbe war fünf Minuten nach Auftragen noch deutlich feucht und benötigte
ungefähr eine Stunde, um vollständig zu trocknen. Nach einem Tag wurden die Eigenschaften der
beiden Farbflächen getestet: Beim Betrachten war klar ersichtlich, dass die Caseinfarbe die höhere
Deckkraft besitzt. Das Testen der Abriebfestigkeit erfolgte durch Reiben mit dem Finger: Bei der
caseinfreien Farbe war dabei ein deutliches Verschmieren der Kante erkennbar und das abgeriebene
Zinnober an der Fingerkuppe als rote Farbe sichtbar. Die Caseinfarbe veränderte sich beim Reiben
nicht. Zur Prüfung der Wasserfestigkeit wurde mit einem angefeuchteten Pinsel entlang einer Kante
gestrichen. Beide Farbflächen zeigten dabei sehr geringes Verschmieren und besitzen demnach beide
eine gute Wasserbeständigkeit.
7.2.4 Pulverdiffraktogramm
Das Pulverdiffraktogramm wurde online zur Auswertung zur Verfügung gestellt und nicht von der
eigenen Substanz aufgenommen. Die Auswertung kann daher keine Rückschlüsse auf die tatsächliche
Reinheit des Produktes liefern. Zur Auswertung wurde die Software QualX und die pdf2.0 Daten-
bank verwendet.
9V2 - SF 8 Zinnober 7.4
Abbildung 5: Auswertung des Pulverdiffraktogramms in QualX
Das Pulverdiffraktogramm zeigt eine starke Übereinstimmung mit den Peaks von α-HgS, vor al-
lem im Bereich hoher Winkel 2θ. Allerdings lassen sich im Bereich niedriger 2θ zwei Peaks bei
2θ = 26,83° und 2θ = 28,82° nicht zuordnen. Diese Peaks können aber auch durch das Spektrome-
ter oder die Probenaufbringung verursacht sein. Da das Spektrum nicht selbst aufgenommen wurde,
ist darüber allerdings nichts bekannt. Um die Reinheit des hergestellten Zinnobers zu untersuchen
ist es sinvoll, auf das Vorhandensein des kinetisch gebildeten β-HgS zu prüfen. Das Pulverdiffrak-
togramm von Metacinnabarit zeigt weniger Peaks, welche allerdings 2θ-Werte besitzen, die nahe
bei denen des Zinnobers liegen. Es ist daher kaum möglich, die Peaks des Metacinnabarits im Dif-
fraktogramm von denen des Cinnabarits zu unterscheiden. Tendenziell stimmen jedoch die Peaks
des Cinnabarits besser mit den beobachteten überein. Lediglich der Peak bei 2θ = 35,95° deu-
tet eindeutig auf das Vorhandensein von Metacinnabarit hin, da dieser bei reinem Zinnober nicht
auftreten sollte. Aufgrund der geringen Unterscheidbarkeit der beiden Phasen im Pulverdiffrakto-
gramm ist zu erwarten, dass die quantitative Phasenauswertung eine hohe uUnsicherheit besitzt:
Die von der Software vorgeschlagene Phasenverteilung von 63,3 % α-HgS und 36,7 % β-HgS würde
auf ein sichtbar verunreinigtes Produkt hindeuten. Es ist wahrscheinlich, dass der Anteil des β-HgS
von der Software zu hoch eingeschätzt wurde. Dies ließe sich allerdings nur durch Betrachtung des
Produktes feststellen.
7.3 Fehlerdiskussion
Der Versuch wurde zwei Mal durchgeführt, da bei der ersten Durchführung des gebildete Zinnober
mit β-HgS verunreinigt war und daher deutlich dunkler erschien. Der Grund für die Verunrei-
nigung könnte an einer zu kurzen Reaktionszeit oder einer zu niedrigen Heizplattentemperatur
gelegen haben. Auch das zweite hergestellte Produkt zeigte, wie in 7.2.1 diskutiert, eine leichte
Verdunklung im Vergleich zum Farbton Zinnoberrot“, was ebenfalls auf das Vorhandensein von
”
β-HgS zurückzuführen ist. Die Reaktionszeit wurde bei diesem Versuch mit zweieinhalb Stunden
deutlich länger gewählt und die Heizplattentemperatur durch die Verwendung einer genauer regel-
baren Heizplatte präziser eingestellt, weshalb diese als Fehlergründe auszuschließen sind. Wie in
2.3 erläutert, ist es fraglich, ob eine Umwandlung des α-HgS in β-HgS durch optische Anregung
erfolgen kann. Sollte dies der Fall sein könnte das Trocknen im Abzug auf einem Filterpapier zu
der Verunreinigung mit Metacinnabarit geführt haben.
7.4 Diskussion
Die Literaturausbeute7 einer vergleichbaren Reaktion wurde mit 97,8 % angegeben und liegt damit
leicht über der erreichten Ausbeute mit 96 %. Die vorliegende Literaturvorschrift verwendete aber
eine um den Faktor 70 größere Ansatzgröße, was zu geringeren relativen Verlusten und somit
10V2 - SF 8 Zinnober 8.0
zu einer höheren Ausbeute führt. Außerdem wird Ammoniumthiocyanat anstelle des im Versuch
eingesetzten Polysulfids verwendet. Da bei dieser Versuchsdurchführung aber Blausäure entsteht,
ist die Verwendung von Ammoniumpolysulfid sicherer.
Zinnober zeigt eine sehr schlechte Löslichkeit in wässrigen und organischen Lösungen und ist nur in
sehr starken Säuren löslich. Die geringe Löslichkeit sorgt für eine geringe Hg2+-Ionenkonzentration
HgS Hg2+ + S2– KL = 4 · 10−53 mol2 l−2 11 (19)
Die Quecksilberkonzentration ist so gering, dass Zinnober nicht als giftig, sondern nur als reizend
eingestuft wird.14 Damit ist es ein geeigntes Farbpigment in Pigmentfarben, welches auch heute
noch eingesetzt werden kann. Ein weiterer Grund für die Eignung als Farbpigmemt ist der hohe
Brechungsindex von 1,470615 bei einer Wellenlänge von 680 nm, welcher zu einer hohen Deckkraft
führt.
Das bereitgestellte Röntgendiffraktogramm stimmt weitestgehend mit dem Diffraktogramm von
α-HgS überein. Nur ein Peak zeigt das Vorhandensein von β-HgS an.
8 Literatur
Literatur
1. Riedel, E.; Janiak, C. in; De Gruyter: 2011, S. 777, DOI: doi : 10 . 1515 / 9783110225679,
https://doi.org/10.1515/9783110225679.
2. Judy-Azar, A.-R.; Mohebbi, S. Materials Letters 2013, 106, 233–237, DOI: https://doi.
org / 10 . 1016 / j . matlet . 2013 . 04 . 087, https : / / www . sciencedirect . com / science /
article/pii/S0167577X13005612.
3. Sicius, H. in; Springer: 2017, S. 39–44.
4. Noll, W. Chemie in unserer Zeit 1980, 14, 37–43, DOI: https://doi.org/10.1002/ciuz.
19800140202, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ciuz.19800140202.
5. Li, J.; Zhang, B. Journal of Cultural Heritage 2020, 43, 73–79, DOI: https://doi.org/10.
1016/j.culher.2019.12.015, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S1296207419302882.
6. McCormack, J. Mineralium Deposita 2000, 35, 796–798.
7. Schlessinger, G. G. in Inorganic laboratory preparations; Chemical Publ. Co.: New York, 1962,
S. 25–26.
8. Lide, D. R. e. a., CRC handbook of chemistry and physics; CRC press: 2004; Bd. 85, S. 471.
9. Zinnober - HiSoUR Kunst Kultur Ausstellung https://www.hisour.com/de/vermilion-
23679/.
10. Nakada, T. Journal of Applied Physics 1975, 46, 4857–4861, DOI: 10 . 1063 / 1 . 321519,
https://doi.org/10.1063/1.321519.
11. Aylward Gordon H. / Findlay, T. J. V. in, 4. Aufl.; Wiley-VCH: 2014; Kap. Dissoziationskon-
stanten von Säuren und hydratisierten Metallionen, S. 139.
12. Aylward Gordon H. / Findlay, T. J. V. in, 4. Aufl.; Wiley-VCH: 2014; Kap. Löslichkeitsprodukte
bei 25°C, S. 149.
13. Die Herstellung von Caseinfarben Uni Leipig, https://moodle2.uni-leipzig.de/pluginfile.
php/2211697/mod_resource/content/1/Caseinfarben.pdf.
14. GESTIS-Stofdatenbank Quecksilber(II)-sulfid IFA, https://gestis.dguv.de/data?name=
004600.
15. Bond, W.; Boyd, G.; Carter Jr, H. Journal of Applied Physics 1967, 38, 4090–4091.
11Sie können auch lesen