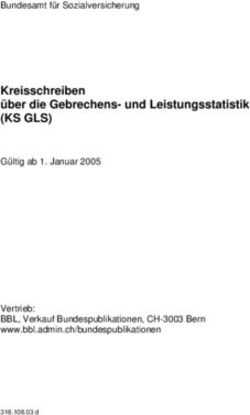Rote Listen Sachsen-Anhalt
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Rote Listen Sachsen-Anhalt
Berichte des Landesamtes
59 Bockkäfer
für Umweltschutz Sachsen-Anhalt
(Coleoptera: Cerambycidae)
Halle, Heft 1/2020: 727–736
Bearbeitet von Volker Neumann, publizierten Arbeiten von Dammer (2017), Lange (2017)
Werner Malchau, Andreas Rössler und und Malchau (2018a, 2018b) mit herangezogen.
Olaf Blochwitz Die Nomenklatur der Arten sowie ihre deutsche
(3. Fassung, Stand: Januar 2019) Bezeichnung folgt Klausnitzer et al. (2016).
Einführung Bemerkungen zu ausgewählten Arten
Für Deutschland führen Köhler & Klausnitzer (1998) Der überwiegende Teil der Cerambyciden hat eine
192 Bockkäferarten auf, wovon 20 der Bestätigung xylobionte Lebensweise. Nur verhältnismäßig wenige
bedürfen. Zur indigenen Fauna Sachsen-Anhalts Arten leben phytophag, meist oligophag an krautigen
gehören 137 Arten – einschließlich von 22 als alloch- Pflanzen. Eine Übersicht über die Entwicklung der
thon eingestuften erhöht sich die Artenzahl auf 159 Bockkäfer geben u. a. von Demelt (1966), Bense (1995)
(Neumann & Malchau 2016). Die Zahl der indigenen und Klausnitzer et al. (2016).
ist jedoch vermutlich höher einzuschätzen. In dem Über die Gründe zur Aufnahme von Rosalia alpina
Versuch, den tatsächlichen Artenbestand von den und Trichoferus pallidus in die Rote Liste Sachsen-An-
faunenfremden Elementen zu trennen, ist die Subjek- halts berichteten Neumann (2004) und Neumann &
tivität in der Wertigkeit der angegebenen Nachweise Malchau (2016).
als Fehlerquelle mit enthalten. Dies betrifft die Ein- Gegenüber der Roten Liste 2004 wird aktuell
schätzung und Wertung z. B. von Chlorophorus varius, Pedostrangalia pubescens nicht mehr aufgeführt,
Corymbia (Leptura) fulva oder Saphanus piceus, wo da die von Borchert (1951) erwähnten Harz-Fundor-
andere Autoren durchaus unterschiedliche Ansichten te sich nach nochmaliger Prüfung der Datenlage in
vertreten (s. z. B. Jung 2017). Agapanthia intermedia Niedersachsen befinden (Neumann & Malchau 2016).
wurde bisher als Varietät von A. violacea geführt. Wiederfunde und Artbestätigungen ergaben sich
Durch die Abtrennung von A. intermedia als eigene seit Neumann (2004) für Anastrangalia dubia (Malchau
Art bestehen Unklarheiten über die Verbreitung von & Neumann 2012), Chlorophorus herbstii (Bäse 2008),
A. violacea und A. intermedia in Sachsen-Anhalt, weil Chlorophorus sartor (Bäse & Malchau 2011), Pachyta
Sama (2002) ein sympatrisches Vorkommen beider quadrimaculata (Neumann 2016) und Ropalopus varini
Arten annimmt. Die wenigen eigenen Funde aus (syn. spinicornis) (mündl. Mitt., O. Blochwitz 2014).
Sachsen-Anhalt gehören der Art A. intermedia an. Wallin, Nylander & Kvamme (2009) trennten Leio-
Gegenüber der Roten Liste 2004 wird nunmehr A. pus linnei von L. nebulosus ab. Diese veränderte Si-
intermedia für A. violacea aufgeführt. Es bleibt weite- tuation führte zu Aufarbeitungsdefiziten und somit
ren Untersuchungen vorbehalten, ob beide Arten in kann das Vorkommen und die Verbreitung beider
Sachsen-Anhalt vertreten sind. Als faunenfremde Art Arten in Sachsen-Anhalt zurzeit nicht exakt einge-
hat sich seit über einem Jahrzehnt in Magdeburg und schätzt werden. Sie werden in der Roten Liste mit
Umgebung der Asiatische Laubholzbockkäfer Anoplo- defizitärer Datenlage aufgenommen. Auch bei Ste-
phora glabripennis Motschulsky, 1853 angesiedelt. nostola dubia und S. ferrea fehlen exakte Angaben
Trotz intensiver Bekämpfungsmaßnahmen (Baumfäl- zu Vorkommen und Verbreitung, deshalb wird die
lungen) gelang es bisher nicht, die Art wieder aus- genaue Datenlage auch hier wie bereits in der Roten
zurotten. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Art sich Liste 2004 als „defizitär“ eingeschätzt.
dauerhaft in Sachsen-Anhalt etabliert oder sie wieder Nüssler (1976) handelt die boreomontanen Spe-
ausgelöscht wird. A. glabripennis wurde und ist im zies der neuen Bundesländer für unser Faunengebiet
Artenspektrum bisher nicht berücksichtigt. ab, Neumann & Händel (2010) geben eine ausführliche
Übersicht für Sachsen-Anhalt. Saxesen (1834) be-
Datengrundlagen schreibt für Oxymirus cursor ein vereinzeltes Vorkom-
men im Oberharz an. Inzwischen ist dieser Bockkäfer
Zur Einschätzung des gegenwärtigen Artenbestandes durch das Fichtenabsterben und den damit großen
und der Gefährdungssituation der Bockkäfer wurden Totholzanteil im Harz häufiger geworden.
Daten einer Datenbank herangezogen, die sich haupt- Zu den phytophag bzw. von Wurzeln lebenden
sächlich aus Angaben von EVSA-Mitgliedern, aus Arten zählt der Erdbock Iberodorcadion fuliginator.
Sammlungsauswertungen von Museen und der Zen- Er ist eine Charakterart von Trockenstandorten, der
tralen Naturkundlichen Sammlung der Universität im Mittelelbegebiet seine östliche Verbreitungsgren-
Halle-Wittenberg sowie Literaturauswertungen von ze erreicht. Lokal ist eine rückläufige Bestandsent-
lokalen faunistischen Erhebungen (Literaturauswer- wicklung zu verzeichnen (z. B. Halle/S. und Umfeld).
tung bis 2016: Neumann & Malchau 2016) zusammen- Nach Horion (1974) ist jeder Fundort dieses Käfers
setzt. Zur Auswertung wurden zudem die nach 2016 publikationswürdig.
727Bockkäfer
Gefährdungsursachen und erforderliche bisher stabilen Populationen zu finden. Der Schutz
Schutzmaßnahmen und eine Gestaltung entsprechender Biotope ist un-
bedingt notwendig. Winter & Nowak (2001) erklären
Die xylobionten Bockkäferarten entwickeln sich in die hohe Bedeutung von Totalreservaten für an Alt-
Holz verschiedener Zerfallsstadien (Klausnitzer 1994). und Totholz gebundene Lebensgemeinschaften. Dies
Viele Arten zeigen einen ausgesprochen hohen Spe- erfordert auch ein Umdenken in der Durchführung
zialisierungsgrad hinsichtlich der Habitatansprüche. forstwirtschaftlicher und baumchirurgischer Sanie-
”Neben einer oft sehr ausgeprägten Abhängigkeit von rungsmaßnahmen im Siedlungs- und Erholungs-
verschiedenen abiotischen Faktoren im Brutsubstrat bereich des Menschen. Besonders bei alten Bäumen
kommt bei zahlreichen xylobionten Käfern eine ganz „erwächst dem Gesetzgeber durch Änderung der
spezifische Anpassung an die Entwicklungspflanze Haftungspraxis für herabfallende Holzteile eine sehr
(Baum- oder Strauchart) ...” hinzu (Bense 1992). Diese dringende Aufgabe“…(Geiser 1981).
differenzierte Lebensweise bewirkt eine oft sehr Verkehrswegebau, Bebauung, Zersiedlungsmaß-
empfindliche Reaktion auf Veränderungen im Lebens- nahmen, Agrartechnik, Biozideinsatz, Fallenwirkung
raum, die sich in der Gefährdungssituation wider- nächtlicher Beleuchtungsquellen, Straßentod, die
spiegelt. Mitunter entwickeln sich die Käfer in Holz, Entfernung von Alleen, Feldgehölzen, Deichbäumen,
besuchen dann aber zur Ernährung (pollenophag) Hecken und Streuobstwiesen, Ödlandflächen und
und zum Treffen der Geschlechter Blüten. Phytophage großräumige Landschaftszerstörung sind wesentliche
Arten entwickeln sich in krautigen Pflanzen. Deshalb Gefährdungsursachen. Ausführlich gehen auf diese
haben Waldwiesen, Randhabitate oder Ödlandflä- Problematik u.a. Geiser (1980, 1981) sowie Möller &
chen mit blühenden Pflanzen, Sträuchern und Rand- Schneider (1992) ein.
bäumen Bedeutung zum Erhalt solcher Arten. Mit Ausnahme von Hylotrupes bajulus, Monocha-
Für viele Bockkäferarten sind gut strukturierte mus spp. und Tetropium spp. gehören die Bockkäfer
Altholzbestände mit hohem Totholzanteil und Be- nach der „Verordnung zum Erlass von Vorschriften
reiche mit entsprechender Sonnenexposition für die auf dem Gebiet des Artenschutzes…“ vom 21.10.1999
Entwicklung lebensnotwendig. So stellen ehemalige zu den „besonders geschützten Arten“ und davon
Hutewälder, Parkanlagen, Alleen, Baumgruppen und Cerambyx cerdo, Necydalis major, Necydalis ulmi und
auch Einzelbäume essentielle Refugien dar. Einige Rosalia alpina zu den „streng geschützten Arten“ der
Arten sind Anzeiger von noch vorhandenen reliktären Bundesrepublik Deutschland.
Restbiotopen der ehemaligen Urwald-Xylobionten- Durch besseren Kenntnisstand zum Vorkommen
fauna (Geiser 1992). Sie finden in den jungen Wirt- der Arten (u. a. durch neue und verbesserte Fang-
schaftswäldern kaum Entwicklungsmöglichkeiten. Ein techniken), klimatischen und systematischen Verän-
Vorkommen von „Reliktarten” ist ein wichtiger Beweis derungen ergaben sich auch Veränderungen in der
für eine lückenlose, weit zurückgehende Biotoptra- Einschätzung des Gefährdungsgrades der in Sachsen-
dition...” (Bense 1992). Als ein Refugium solcher Arten Anhalt nachgewiesenen Bockkäferarten gegenüber
hat sich das Biosphärenreservat „Flusslandschaft der Roten Liste 2004. So werden gegenwärtig die
Mittelelbe“ und die „Colbitz-Letzlinger Heide“ mit Arten Anastrangalia sanguinolenta, Aromia moscha-
ihren Alteichenbeständen und Solitäreichen erwie- ta, Pedostrangalia pubescens, Pogonocherus hispidus,
sen (Kühnel & Neumann 1977, Jung 2015, Neumann et Prionus coriarius und Pyrrhidium sanguineum als nicht
al. 2015). So entwickeln sich in der Wurzel-, Stamm- gefährdet beurteilt, dagegen wurden Arhopalus ferus,
und Wipfelregion von Eichen hier u.a. noch Cerambyx Saperda populnea und Saperda scalaris in die Rote
cerdo, Akimerus schäfferi, Axinopalpis gracilis und Liste neu aufgenommen. In der aktuellen Roten Liste
Phymatodes pusillus. In den Gebieten ist ein Großteil erscheinen nunmehr von den 137 indigenen Arten
der in Sachsen-Anhalt bekannten Bockkäferarten in Sachsen-Anhalts 108 (78,8 %)!
Tab. 1: Übersicht zum Gefährdungsgrad der Bockkäfer Sachsen-Anhalts.
Gefährdungskategorie Rote Liste Gesamt
0 R 1 2 3
Artenzahl (absolut) 16 - 30 28 29 103 137
Anteil an der Gesamtartenzahl (%) 11,7 - 21,9 20,4 21,2 75,2
728Bockkäfer
1 2
3 4
5 6
Abb. 1: In lebenden Eichen entwickelt sich mehrjährig der Heldbock (Cerambyx cerdo) in Mitteleuropa. Neben dem Mulmbock (Ergates
faber) ist er mit über 50 mm Länge der größte heimische Bockkäfer. Die Abbildung zeigt einen männlichen Heldbock-Käfer neben einem
Schlupfloch (Foto: V. Neumann). Abb. 2: Nach einem Fraß in abgestorbenen Eichenwurzeln oder verrottenden Ästen nahe der Erdoberflä-
che überwintert das letzte Larvenstadium des Eichen-Tiefaugenbockes (Cortodera humeralis) im Boden. Die Käfer besuchen im Mai bis
Juni Blüten (oft Weißdorn). Die einjährige Entwicklung erfolgt auch in Prunus (Fam. Rosengewächse Rosaceae) (Foto: D. Rolke). Abb. 3: Die
Imagines des Gemeinen Zimmerbockes (Acanthocinus aedilis) überwintern nach einer ein- bis zweijährigen Entwicklung unter der Rinde
ihrer Brutbäume (abgestorbene Nadelholzstämme, meist Kiefer). Durch Aneinanderreiben von Halsschild und Thorax können sie zirpende
Laute erzeugen (Foto: K. Neumann). Abb. 4: Der Messerbock (Axinopalpis gracilis) ist eine akrodendrische Art. Sie entwickelt sich vorrangig in
abgestorbenen Eichenzweigen, aber auch in anderen Laubhölzern. Der deutsche Name des verhältnismäßig kleinen Bockkäfers (5 – 12 mm)
rührt von dem großen messerförmig ausgebildeten Kiefertastenendglied her. (Foto: K. Neumann). Abb. 5: Der Schwarzrandige Halsbock (Ana-
strangalia dubia) entwickelt sich in totem Nadelholz. Die Generationsdauer beträgt mindestens zwei Jahre. In Sachsen-Anhalt erstreckt sich
die Verbreitung des Schwarzrandigen Halsbockes auf einen kleinen Bereich im Harz (Foto: V. Neumann). Abb. 6: Der Metallische Scheibenbock
(Callidium aeneum) entwickelt sich hauptsächlich unter der Rinde toter dünner Nadelholzäste und -stämme (Foto: K. Neumann).
729Bockkäfer
Tab. 2: Übersicht zur Einstufung in die sonstigen Kategorien der Roten Liste.
Kategorien Sonstige Gesamt Gesamt
G D V
Artenzahl (absolut) - 4 1 5 137
Anteil an der Gesamtartenzahl (%) - 2,9 0,7 3,6
Tab. 3: Änderungen in der Anzahl der Einstufungen in die Gefährdungskategorien im Vergleich der Roten Listen der Bockkäfer Sachsen-An-
halts aus den Jahren 2004 und 2020.
Rote Liste 2004 Rote Liste 2020
Gefährdungskategorie
(AZ = 136) (AZ = 137)
(absolut) (%) (absolut) (%)
0 – Ausgestorben oder verschollen 20 14,7 16 11,7
R – Extrem seltene Arten mit geographischer
- - - -
Restriktion
1 – Vom Aussterben bedroht 28 20,6 30 21,9
2 – Stark gefährdet 23 16,9 28 20,4
3 – Gefährdet 31 22,8 29 21,2
Gesamt 102 75,0 103 75,2
Art (wiss.) Art (deutsch) Kat. Bem.
Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758) Gemeiner Zimmerbock V § BA
Acanthocinus griseus (Fabricius, 1792) Braunbindiger Zimmerbock 2 § BA
Acmaeops marginatus (Fabricius, 1781) Gelbrandiger Kugelhalsbock 1 § BA
Acmaeops pratensis (Laicharting, 1784) Gelbbrauner Kugelhalsbock 0 § BA, 1974 01)
Aegomorphes (Acanthoderes) clavipes (Schrank, 1781) Scheckenbock 2 § BA
Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1884 1 § BA
Akimerus schaefferi (Laicharting, 1784) Breitschulterbock 1 § BA
Anaesthetis testacea (Fabricius, 1781) Kragenbock 1 § BA
Anastrangalia dubia (Scopoli, 1763) Schwarzrandiger Halsbock 1 § BA, 1974
Anisarthron barbipes (Schrank, 1781) Rosthaar-Bock 1 § BA, 1966 06)
Anisorus (Stenocorus) quercus (Goetz, 1783) Schwarzer Buntschienenbock 2 § BA
Anoplodera rufipes (Schaller, 1783) Rotbeiniger Halsbock 3 § BA
Anoplodera sexguttata (Fabricius, 1775) Sechstropfiger Halsbock 3 § BA
Arhopalus ferus (Mulsant, 1839) Schwarzbrauner Halsgrubenb. 2 § BA
Asemum striatum (Linnaeus, 1758) Düsterbock 3 § BA
Axinopalpis gracilis (Krynicki, 1832) Messerbock 1 § BA
Callidium aeneum (Degeer, 1775) Metallischer Scheibenbock 3 § BA
Callidium coriaceum Paykull, 1800 Fichten-Scheibenbock 0 § BA, 1974 01)
Abb. 7: Die Larve des Wendekreis-Widderbockes (Clytus tropicus) entwickelt sich unter der Rinde abgestorbener Stämme und dicker Äste
(besonders in der Wipfelregion) von Laubhölzern (meist Eiche). An den Brutbäumen halten sich auch die Käfer auf (Foto: K. Neumann). Abb.
8: Die einjährige Entwicklung des Rüstern-Wimpernhornbockes (Exocentrus punctipennis) findet unter der Rinde dünner abgestorbener
Ulmenzweige statt, Angaben von anderen Laubhölzern sind zweifelhaft. Der Käfer ist nachtaktiv (Foto: K. Neumann). Abb. 9: Der Grünlichgel-
be Wespenbock (Chlorophorus herbstii) wird in Sachsen-Anhalt nur sporadisch und selten gefunden. Die wärmeliebende Art entwickelt sich
mehrjährig in abgestorbenen Laubholzzweigen, vorrangig von Linde. Die Käfer sind Blütenbesucher (Foto: P. Bornand). Abb. 10: Vom Bleichen
Alteichen-Nachtbock (Trichoferus pallidus) besteht in Sachsen-Anhalt nur ein kleines begrenztes Vorkommen. Der nachtaktive Käfer ist hier
an alten absterbenden Eichen zu finden, welche meist auch eine Besiedlung des Heldbockes (Cerambyx cerdo) aufweisen (Foto: V. Neumann).
Abb. 11: Der thermophile Dolden-Kurzdeckenbock (Glaphyra umbellatarum) ist ein Blütenbesucher, entwickelt sich aber zweijährig unter
der Rinde von Ästen und dünnen Stämmen von Laubhölzern. Die Käfer fliegen an künstliches Licht (Foto: P. Bornand). Abb. 12: Der Blaubock
(Gaurotes virginea) ist eine Art der montanen Nadelholzwälder, deshalb erstreckt sich in Sachsen-Anhalt seine Verbreitung über das Harz-
gebiet. Die Käfer entwickeln sich zweijährig unter der losen Rinde besonnter stehender und liegender Stämme von vorwiegend Fichten und
Kiefern. Die Larven überwintern im Boden. Nach der Verpuppung im Frühjahr suchen die Käfer Blüten auf (Foto: S. Schönebaum). Abb. 13: Die
einjährige Entwicklung des Lärchen-Splintbockes (Tetropium gabrieli) vollzieht sich nahezu ausschließlich in Lärche (monophage Art). Hier
entwickeln sich die Larven unter der Rinde von kränkelnden und gerade abgestorbenen Stämmen und Starkästen. Der dämmerungs- und
nachtaktive Käfer ist an den Brutbäumen vorzufinden (Foto: A. Rössler). Abb. 14: Der Achtfleckige Augenfleckenbock (Mesosa curculionoides)
ist eine polyphage Art alter Laubwälder, besonders von wärmebegünstigten Alteichenbeständen. Hier fressen die Larven in ihrer zwei- bis
dreijährigen Entwicklung unter der Rinde von starken abgestorbenen Ästen und im Holz von Stämmen (Foto: D. Rolke).
730Bockkäfer
8
7
9
10
11 12
13 14
731Bockkäfer Art (wiss.) Art (deutsch) Kat. Bem. Callidium violaceum (Linnaeus, 1758) Blauer Scheibenbock 3 § BA Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 Heldbock 1 § FFH II/IV, BK Cerambyx scopolii Fuesslins, 1775 Kleiner Spießbock 3 § BA Chlorophorus herbstii (Brahm, 1790) Grünlichgelber Wespenbock 1 § BA, 1974 01) Chlorophorus sartor (Müller, 1766) Weißbindiger Wespenbock 1 § BA, 1974 01) Chlorophorus varius (Müller, 1766) Variabler Wespenbock 0 § BA, 1974 01) Clytus tropicus (Panzer, 1795) Wendekreis-Widderbock 2 § BA Cortodera femorata (Fabricius, 1787) Schwarzer Tiefaugenbock 2 § BA Cortodera humeralis (Schaller, 1783) Eichen-Tiefaugenbock 3 § BA Ergates faber (Linnaeus, 1767) Mulmbock 2 § BA Evodinus clathratus (Fabricius, 1792) Rostbeiniger Fleckenbock 2 § BA Exocentrus adspersus Mulsant, 1846 Weißgefleckter Wimperhorn-Bock 3 § BA Exocentrus lusitanus (Linnaeus, 1767) Linden-Wimperhornbock 2 § BA Exocentrus punctipennis Muls. et Guill., 1856 Rüstern-Wimperhornbock 1 § BA Gaurotes virginea (Linnaeus, 1758) Blaubock 3 § BA Glaphyra (Molorchus) kiesenwetteri Mulsant et Rey, 1861 0 § BA, 1974 01) Glaphyra (Molorchus umbellatarum (Schreber, 1759) Dolden-Kurzdeckenbock 3 § BA Grammoptera abdominalis (Stephens, 1831) Schwarzer Blütenbock 1 § BA Grammoptera ustulata (Schaller, 1783) Eichen-Blütenbock 3 § BA Hylotrupes bajulus (Linnaeus, 1758) Hausbock 3 Iberodorcadion (Dorcadion) fuliginator (Linnaeus, 1758) Grauflügliger Erdbock 2 § BA Judolia sexmaculata (Linnaeus, 1758) Sechsfleckiger Halsbock 1 § BA, 2000 02) Lamia textor (Linnaeus, 1758) Weberbock 1 § BA Leiopus linnei Wallin, Nylander et Kvamme, 2009 Linne’s Splintbock D § BA Leiopus nebulosus (Linnaeus, 1758) Rosthörniger Splintbock D § BA Leiopus punctulatus (Paykull, 1800) Schwarzhörniger Splintbock 0 § BA, 1974 01) Leptura aethiops Poda, 1761 Schwarzer Halsbock 2 § BA Leptura annularis Fabricius, 1801 Bogenförmiger Halsbock 2 § BA Menesia bipunctata (Zoubkoff, 1829) Zweipunktiger Kreuzdornbock 1 § BA Mesosa curculionides (Linnaeus, 1761) Achtfleckiger Augenfleckenbock 1 § BA Mesosa nebulosa (Fabricius, 1781) Binden-Augenfleckenbock 3 § BA Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1795) Bäckerbock 2 Monochamus sutor (Linnaeus, 1758) Schusterbock 0 1974 01) Necydalis major Linnaeus, 1758 Großer Wespenbock 1 § BA Necydalis ulmi Chevrolat, 1838 Panzers Wespenbock 0 § BA, 1974 01) Nothorhina punctata (Fabricius, 1798) Trommler 0 § BA, 1974 01) Oberea erythrocephala (Schrank, 1776) Rotköpfiger Linienbock 1 § BA Oberea linearis (Linnaeus, 1761) Haselbock 2 § BA Oberea oculata (Linnaeus, 1758) Rothalsiger Linienbock 2 § BA Abb. 15: Der Graue Espenbock (Rusticoclytus (Xylotrechus rusticus) ist eine polyphage Laubholzart, welche sich in Sachsen-Anhalt meist in wärmebegünstigten absterbenden und abgestorbenen (umgestürzten) Stämmen von Pappelarten entwickelt. (Foto: P. Bornand). Abb. 16: Vorzugsweise in und unter der Rinde abgestorbener trockener Nadelholzäste und Stämme (auch Brennholz) entwickelt sich der poly- phage Blaue Scheibenbock (Callidium violaceum). Die flachen, breiten Larvenfraßgänge sind wie bei allen Callidium-Arten mit Fraßmehl und Kot gefüllt. Zum Ende der Entwicklung fertigt die Larve einen hakenförmigen Gang senkrecht in das Holz mit Puppenwiege an. Die Entwicklungszeit beträgt gewöhnlich zwei Jahre (Foto: S. Schönebaum). Abb. 17: Vorwiegend in morschen Nadelholzstümpfen und Stäm- men entwickelt sich meist zweijährig der polyphage Zweibindige Zangenbock (Rhagium bifasciatum). Die Larven zersetzen Totholz (Foto: S. Schönebaum). Abb. 18: Der Hakenfleckige Pappelbock oder Leiterbock (Saperda scalaris) hat seinen deutschen Namen nach dem Muster seiner Deckflügel (Elytren). Die polyhage Laubholzart entwickelt sich mehrjährig in krankem und totem Holz (Foto: V. Neumann). Abb. 19: Vom monophagen Rothalsigen Linienbock (Oberea oculata) fressen Larven und Käfer an verschiedenen Weidenarten. Die Larven entwickeln sich in lebenden dünnen Zweigen. Der weibliche Käfer nagt zwei Querfurchenreihen in die Rinde. An der Basis der Querreihen wird ein Eiloch vorbereitet, darin wird ein Ei abgelegt. Durch Wucherungen der Querreihen wird das Eiloch erreicht. Die Larven fressen zunächst das Wucherungsgewebe und später im Markkanal der Zweige. Nach ein- bis zwei Jahren wird eine runde Kammer dicht unterhalb der Rinde an- gelegt, wo die Verpuppung erfolgt (Foto: S. Schönebaum). Abb. 20: Der Schwarzer Buchtschienenbock (Anisorus (Stenocorus) quercus) ist eine wärmeliebende polyphage Laubholzart, welche Eiche bevorzugt. Die Larven leben an abgestorbenen Wurzeln, die Verpuppung geschieht im Boden. Hier erfolgt in einer Puppenkammer auch die Überwinterung der Puppe. Die Käfer sind auf der Bodenvegetation, auf Gehölzen oder auf Blüten zu finden (Foto: V. Neumann). 732
Bockkäfer
15 16
18
17
19 20
733Bockkäfer
Art (wiss.) Art (deutsch) Kat. Bem.
Oberea pupillata (Gyllenhal, 1817) Geißblatt-Linienbock 0 § BA
Obrium brunneum (Fabricius, 1792) Rostbeiniger Flachdeckenbock 3 § BA
Obrium cantharinum (Linnaeus, 1767) Dunkelbein. Flachdeckenb.. 1 § BA
Oplosia cinerea (Paykull, 1800) Lindenbock 1 § BA
Oxymirus cursor (Linnaeus, 1758) Schulterbock 2 § BA
Pachyta lamed (Linnaeus, 1758) Schwarzrandig. Vierfleckbock 0 § BA, 1974 01) 03)
Pachyta quadrimaculata (Linnaeus, 1758) Vierfleckbock 2 § BA
Pedostrangalia revestita (Linnaeus, 1767) Rotgelber Buchen-Halsbock 1 § BA
Phymatodes rufipes (Fabricius, 1776) Rotbeiniger Scheibenbock 1 § BA
Phytoecia cylindrica (Linnaeus, 1758) Zylindrischer Walzenhalsbock 3 § BA
Phytoecia icterica (Schaller, 1783) Pastinakböckchen 2 § BA
Phytoecia nigricornis (Fabricius, 1781) Schwarzhörniger Walzenhals- 3 § BA
Bock
Phytoecia pustulata (Schrank, 1776) Schafgarben-Walzenhalsbock 1 § BA
Poecilium (Phymatodes) alni (Linnaeus, 1767) Zweibindiger Schönbock 3 § BA
Poecilium (Phymatodes) pusillum (Fabricius, 1787) Kleiner Scheibenbock 1 § BA
Pidonia lurida (Fabricius, 1792) Schnürhalsbock 2 § BA
Pogonocherus decoratus Fairmaire, 1855 Kiefern-Wipfelbock 2 § BA
Pogonocherus fasciculatus (Degeer, 1775) Kiefernzweigbock 3 § BA
Pogonocherus hispidulus (Piller, 1783) Doppeldorniger Wipfelbock 3 § BA
Pogonocherus ovatus (Goeze, 1777) Büschelflecken-Wipfelbock. 0 § BA, 1974 01)
Rhagium bifasciatum Fabricius, 1775 Zweibindiger Zangenbock 3 § BA
Rhagium sycophanta (Schrank, 1781) Eichen-Zangenbock 3 § BA
Rhamnusium bicolor (Schrank, 1781) Weidenbock 1 § BA
Ropalopus clavipes (Fabricius, 1775) Dornhörniger Rindenbock 0 § BA, 1974 01)
Ropalopus femoratus (Linnaeus, 1758) Rotschenkliger Rindenbock 2 § BA
Ropalopus varini (Bedel, 1870) Dornhörniger Scheibenbock 1 § BA, 1974 01)
Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) Alpenbock 0 § FFH II/IV, BK,
1954 04)
Rusticoclytus (Xylotrechus) pantherinus (Savenius, 1825) Panther-Holzwespenbock 1 § BA
Rusticoclytus (Xylotrechus) rusticus (Linnaeus, 1758) Grauer Espenbock 3 § BA
Saperda carcharias (Linnaeus, 1758) Großer Pappelbock 2 § BA
Saperda octopunctata (Scopoli, 1772) Achtpunktiger Pappelbock 0 § BA, 1974 01)
Saperda perforata (Pallas, 1773) Gefleckter Pappelbock 1 § BA
Saperda populnea (Linnaeus, 1758) Kleiner Pappelbock 3 § BA
Saperda punctata (Linnaeus, 1767) Vielpunktiger Pappelbock 1 § BA
Saperda scalaris (Linnaeus, 1758) Hakenfleckiger Pappelbock 3 § BA
Saperda similis Laicharting, 1784 Mittlerer Pappelbock 0 § BA, 1974 01)
Stenocorus meridianus (Linnaeus, 1758) Stubbenbock 3 § BA
Stenopterus rufus (Linnaeus, 1767) Roter Spitzdeckenbock 2 § BA
Stenostola dubia (Laicharting, 1784) Metallfarbener Lindenbock D § BA
Stenostola ferrea (Schrank, 1776) Schwarzer Lindenbock D § BA
Stenurella nigra (Linnaeus, 1758) Glänzend Schwarzer Halsbock 3 § BA
Stictoleptura (Corymbia) fulva (Degeer, 1775) Schwarzspitziger Halsbock 0 § BA, 1974 01)
Stictoleptura (Corymbia) scutellata (Fabricius, 1781) Haarschildiger Halsbock 2 § BA
Stictoleptura (Corymbia) maculicornis (Degeer, 1775) Fleckenhörniger Halsbock 3 § BA
Strangalia attenuata (Linnaeus, 1758) Grubenhörniger Halsbock 2 § BA
Tetropium fuscum (Fabricius, 1787) Brauner Fichtensplintbock 2
Tetropium gabrieli Weise, 1905 Lärchen-Splintbock 3
Tetrops starkii Chevrolat, 1859 Stark’s Pflaumenbock 2 § BA
Trichoferus pallidus (Olivier, 1790) Bleicher Alteichen-Nachtbock 1 § BA, 2001 05)
Xylotrechus antilope (Schönherr, 1817) Zierlicher Holzwespenbock 3 § BA
Xylotrechus arvicola (Olivier, 1795) Sauerkirschen-Holzwespenbock 2 § BA
Nomenklatur und deutsche Namen nach Klausnitzer et al. (2016).
734Bockkäfer
Abkürzungen und Erläuterungen, letzter Nachweis/Quelle IV – Art im Anhang IV aufgeführt, FFH V – Art im
(Spalte „Bem.“) Anhang V aufgeführt
WRRL - EG-Wasserrahmenrichtlinie
§ - Gesetzlicher Schutz nach § 7 (2) Nr. 13 u. 14 Bun-
BA - Bundesartenschutzverordnung
desnaturschutzgesetz bezüglich Anhang A und B
BK - Berner Konvention; BK (fett) streng geschützte
der EG-VO Nr. 338/97, FFH-Richtlinie Anhang IV,
Art
Vogelschutz-Richtlinie (Europäische Vogelarten)
ST - Sachsen-Anhalt
und Bundesartenschutzverordnung Anlage 1: 01)
- ältere Nachweise nach Horion (1974)
§ – besonders geschützte Art: EG-VO Anhang A 02)
- Neumann, Trost & Pietsch (2003)
und B (EG A, EG B), FFH Anhang IV, Europäische 03)
- ältere Nachweise nach Nüssler (1976)
Vogelarten (VR) und BA Anlage 1; § – (fett) streng 04)
- ältere Nachweise nach Weckwerth (1954) und
geschützte Art: EG-VO Anhang A (EG A), FFH An-
Horion (1974)
hang IV und BA Anlage 1, Kreuz in Spalte 3 05)
- Neumann & Schmidt (2001)
FFH - FFH-Richtlinie 92/43/EWG der EU: FFH II – Art 06)
- 16.06.1966 1 Ex., 19.06.2000 1 Ex. Freyburg/U.,
im Anhang II aufgeführt, * – Prioritäre Art, FFH
leg. M. Huth
Literatur
Bäse, W. (2008): Die Käfer des Wittenberger Raumes. Horion, A. (1974): Faunistik der mitteleuropäischen
Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Käfer. Bd.12: Cerambycidae. – Überlingen.
Dessau 20: 3–500 Horion, A. (1975): Nachtrag zur Faunistik der mittel-
Bäse, W. & W. Malchau (2011): Nachweise von Chlo- europäischen Cerambyciden (Col.). – Nachrichten-
rophorus sartor (Müller, 1766) in Sachsen-Anhalt blatt der bayerischen Entomologen 24: 97–115.
(Col., Cerambycidae). ‒ Entomologische Mitteilun- Jung, M. (2015): Die Käfer (Coleoptera) der Col-
gen Sachsen-Anhalt 19 (1), 31–33. bitz-Letzlinger Heide. S. 267–289. In: Entomo-
Bense, U. (1992): Methoden der Bestandserhebung logen-Vereinigung Sachsen-Anhalt: Beiträge zur
von Holzkäfern. – In: Trautner, J. (Hrsg.): Arten- Naturausstattung der Colbitz-Letzlinger Heide. –
u. Biotopschutz in der Planung: Methodische Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt. SH
Standards zur Erfassung von Tierartengruppen. – 2015: 418 S., Schönebeck.
Weikersheim. Jung, M. (2017): Saphanus piceus (Laicharting, 1784) –
Bense, U. (1995): Bockkäfer. Illustrierter Schlüssel zu ein Nachweis des Schwarzen Bergbockes in Sach-
den Cerambyciden und Vesperiden Europas. – sen-Anhalt (Coleoptera, Cerambycidae). – Entomo-
Weikersheim. logische Mitteilungen Sachsen-Anhalt 25 (2): 78.
Borchert, W. (1951): Die Käferwelt des Magdebur- Klausnitzer, B. (1994): Die Bedeutung von Totholz für
ger Raumes. – Magd. Forsch. Bd. II (Hrsg.): Rat d. die Erhaltung xylobiontischer Insekten speziell
Stadt Magdeburg, Mitteldt. Druck- & Verlagsanst. der Cerambycidae in der Oberlausitz. – Berichte
GmbH Halle (Saale). der naturforsch. Gesellschaft der Oberlausitz, 3:
Dammer, J. (2017): Nachweis von Tetropium gabrieli 51–56.
(Weise, 1905) (Coleoptera, Cerambycidae) im Land- Klausnitzer, B., U. Klausnitzer, E. Wachmann & Z. Hromadko
kreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt. – Entomologi- (2016): Die Bockkäfer Mitteleuropas. Bd. 2. – Die
sche Mitteilungen Sachsen-Anhalt 25(2): 104. Neue Brehm-Bücherei Bd. 499. 3. Aufl., VerlagsKG
Demelt, C. von (1966): Die Tierwelt Deutschlands. II. Wolf., 692 S.
Bockkäfer oder Cerambycidae. – Jena. Sama, G. (2002): Atlas of the Cerambycidae of Europe
Feuerstacke, R. (1913): Verzeichnis der in der Umge- and the Mediterranean Area, Volume I. – Naklada-
bung Magdeburgs aufgefundenen Cerambycidae. telstvi Kabourek, Zlin, 173 S.
– Mitteilungen aus d. Entomol. Ges. zu Halle/S., Köhler, F. & B. Klausnitzer (Hrsg.) (1998): Entomofauna
3/4: 75–88. Germanica – Verzeichnis der Käfer Deutschlands. –
Geiser, R. (1980): Grundlagen und Maßnahmen zum Ent. Nachr. Ber., Beiheft 4: 1–185.
Schutz der einheimischen Käferfauna. – Schrif- Kühnel, H. & V. Neumann (1977): Zum gegenwärtigen
tenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz Vorkommen ausgewählter Käferfamilien im Ge-
(Bonn-Bad Godesberg) 12: 71–80. biet um Köthen, Bezirk Halle. 1. Mitteilung: Bock-
Geiser, R. (1981): Artenschutz bei Insekten und ande- käfer (Cerambycidae). – Ent. Nachr. 21: 145 –159.
ren wirbellosen Tierarten. – Tagungsberichte der Lange, L. (2017): Zur Bockkäferfauna der nördlichen
Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege Altmark zwischen Arendsee und Salzwedel. – En-
Laufen/Salzach 9: 29–32. tomologische Mitteilungen Sachsen–Anhalt 25(1):
Geiser, R. (1992): Rote Liste gefährdeter Bockkäfer (Ce- 49 –57.
rambycidae) Bayerns. – Schriftenreihe Bayerisches Malchau, W. & V. Neumann (2012): Wiederfund von
Landesamt für Umweltschutz 111: 127–131. Anastrangalia dubia (Scopoli, 1763) in Sachsen-An-
735Bockkäfer halt (Coleoptera, Cerambycidae). – Entomologi- Heide. – Entomologische Mitteilungen Sachsen- sche Nachrichten und Berichte 56(1): 63 – 64. Anhalt, SH 2015: 418 S. Malchau, W. (2018a): Zur Fauna der Bockkäfer (Coleop- Neumann, V. & W. Malchau (2016): 51. Bockkäfer (Co- tera: Cerambycidae) im EVSA-Projektgebiet der leoptera: Cerambycidae). S. 861– 873. – In: Frank, D. Dübener Heide (Sachsen-Anhalt). – In: Entomolo- & P. Schnitter (Hrsg.) (2016): Pflanzen und Tiere in gen-Vereinigung Sachsen-Anhalt (2018): Entomofau- Sachsen-Anhalt. Ein Kompendium der Biodiversi- nistische Untersuchungen in der Dübener Heide, tät. Natur + Text, Rangsdorf, 1.132 S. Teilbereich Sachsen-Anhalt. Schönebeck, 478 S. Neumann, V. (2016): Nachweise des Vierfleckenbockes Malchau, W. (2018b): Nachtrag zur Fauna der Bock- Pachyta quadrimaculata (Coleoptera: Cerambyci- käfer (Coleoptera: Cerambycidae) im EVSA-Projekt- dae) im Harz von Sachsen-Anhalt. – Entomol. Mitt. gebiet der Dübener Heide (Sachsen-Anhalt). – En- Sachsen-Anhalt 24(2): 101–102. tomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt 26(1): Nüssler, H. (1976): Boreomontane Bockkäfer aus den 42– 45. Gebirgen der Deutschen Demokratischen Republik Möller, G. & M. Schneider (1992): Koleopterologisch- (Coleoptera, Cerambycidae). – Ent. Nachr. Ber. 20: entomologische Betrachtungen zu Alt- und 177–185. Totholzbiotopen in der Umgebung Berlins. Teil 1. – Saxesen, F. W. R. (1834): Von den Thieren und Pflanzen Ent. Nachr. Ber. 36: 73 – 86. des Harzgebirges und der Jagd. – In: Zimmermann, C. Neumann, V. & V. Schmidt (2001): Neue öko-faunistische (Hrsg.): Das Harzgebirge. – Darmstadt. Aspekte zum Heldbock Cerambyx cerdo L. (Col.: Wahnschaffe, M. (1883): Verzeichnis der im Gebiet des Cerambycidae). – Hercynia N.F. 34: 286 –288. Aller-Vereins zwischen Helmstedt und Magdeburg Neumann, V., Trost, M. & T. Pietsch (2003): Judolia sex- aufgefundenen Käfer. – Neuhaldensleben. maculata (L., 1758) in Sachsen-Anhalt (Coleoptera: Wallin, H., Nylander, U. & T. Kvamme (2009): Two sibling Cerambycidae). Entomologische Mitteilungen species of Leiopus Audinet-Serville, 1835 (Coleop- Sachsen-Anhalt 11(2): 83. tera: Cerambycidae) from Europe: L. nebulosus Neumann, V. (2004): Rote Liste der Bockkäfer des Lan- (Linnaeus, 1758) and L. linnei sp. nov. – Zootaxa des Sachsen-Anhalt. – Berichte des Landesamtes 2010: 31– 45. für Umweltschutz Sachsen-Anhalt 39: 299 –304. Weckwerth, W. (1954): Unsere bekanntesten Bockkä- Neumann, V. & J. Händel (2010): Boreomontane Ar- fer. – Lutherstadt Wittenberg: Ziemsen Verl. (Neue ten der Bockkäferfauna des Harzes (Coleoptera, Brehm-Bücherei: Nr. 122). Cerambycidae). – Entomologische Mitteilungen Winter, S. & E. Nowak (2001) Totholz in bewirtschaf- Sachsen-Anhalt, SH 2010/2: 16 –22. teten und nicht bewirtschafteten Buchen- und Neumann, V., Rost, W. & E. Walter (2015): Die xylobion- Eichen-Hainbuchenwäldern des Biosphärenreser- ten Käfer der Colbitz-Letzlinger Heide. S. 255 –266. vats Spreewald. – Naturschutz und Landschafts- In: Entomologen-Vereinigung Sachsen-Anhalt: Bei- pflege in Brandenburg 10(4): 128 –133. träge zur Naturausstattung der Colbitz-Letzlinger Anschriften der Autoren PD Dr. Volker Neumann Andreas Rößler Säuleneichenweg 06 Am Hilligbornfeld 24 06120 Lieskau 06386 Großpaschleben E-Mail: volker.neumann@gmx.de E-Mail: andreas.roessler28@googlemail.com Dr. Werner Malchau Olaf Blochwitz Republikstraße 38 Rathenower Heerstraße 42 39218 Schönebeck 39307 Genthin E-Mail: werner.malchau@aol.com 736
Sie können auch lesen