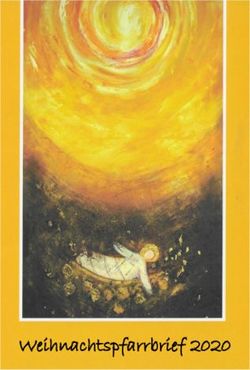Welt ohne Außen Anne Imhofs "Faust" in Venedig - Theater der Zeit
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
KüNSTLERINSERT Welt ohne Außen Anne Imhofs „Faust“ in Venedig von Thomas Oberender Niemand sagt in Anne Imhofs Arbeit im Deutschen Pavillon zum Augenblick „Verweile doch, du bist so schön“ – diesen Zustand kennen die Performerinnen und Performer in diesem „Faust“ genannten Stück nicht. Von Goethes Dramentext wird kein Satz gesprochen und keine seiner Figuren tritt auf. Der „Scheißfaust“, den Peter Handke gerne davon erlösen würde, auf rastlose Weise immerfort tätig zu sein, kommt in Imhofs Arbeit nicht vor. Vielmehr sind in Venedig Gestalten zu sehen, die ihre Seele erst noch finden müssen. Der Deutsche Pavillon ist das Zwischenreich, wo sie als Zombies ans Licht kommen, mitten unter uns, um Blut zu trinken wie Odysseus? Mutter am Ausgang des Hades; das Blut, das sie begehren, ist unser sie betrachten. Anne Imhofs Stück zeigt die Faustfigur als Symptom einer Zeit, in der das Subjekt immer nur werden muss und nie sein kann. Dieser Stimmung schafft sie einen Raum, in dem auch der Zuschauer nie nur Betrachter sein kann, sondern mitschaffen muss und Teil wird einer dynamischen Situation, in der sich die Ge-schehnisse, die eigene Lage und Umgebung ständig in Echtzeit verändern. Imhofs Arbeit akzentuiert eine selten so klar empfundene Doppelnatur der Faustfigur – ihre Unerfülltheit geht einher mit dem Verlust ihre sozialen Bindungen, zugleich aber ist sie äußerst beziehungsreich mit der Welt vernetzt. Imhofs Mephisto ist das Smartphone – immer zur Stelle, willfährig und verführerisch zugleich, stellt es die Verbindung her zu einem Reich schier unbegrenzter Möglichkeiten, jenseits von Raum und Zeit. Das Smartphone überwacht und steuert, es ist offensichtlich Teil von jener Kraft, die stets das Gute will und Böses schafft. Imhof selbst trägt als heimliche Regisseurin eines bei sich, aber auch die Performerinnen und Performer im Raum halten Smartphones in der Hand. Ohne dieses kleine, allesverbindende Gerät könnte sich der Wille der dämonischen Regie nicht realisieren, genauso wenig wie die Performer sich von ihm auch nicht unabhängig machen könnten, um während der kurzen Ruhephasen zum Beispiel ihre Nachrichten zu checken. Anne Imhofs Regie bleibt die ganze Zeit anwesend, ist aber nicht sichtbar. Die Künstlerin läuft inmitten der Besucher, gekleidet wie sie, mit ihrem Smartphone in der Hand umher und dirigiert die Performer, führt sie im Deutschen Pavillon in den Untergrund, hinaus in die Natur, unter die Bäume, in einen Zwinger mit Wachhunden oder mitten unters österlich wandelnde Volk. Aber die Autorenschaft all dieser Vorgänge bleibt verborgen. Wie Goethes Faust sind Imhofs Figuren erfüllt von einer seltsamen Emphase, wirken berauscht und stehen hautnah vor uns, sind aber zugleich unerreichbar fern und zeigen keine Form von seelischer Resonanz auf all das, was um sie herum geschieht. Imhofs Wiedergänger dieser deutschesten aller Bühnenfiguren sind, wie in Goethes Stück, radikal jung und ihre Gestalt, das Bild, das sie erzeugen, hat die Verse gänzlich ersetzt – ihr Spiel ist eines der rätselhaften leiblichen Präsenz: immer auf der Schwelle zwischen Pose und Natur, Virtualität und echtem Leib. Diese changierende Anwesenheit beruht sowohl auf einem Verhaltenscodex der Coolness, wie auch einer speziellen Körperlichkeit der Performer, die sich durch eine fast schon genormte Abweichung oder Andersheit auszeichnet – sie wirken wie urbane Athleten oder Computerspielkrieger, halb glatte, antike Plastik, halb typisches Balenciaga-Modell. Juliane Rebentisch verbindet in ihrem Essay „Dark Play“ im Begleitbuch der Biennale diesen ständig auf Produktion ausgerichteten Daseinszustand des faustischen Menschen mit jener Performance, die der Projektkapitalismus dem Individuum auferlegt – nicht nur smart zu funktionieren, sondern eine Abweichung vom Üblichen zu produzieren, die gerade im Dysfunktionalen potenzielle Reserven anzeigt, die in der Zukunft zur Entfaltung kommen können und so Zukunft schaffen. Es ist diese feine, persönliche Rätselhaftigkeit, die ein verborgenes Potenzial verspricht – irgendetwas ist anders an diesen Leuten, die Anne Imhof als Gesichter unserer Zeit zeigt, aber auch als Produkte unserer Zeit, der Medien und Industrie. So ist die Coolness des abweichenden Subjekts einerseits halb Macke, halb Geschlagenheit, halb aber auch laszives Kapital, ein körperpolitischer Einsatz im Spiel um Bedeutung und Einfluss, die nur da entstehen, wo es Reserven gibt. Statt Goethes Drama aufzuführen, übersetzt Anne Imhof seine zentrale Frage in einen Zustand, der unerhört radikal in der Form ist und im Deutschen Pavillon eine Art Limbus schafft, den wir als Besucher betreten, um verunsichert zu realisieren, dass hier niemand nur Zuschauer ist, sondern auch Verursacher, aufs Unheimlichste angesprochen und zugleich abgestoßen, mittendrin und doch nie zusammen. Man kann Imhofs Stück in gleicher Weise als Performance wie auch als Ausstellung betrachten – als ein Hybrid von beidem ist sie ein neues Format, etwas, das die Kunsthistorikerin Dorothea von Hantelmann einen „individualisierten Aufführungsraum“ nennt.
Er hat einerseits etwas mit der baulichen Situation zu tun, die Anne Imhof im Deut-schen Pavillon geschaffen hat, anderseits mit der „Verflüssigung“ dessen, was sie dort zeigt, denn es sind ja weniger Objekte, die still in der Zeit stehen, als Prozesse, die hier von Zeit zu Zeit in Gang gesetzt werden. Die vielen kurzen Stücke, die Imhof über viele Stunden hinweg jeden Tag zeigt, sind Performances, die eine Theatersituation schaffen; zugleich aber erlebt man sie individuell – anders als in der Guckkastenbühne wählt hier jeder Gast seinen eigenen Weg und niemand sieht in diesem Gebäude das Gleiche. Das ist um so erstaunlicher, da die Ausstellung kaum Objekte zeigt und im wahrsten Sinne äußerst übersichtlich ist – ja, die Schaffung einer nahezu vollkommenen Transparenz aller Vorgänge ist die geheime und beinah sadistische Idee der ganzen Produktion. Nirgends haben die Performer*innen einen Ort des Rückzugs, weder für sie noch für die Besucher gibt es ein Off: Die Säle des Deutschen Pavillons wirken ohne die üblichen Einbauten wie in ihre Ursprungsgestalt zurückversetzt und purifiziert. Durch die Lichter im oberen Geschoss, die erhöhten Fenster auf der Meerseite und die offenen Türen unter dem Portal zu den Gärten des Biennale-Geländes fällt mildes Vormittagslicht in den zentralen Raum, an den sich zwei weitere Räume anschließen, die man durch breite Wandöffnungen sehen, aber nicht betreten kann. Im gesamten Gebäude hat Imhof in gut eineinhalb Meter Höhe einen zweiten Boden aus Panzerglas verlegen lassen, auf dem die Besucher selbst wie Skulpturen stehen, quasi im Nichts, und die wenigen ausgestellten Objekte, Bilder und Instrumente betrachten. Schon von draußen kommend, sieht man auf der Dachkante drei Figuren kauern. Sie wirken im Gegenlicht wie Hausbesetzer, die den Ausblick genießen und als einzige in diesem ruhelosen Biennale-Getümmel Zeit haben. Ab und an erscheinen vor dem Pavillon zwei Dobermann-Hunde und bellen hinter hohen Panzerglasscheiben. Diese subtilen Eingriffe lassen das hohe und saubere Haus gefährlich und faszinierend wirken – die Hunde, die Hausbesetzergestalten, der dunkle Schriftzug „Germania“ unterm Vordach, irgendwer treibt hier sein Spiel und verbirgt mehr als er zeigt. Das Stück als Theateraufführung Der von Anne Imhof geschaffene Ort selbst ist porös und lässt das Drinnen und Draußen ineinander fließen. Die Besuchermenge drängt sich wie ein kontinuierlich durchlaufender Zug von draußen herein, zerstreut sich, spaltet sich auf in viele Einzelgruppen, und strömt dann wieder hinaus, jeder wie er will. Das ist nicht typisch für eine Theateraufführung, sondern entspricht eher dem individualisierten Erlebnismodus von Ausstellungsbesuchern. Aber inmitten dieser deregulierten Besuchersituation schaue ich wie bei jeder Theateraufführung auf etwas, das – als Cluster verschiedenster Aktionen – jeweils einen Anfang und ein Ende hat, kurz da ist und wieder verschwindet und so tut, als sei ich als Beobachter nicht da. Auch bei Anne Imhofs Stück bin ich als Besucher ein Gegenüber ohne Dasein. Nur dass ihr Stück den seltsamen Effekt hat, dass das Gleiche auch für die Performer zu gelten scheint – auch sie wirken zwar sehr intensiv anwesend, sie kämpfen miteinander, singen und arrangieren sich zu lebenden Bildern, aber bei all dem scheinbar ohne eigenes Leben; immer wirkt es, als hätte irgendein Exorzist das Eigene, das sie äußerlich so stark wirken lässt, aus dem Inneren vertrieben, worauf die Geister der Medienbilder in sie fahren konnten. Da man den Performer auf diesem Glasboden zum Greifen nahe ist und viele Besucher ihnen ihre Smartphonekameras direkt ins Gesicht halten, wirken die Figuren umso mehr wie als Ding behandelt und zum Erbarmen schutzlos. Im traditionellen Theater kann sich jeder Darsteller darauf verlassen, dass die vierte Wand und das Ritual des Abends ihn unberührbar hält. Das ist in dieser Performance anders. In Imhofs Vivarium muss er diese vierte Wand als individuelle Aura selbst herstellen. Imhofs Stück ist kein fixes Modell, sondern ein Set aus einer Vielzahl vorbereiteter Module und Szenen, die sich durch die Regie und die Reaktion der Besucher jeder-zeit neu mischen und also niemals gleichen. Erst diese entsicherte Nähe erzeugt und bedingt die modellhafte Unnahbarkeit und Glätte der Figuren, die wiederum einen kalkulierten Bruch hat, eine Eigentümlichkeit des jeweiligen Performertyps, die der Figur Stärke gibt und die unnahbare Aura potenziert. Der Modell-Blick sieht nichts, sondern will gesehen werden – er fängt die Blicke, statt etwas zu erschauen und dafür dient ihm jede Pose, jede Faust, die in die Luft gereckt wird, jedes zitierte Protestfoto, das gleich darauf in die Formation eines alten Tafelbildes übergeht, in das Defilee eines Catwalks oder die Kampfszene einer Filmepisode. Einerseits wirken diese Szenen wie schon einmal gesehen, wie bereits veröffentlicht, zugleich aber sind sie in der Öffentlichkeit des Pavillons kein bloßes Zitat. Die Körperlichkeit der sich balgenden, amphibienhaft unterm Glasboden kriechenden Figuren schafft zugleich Augenblicke von Tanz, Gesang oder Dasein, die ihre eigene Präsenz haben, eine eigene Wirklichkeit und – ja, Schönheit. Die Performer zeigen Bilder, denen sie ihre Körper leihen und die sofort wieder zu neuen Bildern führen, denn dieses Bildwerden der Leiber erkennen die Betrachter sofort und greifen zu ihren Smartphones. Die ausgestreckten Arme der Fotografierenden formen unbewusst so die kollektive Andachtshaltung unserer Zeit und in diesem aktiv bezeugenden Schauen der Fotografierenden entsteht tatsächlich eine tiefe Bindung der Einzelnen an das Geschehen. Es ist die seltsame Leistung von Imhofs Figuren, in ihrer physischen Einmaligkeit zugleich als ein Motiv zu wirken, das unwillkürlich erkannt und mit der Aufnahme beantwortet wird. Für Momente nimmt dieses affekthafte Fotografieren hysterische Züge an, es wirkt schamlos und gierig, aber in eben dieser Erfahrung liegt der verstörende Reiz der Inszenierung: Sie duldet kein unschuldiges Sehen. Imhofs „Faust“ ist eine Unschuldsvernichtungsmaschine und zugleich ein Werk größter Zartheit. Das anbetende Fotografieren bezeugt eine tiefe, kollektive Verwobenheit mit dem Geschehen inmitten dieser entgrenzten Bühne.
Warum nennt Anne Imhof diese Performer „Figuren“ und nicht Darsteller? Vielleicht weil Darsteller Medien sind, die reflektieren, dass sie nicht die Rolle sind, die sie spielen; hingegen Figuren komplexe, aber kompakte Identitäten besitzen. Figuren sind Welten aus eigenem Recht, Urheber ihrer eigenen Erzählung. So sieht man in Imhofs Pavillon eine Handvoll Figuren, die nichts darstellen; sie sind, so die Suggestion dieser Haltung, das Spiel, das sie zeigen. Sie sind – wie im Stadttheater – die Wenigen, die zu den Vielen sprechen und eine Antwort wollen. In ihrer Hand liegt die Aktion und deren Timing und sie bestimmen es nicht als die Darsteller eines fremden Skripts, sondern als die erwachsenen Spieler unter den Augen einer Regisseurin, deren Arbeit nie endet. Wenn diese Figuren sich auf dem schmalen Sims in zehn Metern Höhe befinden, tragen sie über ihren markenlosen Shirts und Jeans ein Sicherheitsgeschirr wie sonst Bergsteiger. Irgendwie ist die Gefahr in Imhofs Welt stets anwesend – die Gefahr abzustürzen, die eigene Behauptung implodieren zu sehen. Das Stück als Ausstellung Anders als im traditionellen Theater muss in einer Ausstellung niemand die gleiche Zeit mit allen anderen teilen. Es gibt hier kein kollektives Publikum, sondern nur ein individualisiertes Erleben. Ausstellungen haben deshalb, wie Dorothea von Hantelmann in ihrem Aufsatz über Modalitäten der Adressierung und Aufmerksamkeitsadressierung beschrieb, keine Anfangszeiten, sondern Öffnungszeiten, innerhalb derer jeder und jede nach eigenem Wunsch kommt und geht. Wie in jeder Ausstellung sind auch bei Anne Imhof die ausgestellten Dinge nicht dafür da, berührt zu werden, sondern sind aus ihren üblichen Kontexten herausgelöst und freigestellt worden, und durch diese immer auch feierliche Entrückung fangen die Objekte leise an zu sprechen. Schauspielkunst hat viel mit dieser einmaligen Mischung aus Prostitution und Keuschheit zu tun, wie Botho Strauß einmal die Situation der Schauspieler beschrieben: Alles wird auf der Bühne hergezeigt und ans Licht gebracht, aber stets um den Preis der keuschen Unberührbarkeit. Das betrifft die Menschen wie die erhöhten Dinge. Was im Theater nur Requisit war, wird in Imhofs Ultra-White-Cube zum Fetisch, schattenlos ausgeleuchtet wie Vitrinenware in Flagship Stores. Es sind Gegenstände reiner Latenz: Stahlschleudern und Metallkugeln als Munition, Energydrinks, E-Gitarren mit Verstärkern, Ladestationen, alles ist stillgestellt und droht mit Entla-dung, Explosion. Unberührbar hinter den Panzerglasscheiben erscheint das Leben als Ware – kalt und käuflich, Fetisch und narratives Ding. Die eingebaute Architektur aus Glas und Stahl zitiert und verstärkt dabei die unpersönliche Macht eines Systems der Apparate und Technologien, die transparent erscheinen, aber zugleich auch hart und seelenlos. An diesem Ausstellungsort wird nicht mehr etwas fest- und stillgestellt, der Zeit enthoben und in ein Reich der fest stehenden Bedeutung entrückt, sondern im Gegenteil: Die Ausstellung verzeitlicht ihr Material und zeigt es im Prozess. Die wenigen Objekte, Zeichnungen und Installationen aus Instrumenten, die auf ihre Benutzung warten, sind Teil eines flexibel gewordenen Ausstellungsmodus, der in erster Linie Vorgänge zeigt, dynamische Figurationen und das Handeln und Agieren von Performern, die eher sich in ihrem speziellen Daseinsmodus ausstellen als etwas darstellen. Das Stück als scripted space Anne Imhof „bespielt“ den Deutschen Pavillon nicht, wie sie im Interview mit der Kuratorin Susanne Pfeffer sagt, sondern „besetzt“ ihn und schafft so wie eine Parti-sanin im Geiste Hakim Beys ihr eigenes Regime, eine temporäre Zone anderer Re-geln. Etwas zu bespielen hieße, auf die eine Sache eine andere zu legen. Etwas zu besetzen meint, die eine durch etwas anderes zu ersetzen und tatsächlich wirkt Imhofs „Faust“ eher wie die Erfindung eines neuen Rituals, das nur noch Beteiligte kennt. Es findet in Echtzeit statt und ist in hohem Maße spektakulär: Wie von Zau-berhand erscheinen und verschwinden die Figuren – sie entkleiden sich, singen, rennen oder erstarren, spielen verschiedene Instrumente und entzünden immer wieder Feuer unter den Füßen der Besucher. Das Geschehen hat kein Zentrum und es gibt keinen Ort des Überblicks. Anders als in der traditionellen Theatersituation gibt es hier keine verborgene Zentralperspektive: Die Performer sind im Saal, unter den Füßen, über dem Kopf, draußen und drinnen, oft beides zugleich. Die Regie schweift, verlässt ihren Anweisungsposten, taucht unbemerkt ein in die Besuchermenge und steuert das Stück ständig mit, optimiert das Geschehen und strebt nach Kontrolle über den Augenblick, der nicht verweilen kann, sondern zur Welle wird, die durch die Zeit gleitet und die Regisseurin mit ihr. Diese immersive Situation lässt keinen Blick von außen zu und aktiviert die Aufmerksamkeit aufs Äußerste, weil das Geschehen völlig unberechenbar bleibt: „Was ist denn nun!“, brach es aus einer Frau neben mir hervor, weil auf einmal nichts passierte, anhaltend
nichts, bevor die Performer plötzlich wieder in den Raum stürmten wie ein Überfallkommando, vier, fünf Personen mitten durch die Menge, die sich wie Wasser teilt, sich um sie wieder schließt und während man auf sie schaut, hat sich in der anderen Ecke des Pavillons unter dem Glasboden ein Performer an die Wand gelehnt und durch den schmalen Spalt zwischen Scheibe und Mauer die Hand hindurchgesteckt und seine Finger oben aufs Glas gelegt. Niemand fasst ihn an, aber direkt über seinem Kopf gehen Menschen auf dem Panzerglas in die Knie und fotografieren sein Gesicht. So produziert das Geschehen Unschuld und vernichtet sie, jeder in diesem Pavillon der toten Seelen wird tief in die Ambivalenzen verstrickt. Durch die Überraschungen und ständigen Parallelitäten der Bilder, Sounds und die sie unterbrechende Stille werden Affekte erzeugt, die das Regime der unsichtbaren Regie tief unter die Haut der Besucher eindringen lässt. Sie funktioniert wie ein Algorithmus, etwas, das unser Verhalten liest, seine Schlüsse daraus zieht, uns unwillkürlich lenkt und sein Spiel spielt. Wer führt, wer folgt – dieser in jedem Theaterspiel klar geregelte Vorgang ist hier volatil und franst ständig aus. Der amerikanische Philosoph Norman Klein hat für derart narrative Architekturen den Begriff „scriptet space“ geprägt. Er umschreibt damit Wirkungsräume, die durch Spezialeffekte in der Welt des Films, Cartoons und Entertainments entstehen und in eine lange Tradition der „verkehrten Welt“ einzuordnen sind, durch die eine andere Ordnung etabliert wird, eine karnevaleske Verkehrung und Unterwanderung des Vertrauten. Die Realität ist hier ein geschichtetes Phänomen, in dem sich Reales mit Imaginärem ständig vermischt und die Situation bodenlos wird, ständig im Fluss wie in wilden Zeichentrickfilmen. Arbeiten von Künstlern wie Philippe Parreno oder Pierre Huyghe, die als bildende Künstler eher an der Herstellung von zeitlichen Dramaturgien als an der Präsentation von statischen Objekten interessiert sind, bilden eine künstlerische Form dieser scripted spaces, in denen die Grenzen zwischen privat und öffentlich oder imaginär und industriell verwischt werden. In dieser Weise schafft auch Anne Imhof aus theatralischen Schichtungen Umgebungen, in die der Betrachter eintauchen kann und in der sein Verhalten scheinbar noch unter seiner Kontrolle ist, aber hochgradig manipuliert wird durch das in diesen Räumen verborgene Script. Für dessen Funktionieren ist das Smartphone von entscheidender Bedeutung. Nicht nur, weil das Fotografieren jene affektive und auch kollektivierende Bindung herstellt, die Imhofs Inszenierung zu einem Ritual macht. Vielmehr ist jedes einzelne Smartphone, das jeder Performer bei sich trägt, eine Netzwerkstelle, ein Knoten im Echtzeitsystem von Instruktion und Überwachung, über das die Regisseurin mit den Performern in Verbindung steht, die den Bewegungen des Publikums folgen oder ihnen vorausgehen. Das erste Echtzeitmedium nach und neben dem Schauspieler war auf der Bühne das Video, denn es gestattete eine Aufsplittung der Szene in das Bühnengeschehen und sein im selben Moment manifest werdendes Bild, das eine eigene, entblößende, verstärkende und verstörende Realität hat. Und so wie es Videokunst gibt, gibt es inzwischen eine iPhone-Kunst. Jedes Werk, das durch das Smartphone nicht mehr bloß abbildend begleitet wird, sondern in seinem Verlauf durch diese dezentrale und individuell verfügbare Tech-nologie ermöglicht und gesteuert wird, hat neben der Echtzeitpräsenz der Darsteller einen zweiten Wesenskern, der von dieser neuen Technologie geprägt wird – durch sie entsteht in Echtzeit die Anwesenheit einer zweiten Erzählung, die mit der räumlichen und physischen Realität der Darsteller und Besucher eng verwoben wird und die Wirklichkeit in einer bislang nicht handhabbaren Weise auf mehreren Ebenen gleichzeitig dramatisiert. Dies geschieht als ein operatives Mitatmen mit den Akteuren, als ein Stoffwechsel zwischen verschiedenen Parteien, die plötzlich alle Teil des gleichen Spiels werden. Es sind Echtzeitprozesse, die nun im Theater in den Arbeiten von Lundahl & Seitl, Rimini Protokoll oder Anne Imhof eine über die Möglichkeiten des Videos weit hinausreichende Dimension entwickeln und zu einer Art von Echtzeitkunst führen. Sie bildet im Bereich der Performance ähnliche Strukturen zu denen der Echtzeitmusik und verändert damit das komplette Setting des klassischen Theater- oder Ausstellungsbetriebs. Ohne die vermittelnde Technologie des Smartphones wäre ein solches Prozessieren in der tuchfühlenden Koexistenz zum Publikum wie in Anne Imhofs „Faust“ nicht möglich. So steht diese Arbeit für jenes Denken in Modalitäten der Verbindung, der Netzwerke und Assoziationen, von dem Dorothea von Hantelmann im Blick auf das neue Format spricht. Wie Norman Kleins? scripted spaces sind es immersive Räume, in denen es kein Zentrum und keine Übersicht gibt. Die traditionellen Formate des Theaters und der Ausstellung beruhen auf dem Sehpfeil der im Abstand Befindlichen. Das Echtzeittheater von Anne Imhof aber schafft eine Welt ohne Außen – es gibt kein eindeutiges Narrativ mehr, sondern die individualisierte Erfahrung einer Ambivalenz, die aus der Gleichzeitigkeit meines Status als Beobachter und Produzent der Situation resultiert. Auf sie kann man nicht mehr Zigarre rauchend draufschauen wie auf das Modelltheater der Welt, sondern in ihr ist man selbst Modell. Anne Imhofs „Faust“ stammt von Bildern und erzeugt Bilder. Normalerweise ist das Bild der Abzug des Körpers. Bei Imhof werden auf gegenteilige Weise die Körper zum Abzug von Bildern. Die mächtigsten
Bilder sind heute nicht mehr die einmali-gen, sondern die am meisten geteilten. Anne Imhof hat diesen verschuldenden Zu-stand der Zirkulation abgründig inszeniert und das macht ihren „Faust“ zum meist gesehenen Stück der Saison. Quelle: https://www.theaterderzeit.de/2017/10/35505/komplett/ Abgerufen am: 06.06.2022
Sie können auch lesen