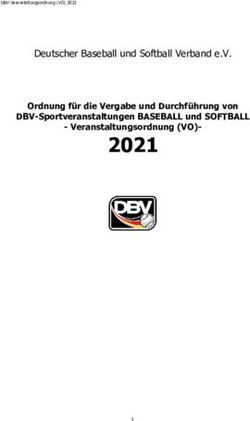Zusammenfassende Umwelterkla rung im Rahmen der Strategischen Umweltpru fung zum nationalen Aktionsprogramm zum Schutz der Gewa sser vor ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Zusammenfassende Umwelterklarung im Rahmen der Strategischen Umweltprufung zum nationalen Aktionsprogramm zum Schutz der Gewasser vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quel- len Änderung des düngungsbezogenen Teilprogramms durch die Verordnung zur Änderung der Düngeverordnung
SEITE 2 VON 29 Zusammenfassende Umwelterklarung im Rahmen der Strategischen Umweltprufung zum nationalen Aktionsprogramm zum Schutz der Gewasser vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen Anderung des dungungsbezogenen Teilprogramms durch die Verordnung zur Anderung der Dungeverord- nung Bundesministerium fur Ernahrung und Landwirtschaft Referat 711 Rochusstraße 1 53123 Bonn Bonn, 20.07.2020
SEITE 3 VON 29
INHALTSVERZEICHNIS
1 Kurzdarstellung der Inhalte der Verordnung zur Änderung der
Düngeverordnung sowie der zusammenfassenden Umwelterklärung 4
2 Erläuterung zur Einbeziehung von Umwelterwägungen in die Verordnung
zur Änderung der Düngeverordnung 6
3 Berücksichtigung des Umweltberichtes sowie der Stellungnahmen und
Äußerungen von Behörden und der betroffenen Öffentlichkeit 8
3.1 Umweltbericht 8
3.2 Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 8
4 Änderungen nach Veröffentlichung des Umweltberichts 25
5 Auswahlgründe für die Regelungen der Verordnung zur Änderung der
Düngeverordnung nach Abwägung mit den geprüften Alternativen 27
6 Maßnahmen zur Überwachung erheblicher Umweltauswirkungen 29SEITE 4 VON 29
1 Kurzdarstellung der Inhalte der Verordnung
zur Änderung der Düngeverordnung sowie
der zusammenfassenden Umwelterklärung
Mit der am 1. Mai 2020 in Kraft getretenen Verordnung zur Änderung der Düngeverordnung
vom 28. April 2020 (BGBl. I S. 846) wird die Düngeverordnung vom 26. Mai 2017 (BGBl. I
S. 1305.) zur Umsetzung des Urteils des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 21. Juni 2018
weiterentwickelt. Mit der Änderungsverordnung werden die Anforderungen zum Gewässer-
schutz - insbesondere in den mit Nitrat belasteten Gebieten – angepasst.
Die Düngeverordnung und die nun vorliegende Änderungsverordnung sind wesentliche Be-
standteile des deutschen Aktionsprogramms zur Umsetzung der für die Düngung relevanten
Elemente der Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 12. Dezember 1991 zum Schutz der Ge-
wässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen (sog. EU-Nitratricht-
linie).
Mit der Änderung wird den Ergebnissen der Gespräche mit der EU-Kommission zur Umset-
zung des EuGH-Urteils Rechnung getragen. Die vorliegende Verordnung dient damit allein der
Umsetzung von EU-Recht.
Nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) ist für Nationale Aktions-
programme nach Artikel 5 Absatz 1 der EU-Nitratrichtlinie (91/676/EWG), deren wesentlicher
Bestandteil die Düngeverordnung ist, eine Strategische Umweltprüfung (SUP) durchzuführen.
Demgemäß wurde für die Verordnung zur Änderung der Düngeverordnung ein Umweltbericht
erstellt und eine Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt. Die hierbei einge-
gangenen Stellungnahmen wurden durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft ausgewertet. Aufgrund der Bestimmungen des § 44 Absatz 2 Nummer 2 UVPG ist bei
Annahme des Aktionsprogramms bzw. seiner Änderungen auch eine zusammenfassende Er-
klärung auszulegen.
Gegenstand dieser Erklärung ist eine Erläuterung,
- wie Umwelterwägungen bei den Änderungen des Aktionsprogramms einbezogen wur-
den,
- wie die Stellungnahmen und Äußerungen der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung
berücksichtigt wurden und
- aus welchen Gründen die Änderungen des Aktionsprogramms nach Abwägung mit den
geprüften Alternativen gewählt wurden.
Mit der Bekanntmachung der Annahme der Änderungen des Aktionsprogramms sowie der
Auslegung der angenommenen Änderungen des Aktionsprogramms und der vorliegenden zu-
sammenfassenden Erklärung wird das Verfahren der Strategischen Umweltprüfung zur No-
velle der Düngeverordnung abgeschlossen.SEITE 5 VON 29 Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen die Entscheidung über die Annahme der Änderungen des Aktionsprogramms kann eine Vereinigung nach Maßgabe des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes innerhalb eines Jahres nach der Bekanntmachung der Änderungen des Aktionsprogramms einen Rechtsbehelf beim Ober- verwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster, einlegen.
SEITE 6 VON 29
2 Erläuterung zur Einbeziehung von Um-
welterwägungen in die Verordnung zur Än-
derung der Düngeverordnung
Die Verordnung zur Änderung der Düngeverordnung dient ausschließlich der Umsetzung der
EU-Nitratrichtlinie und insbesondere des Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom 21. Juni
2018. Die Verordnung soll einen Beitrag zu folgenden Zielen leisten:
− Senkung des Stickstoffbilanzüberschusses der deutschen Landwirtschaft auf 70 kg pro
ha landwirtschaftlich genutzter Fläche als Ziel der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundes-
regierung im Jahresmittel ab dem Zeitraum 2028 – 2032 sowie der Nationalen Strategie
zur biologischen Vielfalt; bei beiden wird eine weitere Verringerung über dieses Ziel hin-
aus angestrebt.
− Reduktion der Ammoniakemissionen in Deutschland. Diese stammen zu 95 Prozent aus
der Landwirtschaft. Seit dem Jahr 2010 besteht auf Grund der Vorgaben der Richtlinie
2001/81/EG (NEC-Richtlinie) für Deutschland ein Höchstwert an Ammoniakemissionen
von 550 kt/Jahr. Gemäß der NEC-Nachfolgerichtlinie (Richtlinie (EU) 2016/2284, sog.
NERC-RL) sind bis zum Jahr 2030 gegenüber dem Jahr 2005 29 Prozent der Ammoni-
akemissionen aus der Landwirtschaft zu reduzieren.
− Erreichung der Ziele der EG-Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG, der EG-Meeresstrate-
gierahmenrichtlinie 2008/56/EG und der Internationalen Meeresschutzkonventionen
der Ostsee (HELCOM) und der Nordsee (OSPARCOM), wozu u. a. die Reduzierung der
durch die Landwirtschaft verursachten Stickstoff- und Phosphatbelastungen der Gewäs-
ser erforderlich ist.
− Auf deutscher und EU-Ebene die Beiträge der Landwirtschaft zum Klimaschutz auch im
Bereich der Düngung weiter zu verbessern (vgl. Aktionsprogramm Klimaschutz 2020
(BMUB, 2014), Entscheidung Nr. 406/2009/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes).
Um einen substanziellen Beitrag der Düngeverordnung zur Erreichung dieser Ziele sicherzu-
stellen, müssen die Wirksamkeit und die Effizienz der Regelungen regelmäßig überprüft wer-
den.
Unabhängig von dieser regelmäßigen Überprüfung ist das im Jahr 2018 ergangene Urteil des
Europäischen Gerichtshofs im Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland wegen unzu-
reichender Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie unverzüglich umzusetzen.
Entsprechend den Vorgaben des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
wurden im Rahmen der Strategischen Umweltprüfung die Auswirkungen der Änderungsver-
ordnung auf folgende Schutzgüter betrachtet:
− Mensch (einschließlich menschliche Gesundheit)
− Flora/Fauna/Biodiversität
− Wasser
− Klima/Luft
− Fläche, Boden
− LandschaftSEITE 7 VON 29 − Kultur- und Sachgüter − Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgütern.
SEITE 8 VON 29 3 Berücksichtigung des Umweltberichtes so- wie der Stellungnahmen und Äußerungen von Behörden und der betroffenen Öffent- lichkeit 3.1 Umweltbericht § 35 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Anlage 5 Nummer 1.12 UVPG schreibt die SUP für Nationale Aktionsprogramme nach Artikel 5 Absatz 1 der EU-Nitratrichtlinie (91/676/EWG) vor, deren wesentlicher Bestandteil die Düngeverordnung ist. Der öffentliche Scoping-Termin fand am 4. September 2019 im Bundesministerium für Ernäh- rung und Landwirtschaft (BMEL) in Bonn statt. Im Rahmen einer Diskussion unter Beteiligung betroffener Behörden des Bundes und der Länder sowie Wirtschafts- und Umweltverbände wurde ein Gliederungsvorschlag für den Umweltbericht diskutiert und die Änderungen der Verordnung zur Änderung der Düngeverordnung vorgestellt. Darauf aufbauend wurden Hinweise zum Untersuchungsrahmen und Vorschläge für spezifi- sche Fragestellungen gesammelt. Auch die zu wählenden vernünftigen Maßnahmenalternati- ven wurden im Dialog mit den Scoping-Teilnehmern festgelegt. Anschließend wurden die Umweltwirkungen, die bei Umsetzung der Änderung der Düngever- ordnung und bestimmter Alternativen zu erwarten sind, ermittelt, im Umweltbericht darge- stellt und soweit als möglich im Verordnungsentwurf zur Änderung der Düngeverordnung be- rücksichtigt. 3.2 Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung Der Umweltbericht und der Entwurf der Verordnung zur Änderung der Düngeverordnung wurden zwischen dem 2. Februar 2020 und dem 2. März 2020 öffentlich ausgelegt. Bis zum 2. April 2020 bestand für Behörden, deren umwelt- und gesundheitsbezogener Aufga- benbereich durch das Aktionsprogramm berührt wird, und die betroffene Öffentlichkeit die Möglichkeit, zum Umweltbericht und zum Verordnungsentwurf Stellung zu nehmen. Insgesamt wurden innerhalb dieser Frist ca. 8000 Stellungnahmen zum Umweltbericht und zum Verordnungsentwurf abgegeben, davon 26 Verbändestellungnahmen. 155 Stellungnahmen sind erst nach dem 2. April 2020 eingegangen und wurden nach § 43 Ab- satz 1 Satz 1 i.V.m. § 42 Absatz 3 Satz 3 UVPG nicht berücksichtigt.
SEITE 9 VON 29 Zudem wurden 2614 Stellungnahmen nicht in die Auswertung mit einbezogen, da die für eine Stellungnahme erforderliche Betroffenheit der Petenten nach § 43 Absatz 1 Satz 1 i.V.m. § 42 Absatz 3 Satz 1 sowie § 2 Absatz 9 UVPG erkennbar nicht gegeben war. Weiterhin sind 67 rein wertende Stellungnahmen eingegangen, die mangels hinreichender sachlicher Substantiierung nicht in die Auswertung einbezogen werden konnten. Zahlreiche individuelle Eingaben im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung zur Strategischen Umweltprüfung (mehr als 1100) basieren auf Musterschreiben, die von verschiedenen Ver- bänden und Gruppierungen zur Verfügung gestellt bzw. einheitlich gestaltet wurden und oft einen Rahmen für individuelle Aspekte gegeben haben. Es handelt sich um zehn unterschiedli- che Muster (u.a. einen Textgenerator des Bayerischen Bauernverbandes), welche weitestge- hend dieselben umweltrelevanten und fachlichen Fragen adressieren, die auch in den Stel- lungnahmen der einzelnen Verbände konkretisiert werden. Bei einem großen Teil der weiteren Schreiben handelt es sich um Eingaben von Landwirten und landwirtschaftlichen Unternehmungen (mehr als 2400), welche verschiedene individuelle umweltrelevante und fachliche Fragen adressieren. Auch diese Themen kongruieren inhaltlich zumeist mit den von den Fachverbänden angeführten Aspekten. Zentrale umweltrelevante Themen sind der Humusabbau durch Unterversorgung (Boden- schutz, Kohlenstoffbindung), Verlagerung der Düngung auf ungünstige Zeiten (Bodenstruktur, Erosion), Auswirkungen auf die Agrarstruktur (Höfesterben, regionale Wertschöpfung, Flä- chenkonzentration), internationale Verlagerungseffekte (Klima, Fläche, Umweltstandards), Pflanzenschutz (bodenhygienische Auswirkungen, Pflanzenschutzmittelnutzung), Förderung der Mineraldüngung, Artenschwund durch Reduzierung der Anbauvielfalt (Monokulturen, In- sektensterben) und Lagerungsprobleme (neue Punktquellen). Viele der Musterschreiben und individuellen Schreiben führen neben den umweltrelevanten Themen auch erwerbsbezogene Aspekte an, welche die eigene Produktion, Betriebsabläufe, wirtschaftliche Verluste, Hofnachfolge oder eine mögliche Betriebsaufgabe betreffen. Des Weiteren wird oft auf die systemrelevante Rolle der Landwirtschaft für die nationale Nah- rungsmittelversorgung hingewiesen und diesbezüglich ein großes Unverständnis für die Er- schwernis der landwirtschaftlichen Produktion geäußert. Ein dritter großer Anteil der Eingaben (ca. 1300) kritisiert mit einem Musterschreiben das Messstellennetz, die mit MONERIS modellierte Nitratbelastung sowie die Datenlage zur Nit- ratbelastung in Deutschland und empfiehlt, eine Novellierung der DüV nur auf Basis neuer, adäquater Messwerte vorzunehmen. Schließlich gibt es eine Initiative von Land schafft Verbindung, aufgrund der ca. 300 Eingaben mit einem einseitigen Musteraufruf „Fruchtbarkeit der Böden und Ernährungssicherheit erhal- ten! Düngeverordnung ablehnen! Eure Landwirte von Nebenan!“ eingingen. Im Folgenden wird beschrieben, zu welchen der in dem ausgelegten Entwurf der Verordnung zur Änderung der Düngeverordnung vorgesehenen Neuregelungen Stellung genommen wurde.
SEITE 10 VON 29
Die Forderungen aus den Stellungnahmen werden hierbei bewertet und es werden die
Gründe benannt, weshalb bestimmten Anregungen im Rahmen der Novellierung der Dünge-
verordnung gefolgt oder nicht gefolgt werden konnte.
1. Düngebedarfsermittlung
1.1 § 3 Absatz 3 Satz 3 DüV – Überschreitung des ermittelten Düngebedarfs um zehn Pro-
zent
Forderung/ Kritik
Sechs Verbände lehnen die Beschränkung der Überschreitung des Düngebedarfs auf zehn Pro-
zent ab, da der Düngebedarf durch unkalkulierbaren Witterungsverlauf und Ertragsschwan-
kungen durch Schädlinge stets angepasst werden müsse. Nur durch zulässige Ausnahmen
könnten Pflanzenbestände gerettet und die erforderlichen Qualitäten erzielt werden. Ein wei-
terer Verband sieht zudem die Gefahr des Humusabbaus.
Berücksichtigung in der Verordnung zur Änderung der Düngeverordnung
Durch die Begrenzung der nachträglich zulässigen Überschreitung des ermittelten Düngebe-
darfs wird der Gefahr hoher Nährstoffüberschüsse vorgebeugt. Bezogen auf den Witterungs-
verlauf kann nur eine erhöhte Auswaschung aufgrund von starken Niederschlägen zu einer
nachträglichen Erhöhung des Düngebedarfs führen. In solchen Situationen kann es in Abhän-
gigkeit von Standortfaktoren und Kulturpflanzenart zwar vereinzelt zu einem höheren Stick-
stoffbedarf, welcher den ermittelten Düngebedarf um mehr als zehn Prozent übersteigt, kom-
men. Eine nachträgliche Überschreitung des Düngebedarfs um mehr als zehn Prozent erhöht
allerdings auf solch wassergesättigten Böden zusätzlich unverhältnismäßig die Gefahr der un-
kontrollierten Stickstoffauswaschung, da nachfolgend erneut Niederschläge auftreten kön-
nen.
Bei Ertragseinbußen durch Schädlinge verringert sich der Düngebedarf insgesamt. Eine zusätz-
liche Stickstoffgabe zur Förderung derart geschwächter Bestände würde das Risiko von hohen
Nährstoffüberschüssen somit zusätzlich erhöhen. Die Möglichkeit der Bestandsförderung über
eine Anpassung der einzelnen Teilgaben bleibt überdies grundsätzlich erhalten.
Der Humusgehalt des Bodens wird vordergründig durch die Fruchtfolge, die Bodenbearbei-
tung sowie die Art und Form der eingesetzten Düngemittel beeinflusst. Es muss daher als äu-
ßerst unwahrscheinlich angesehen werden, dass durch die diskutierte Ausnahmebeschrän-
kung ein messbarer Effekt auf den Humusgehalt im Boden entsteht. Negative Umweltein-
flüsse sind ausgehend von der diskutierten Regelung nicht zu erwarten.
1.2 § 3 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 DüV – Anrechnung höherer verfügbarerer Stickstoffmen-
gen bei Gülle und Gärrückständen aus Biogasanlagen
Forderung/ Kritik
Insgesamt haben acht Verbände zu dieser Regelung Stellung genommen. Drei dieser Ver-
bände kritisieren, dass die emissionsarme Ausbringungstechnik derzeit noch nicht ausrei-
chend verbreitet ist, um diese Regelung zu rechtfertigen. Ein Verband befürchtet, dass es bei
Anwendung dieser Regelung in Verbindung mit der Anrechnung der Düngung aus dem VorjahrSEITE 11 VON 29
und dem unterstellten Nachlieferungsvermögen humoser Böden zu einem Abbau des Humus-
gehalts und damit der Nährstoff-, Wasser- und CO2-Speicherkapazität der Standorte kommt.
Vier Verbände sehen es für erforderlich an, dass zunächst in Praxisversuchen getestet wird, ob
eine bessere Ausbringungstechnik tatsächlich zu höheren Wirksamkeiten organischer Dünge-
mittel führen können. Die im Verordnungsentwurf verankerten Werte seien bis 2025 nicht re-
alisierbar. Ein Verband befürchtet die Zunahme der Ausbringung mineralischer Düngemittel.
Aus Sicht einiger Verbände (6) führt die Regelung zu einer Schwächung der überbetrieblichen
Verwertung von Gülle und Gärresten, zu einer bilanziellen Schlechterstellung dieser Dünge-
mittel (4). Zwei Verbände sehen es als erforderlich an, dass die emissionsarme Ausbringungs-
technik definiert und gefördert wird.
Berücksichtigung in der Verordnung zur Änderung der Düngeverordnung
Bei der Ausbringung von Wirtschaftsdüngern sind Ammoniakverluste unvermeidbar, diese
gasförmig entweichenden N-Mengen stehen den Pflanzen nicht zur Deckung ihres Nährstoff-
bedarfs zur Verfügung. Im Hinblick auf eine effiziente Nutzung des im Wirtschaftsdünger vor-
handenen Stickstoffs sind in der geltenden DüV Vorgaben für eine emissionsarme Ausbrin-
gungstechnik und Einarbeitungspflichten vorgesehen. Ziel muss es sein, einen möglichst ho-
hen Anteil des pflanzenverfügbaren Ammoniums im Wirtschaftsdünger für die Pflanzen nutz-
bar zu machen. Über eine höhere Anrechnung des Stickstoffs gegenüber der DüV aus 2017
wird auch ein Anreiz für die Landwirte gesetzt, gasförmige Stickstoffverluste zu minimieren.
Der Kritik aus der Öffentlichkeitsbeteiligung kann aus den genannten Gründen daher nicht
entsprochen werden.
1.3 § 4 Absatz 1 Sätze 1 und 2 Nummer 7 DüV – Stickstoffmenge im Herbst zu Winterraps
und Wintergerste ist in Höhe des verfügbaren Stickstoffs zu berücksichtigen
Forderung/ Kritik
Zu dieser Vorgabe haben insgesamt acht Verbände Stellung genommen. Davon kritisieren sie-
ben, dass die Regelung zu einem doppelten Abzug und damit einer deutlichen Benachteiligung
führe. Sollte an der Regelung festgehalten werden, seien die Stickstoffbedarfswerte von Win-
terraps und Wintergerste anzupassen. Einige Verbände befürchten, dass die Regelung zu ei-
nem Ertragsrückgang aufgrund von Mangelernährung führen wird. In dessen Folge sei mit Ein-
kommensverlusten zu rechnen. Ein Verband gibt an, dass die Regelung der Eiweißstrategie wi-
derspricht.
Berücksichtigung in der Verordnung zur Änderung der Düngeverordnung
Die Regelung erzielt laut Bewertung des Umweltberichts ausschließlich positive Umweltwir-
kungen. Ein doppelter Abzug der im Herbst gedüngten Stickstoffmengen ist indes nicht zu be-
fürchten. Sofern aus einer Herbstdüngung gewisse Stickstoffmengen noch im Frühjahr im Bo-
den aufgrund eines geringeren pflanzlichen Bedarfs vorhanden sein sollten, so kann dieser
Überschuss bei der Düngung im Frühjahr voll berücksichtigt werden ohne die den Pflanzen zur
Verfügung stehende Gesamtnährstoffmenge zu reduzieren. Alternative Vorschläge sind im
Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht eingegangen, sodass die Kritik im Rahmen der
Änderung der Düngeverordnung nicht berücksichtigt wird.
2. Standort- und bodenzustandsspezifische RestriktionenSEITE 12 VON 29 2.1 § 5 Absatz 1 Satz 1 Alternative 3 DüV – Verbot der Düngung auf gefrorenen Boden Forderung/ Kritik Elf Verbände kritisieren das Verbot der Düngung von gefrorenem Boden, der tagsüber auf- taut. Sie fordern die Rückkehr zur Regelung der geltenden Düngeverordnung von 2017. Die Regelung sei erforderlich, um die Böden im zeitigen Frühjahr rechtzeitig mit Nährstoffen ver- sorgen zu können und gleichzeitig schädliche Bodenveränderungen auf wenig tragfähigen Bö- den zu vermeiden. Zudem führe das Verbot aufgrund der im späteren Frühjahr vorherrschen- den höheren Temperaturen zu höheren Ammoniakemissionen. Berücksichtigung in der Verordnung zur Änderung der Düngeverordnung Der Forderung wird im Rahmen der Änderung der Düngeverordnung nicht entsprochen, da sie der Forderung der EU-Kommission, die eine Ausnahme von dieser Regelung im Rahmen der Verhandlungen zur Umsetzung des EuGH-Urteils abgelehnt hat, entgegenstehen würde. Negative Auswirkungen auf den Boden sind aus Sicht des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft nicht zu erwarten, da Betriebsinhaber vor der Ausbringung von Düngemit- teln den Bodenzustand dahingehend zu beurteilen haben, ob dieser ausreichend tragfähig ist. Andernfalls ist die Düngung zu verschieben. Auch im Hinblick auf entstehende Ammoniakemissionen liegt es in der Hand des Betriebsinha- bers zu prüfen, ob eine Ausbringung unter den dann gegebenen Umständen vertretbar ist. Ziel muss es sein, emissionsarme Ausbringungstechniken so anzuwenden, dass gasförmige Stickstoffverluste weitestgehend minimiert werden. 2.2 § 5 Absatz 3 DüV – Erweiterung der Gewässerabstände Forderung/ Kritik Insgesamt neun Verbände kritisieren die ergänzten Vorgaben zu den erforderlichen Abstän- den zu Gewässern. Vier Verbände halten die nach verschiedenen Hangneigungen einzuhalten- den Abstände zu Gewässern für deutlich zu kompliziert und nicht praktikabel. Insbesondere sei die Hangneigungsklasse ab fünf Prozent zu streichen und die Regelung zum verminderten Abstand bei Einsatz verlustmindernder Technik auf alle Hangneigungsklassen auszuweiten. Weiterhin seien Abweichungsmöglichkeiten aufgrund kleinstrukturierter Bewirtschaftungsein- heiten für Grünlandstandorte, präziser Ausbringungstechnik und bei Ergreifung alternativer Maßnahmen notwendig, um Härtefälle zu vermeiden. Sechs Verbände geben an, dass die Re- gelung zu einer Einschränkung von Agrarumweltprogrammen und Wasserkooperationen führe. Vier Verbände halten die sofortige Einarbeitungsverpflichtung bei mehr als 15 % Hangneigung als unangemessen. Ein Verband hält eine Klarstellung für die Begriffe „Weide- gang“ und „Gewässer“ für erforderlich. Drei Verbände halten die Regelung für praktisch nicht umsetzbar, insbesondere hinsichtlich der Kontrolle durch die Behörden. Berücksichtigung in der Verordnung zur Änderung der Düngeverordnung Der Forderung kann im Rahmen der Verordnung zur Änderung der Düngeverordnung nicht entsprochen werden, da erweiterte Abstandsregelungen wesentliche Forderungen der EU- Kommission zur Umsetzung des EuGH-Urteils waren. Die Regelung dient maßgeblich der ef- fektiven Vermeidung von direkten Nährstoffeinträgen in die Gewässer. Nachteilige Auswir- kungen auf die Umwelt sind nicht zu erwarten. Beim Aufbringen von stickstoff- oder phos- phathaltigen Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln sind
SEITE 13 VON 29
ein direkter Eintrag und ein Abschwemmen von Nährstoffen in oberirdische Gewässer zu ver-
meiden. Der Verordnungsgeber hält die im Verordnungsentwurf vorgesehenen Regelungen
zum Gewässerabstand für sachgerecht, sodass keine weitere Änderung erfolgt.
3. § 6 Absatz 4 Sätze 5, 6 DüV – Abzug von Flächen mit Düngungsbeschrän-
kung
Forderung/ Kritik
Sieben Verbände erwarten, dass durch den Abzug von Flächen mit Düngungsbeschränkung
bei der Berechnung der 170 kg N-Obergrenze aus organischen Düngemitteln mehr Wirt-
schaftsdünger abgegeben werden müssen. Bei gegebenem Düngebedarf wäre die erforderli-
che Menge ggf. durch mineralische Düngemittel, die von den Betrieben zugekauft werden
müssen, zu ersetzen. Dies sei mit negativen Wirkungen für den Umwelt- und Naturschutz ver-
bunden. Zwei Verbände fordern, dass bei Nachweis eines entsprechenden Bedarfs, eine Aus-
nahme von den verschärften Vorgaben zur Berechnung der betrieblichen Ausbringungsober-
grenze zugelassen werden. Fünf Verbände erwarten, dass durch diese Regelung die Bereit-
schaft landwirtschaftlicher Betriebe zur Teilnahme an Agrar- und Umweltprogrammen sowie
am Vertragsnaturschutz zurückgehen werde. Ein Verband hält es für erforderlich, dass be-
triebsindividuelle Situationen berücksichtigt werden müssten.
Berücksichtigung in der Verordnung zur Änderung der Düngeverordnung
Einer der wesentlichen Kritikpunkte an der geltenden DüV ist, dass Flächen, die Düngungsbe-
schränkungen unterliegen bisher vollständig bei der Berechnung der 170 kg Grenze angerech-
net werden konnten. Die künftige Herausnahme dieser Flächen bzw. Einbeziehung bis zur
Höhe der zulässigen Düngung auf diesen Flächen bei der Berechnung der 170 kg-Obergrenze
ist fachlich begründet und erforderlich. Negative Umweltwirkungen resultieren aus dieser Re-
gelung nicht, weshalb die Kritik im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung unberücksichtigt
bleibt.
4. Zusätzliche Vorgaben für die Anwendung bestimmter Düngemittel
4.1 § 6 Absatz 1 Satz 1 DüV – Verkürzung der Einarbeitungszeit organischer Düngemittel auf
eine Stunde
Forderung/ Kritik
Sechs Verbände lehnen die Einführung der Regelung ab. Fünf Verbände fordern, dass statt-
dessen emissionsmindernde Technik gefördert werden sollte. Kleine und mittlere Betriebe
würden mit der Regelung unverhältnismäßig benachteiligt. Zudem seien bodennahe und strei-
fenförmige Ablageverfahren bereits als Einarbeitung zu definieren. Ausreichende Fördermittel
seien erforderlich, um die Betriebe bei der Anschaffung emissionsarmer Ausbringungstechnik
zu unterstützen.
Berücksichtigung in der Verordnung zur Änderung der Düngeverordnung
Mit der Regelung sollen bei der Ausbringung organischer Düngemittel entstehende Ammoni-
akemissionen vermindert werden. Mit ihr wird außerdem ein erster Teil der landwirtschaftli-
chen Maßnahmen des Nationalen Luftreinhalteprogramms der Bundesrepublik Deutschland,SEITE 14 VON 29 das zur Einhaltung der Minderungsverpflichtungen der neuen NEC-Richtlinie erstellt wurde, umgesetzt. Eine Förderung emissionsarmer Ausbringungstechnik kann über die Gemein- schaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz erfolgen. Die Kritik wird daher bereits berück- sichtigt. Änderungen an der Regelung sind nicht erforderlich. 4.2 § 6 Absatz 2 DüV – Pflicht zur Beigabe von Ureasehemmstoffen oder Einarbeitung Forderung/ Kritik Ein Verband kritisiert, dass die Wirkung von Ureasehemmstoffen bei Blattdüngung noch nicht hinreichend wissenschaftlich belegt ist, daher sei die Zumischung nur auf die Bodendüngung zu beziehen. Ein weiterer Verband befürchtet, dass es durch die Zugabe zu einem unnötigen Chemikalienaustrag komme. Berücksichtigung in der Verordnung zur Änderung der Düngeverordnung Im Rahmen des Verordnungsgebungsverfahrens wurde entschieden, auf die Regelung zu ver- zichten. Die Kritik im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wird damit berücksichtigt. 4.3 § 6 Absatz 8 Satz 2 DüV – Verlängerung der Sperrzeit für Festmist und Kompost Forderung/ Kritik Zu dieser Regelung haben insgesamt zehn Verbände Stellung genommen. Sieben dieser Ver- bände erwarten, dass der Ausbringungszeitpunkt lediglich verlagert wird und es durch höhere Bodentemperaturen zu höheren Emissionen kommt. Zudem wird von acht Verbänden be- fürchtet, dass es durch die Verschiebung des Ausbringungszeitpunktes zu Bodenschäden und Futterverschmutzung kommt. Zur Schaffung der erforderlichen Lagerkapazität halten drei Ver- bände eine rechtliche (Abbau Genehmigungshemmnisse) und finanzielle Unterstützung durch den Bund für erforderlich. Um die hohen Kosten durch den Zubau zu sparen, würden viele Be- triebe zu einer Lagerung am Feldrand übergehen, womit aus Sicht von fünf Verbänden die Ge- fahr von punktuellen Nitrateinträgen ansteige. Berücksichtigung in der Verordnung zur Änderung der Düngeverordnung Die eingebrachte Kritik wurde zwischen den Entscheidungsfindern intensiv diskutiert. Aller- dings ist der Handlungsspielraum gering. In der Verordnung zur Änderung der Düngeverord- nung sind die Forderungen der EU-Kommission zur Umsetzung des EuGH-Urteils zu berück- sichtigen. Die Kommission hat eine Ausdehnung der Sperrzeit für Festmist gefordert. Die jetzt in der Änderungsverordnung ausgewiesenen Sperrzeiten sind das Ergebnis eines lan- gen Diskussionsprozesses mit der EU-Kommission. 4.3 § 6 Absatz 8 Satz 3 DüV – Sperrfrist für P-haltige Düngemittel Forderung/ Kritik Fünf Verbände sehen keine Notwendigkeit einer solchen Regelung, da vorwiegend mit Mehrnährstoffdüngern gehandelt werde und diese über die Sperrzeit für stickstoffhaltige Düngemittel hinreichend reguliert seien.
SEITE 15 VON 29 Berücksichtigung in der Verordnung zur Änderung der Düngeverordnung Die Aufbringungsbeschränkung P-haltiger Düngemittel im Herbst wurde von der EU-Kommis- sion gefordert, da diese die Eutrophierungssituation deutscher Gewässer bemängelt. Spezifi- sche Maßnahmen, die auf eine Verringerung der P-Einträge abzielen, sind daher erforderlich. Negative Umweltauswirkungen sind durch die Regelung nicht zu erwarten. 4.4 § 6 Absatz 11 und § 13a Absatz 2 Nummer 6 DüV – Beschränkung der Grünlanddüngung Forderung/ Kritik Acht Verbände haben zur Beschränkung der Ausbringungsmenge auf Grünland Stellung ge- nommen. Davon sehen sieben keinen Effekt auf den Gewässerschutz und sechs Verbände er- warten einen Ertragsrückgang sowie den Schwund hochwertiger Gräser. Durch die Begren- zung sei aus Sicht von fünf Verbänden eine weitere Verlagerung der Düngung in das Frühjahr mit entsprechenden Auswirkungen auf die Befahrbarkeit des Bodens und Lagerkapazitäts- probleme zu erwarten. Ebenfalls fünf Verbände erwarten, dass die Regelung den Struktur- wandel in der Landwirtschaft beschleunigen wird und fordern den Bund auf, bei der Schaffung der erforderlichen Lagerkapazitäten zu unterstützen und geeignete Übergangsfristen einzu- führen. Berücksichtigung in der Verordnung zur Änderung der Düngeverordnung Eine alternative Forderung wurde im Rahmen der Stellungnahmen zur SUP nicht vorgebracht. Eine Streichung der Regelungen wäre eine deutliche Abschwächung der Verordnung zur Än- derung der Düngeverordnung und ist auch aufgrund der Vorgaben der EU-Kommission nicht möglich. Da die Begrenzung der Ausbringungsmenge mit positiven Wirkungen auf die Schutz- güter Mensch, Biodiversität, Wasser, Klima und Luft verbunden ist, bleiben die Eingaben un- berücksichtigt. 4.5 § 7 Absatz 5 DüV – Verbot von Ammoniumcarbonat Forderung/ Kritik Ein Verband fordert die Förderung von freiwilligen Maßnahmen statt einer ordnungsrechtli- chen Regelung. Flexible Ansätze würden so behindert. Ein weiterer Verband hat einen alterna- tiven Textvorschlag zur Klarstellung des Gewollten vorgebracht. Berücksichtigung in der Verordnung zur Änderung der Düngeverordnung Das Verbot der Verwendung von Ammoniumcarbonat als Düngemittel ist bereits im Hinblick auf die verbindlichen Vorgaben der NEC-Richtlinie unverzichtbar. Die Kritik kann daher nicht berücksichtigt werden.
SEITE 16 VON 29
5. §§ 8, 9 und 10 DüV Streichung des Nährstoffvergleichs und Einführung
schlagbezogener Aufzeichnungen über Düngungsmaßnahmen
5.1 § 10 Absätze 1 und 2 DüV – schlagbezogene Aufzeichnungspflichten
Forderung/ Kritik
11 Verbände haben zu den Aufzeichnungspflichten Stellung genommen. Sieben Verbände be-
mängeln, dass die Regelung zu einem hohen betrieblichen Aufwand führe, der keine Vorteile
für den Umweltschutz biete. Vier Verbände fordern, dass die Dokumentation der Anzahl der
Tiere und Weideflächen in jährlicher Zusammenfassung erfolgt, um negative Effekte für das
Landschaftsbild die Artenvielfalt und das Tierwohl zu vermeiden. Drei Verbände unterbreite-
ten Vorschläge zur Änderung, z. B. dass die Erstellung der Aufzeichnungspflichten kulturarten-
spezifisch bis zur Ernte und schlagbezogen bis zum März des Folgejahrs erfolgen sollte.
Berücksichtigung in der Verordnung zur Änderung der Düngeverordnung
Eine schlagbezogene Aufzeichnung ist erforderlich um auf den Nährstoffvergleich mit einem
einheitlichen Kontrollwert verzichten zu können. Negative Auswirkungen auf die Schutzgüter
sind durch diese Vorgabe grundsätzlich nicht zu erwarten.
5.2 § 10 Absatz 2 – Aufzeichnungspflicht innerhalb von zwei Tagen
Forderung/ Kritik
451 Bürger und zehn Verbände sehen die Frist als deutlich zu kurz an. Die Bürger fordern die
Frist zur Erstellung schlagbezogener Dokumentationen deutlich – möglichst einheitlich bis
zum 31. März des Folgejahres – zu verlängern.
Berücksichtigung in der Verordnung zur Änderung der Düngeverordnung
Die Forderung hat keinerlei Auswirkungen auf die Schutzgüter und wird daher innerhalb der
Verordnung zur Änderung der Düngeverordnung nicht berücksichtigt.
5.3 § 10 Absatz 3 Nummer 4 b) - d) DüV – Anhebung der Bagatellgrenzen
Forderung/ Kritik
Vier Verbände fordern, dass die Bagatellgrenzen bei Gemüse, Hopfen und Wein von zwei auf
fünf Hektar angehoben werden und ein weiterer Verband fordert die Anhebung der Bagatell-
grenze bei der Aufnahme von Wirtschaftsdüngern und Gärrückständen.
Berücksichtigung in der Verordnung zur Änderung der Düngeverordnung
Die Bagatellgrenzen wurden mit der Verordnung aus dem Jahr 2017 abgesenkt. Negative Um-
weltauswirkungen sind nicht zu erwarten, daher wird die Kritik im Rahmen der Verordnung
zur Änderung der Düngeverordnung nicht berücksichtigt.SEITE 17 VON 29
5.4 Ermächtigung zum Erlass erweiterter Mitteilungs- und Meldepflichten für die Länder
Forderung/ Kritik
Ein Verband fordert, dass die Länder zur Schaffung einer besseren Transparenz weitere Mit-
teilungs- und Meldepflichten erlassen können.
Berücksichtigung in der Verordnung zur Änderung der Düngeverordnung
Diese Forderung wird bereits mit § 13 Absatz 2 berücksichtigt.
6 § 12 Absatz 4 Satz 1 DüV – Lagerkapazität
Forderung/ Kritik
Ein Verband fordert Ausnahmen für Pferdemist, da dieser nur eine geringe Restfeuchte ent-
halte und damit keine oder nur geringe Gefahr der Auswaschung bestünde. Die Regelung
führe zu einem verstärkten Strukturwandel, sodass kleine Betriebe aufgeben und Flächen mit
hoher Biodiversität nicht mehr gepflegt würden.
Berücksichtigung in der Verordnung zur Änderung der Düngeverordnung
Eine spezielle Regelung für Pferdemist innerhalb der Düngeverordnung ist fachlich nicht zu
begründen. Auch Festmist anderer Tierarten und Komposte haben vergleichsweise geringe
Restfeuchten, sodass die in der geltenden Düngeverordnung verankerte Regelung für Fest-
miste und Komposte aus Sicht des Gesetzgebers ausreicht.
7 § 13a Absatz 1 DüV – Anpassung der Länderermächtigungen zum Erlass
von Verordnung
Forderung/ Kritik
Vier Verbände kritisieren, dass die Ausweisung von Phosphatgebieten über die Nitratrichtlinie
und über die Forderungen zur Umsetzung des EuGH-Urteils hinausgehen. Zudem stammten P-
Einträge hauptsächlich aus nichtlandwirtschaftlichen Quellen. Die Regelung habe daher kei-
nen erkennbaren Umweltnutzen und sollte wenn, nur optional ausgestaltet werden. Drei Ver-
bände kritisieren die bisherige Ausweisung belasteter Gebiete. Sieben Verbände halten es für
erforderlich, dass die Möglichkeit einer einzelbetrieblichen Befreiung von den zusätzlichen
Maßnahmen eingeführt wird bzw. vier Verbände fordern, dass die bisherige Befreiung bei
Teilnahme an AUKMen erhalten bleiben müsse. Fünf Verbände fordern hinsichtlich der ver-
pflichtenden Binnendifferenzierung, dass der Fokus auf landwirtschaftliche Einflüsse gelegt
werden müsse und die Kriterien zur Ausweisung statt in einer Verwaltungsvorschrift in der
Düngeverordnung geregelt werden sollten.
Berücksichtigung in der Verordnung zur Änderung der Düngeverordnung
Zu dieser Regelung besteht kein Verhandlungsspielraum mit der EU-Kommission. Diese hat
spezifische Maßnahmen für eutrophierte Gebiete gefordert und verdeutlicht, dass, sollten
diese nicht ausgewiesen werden, die Maßnahmen im gesamten Landesgebiet gelten. Aus
Sicht des Gesetzgebers dient es dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit die zusätzlichen Maß-
nahmen nur auf die als eutrophiert ausgewiesenen Gebiete zu beschränken. Die AusweisungSEITE 18 VON 29
eutrophierter Gebiete hat keine negativen Umweltwirkungen auf andere Schutzgüter. Die ein-
gebrachte Kritik wird daher im Rahmen der Verordnung zur Änderung der Düngeverordnung
nicht berücksichtigt.
8 Aufnahme bundeseinheitlicher, verpflichtender Vorschriften für nitrat-
und phosphatbelastete Gebiete
Forderung/Kritik
Ein Verband kritisiert, dass der Denitrifikationseffekt nicht berücksichtigt werde. Aus Sicht von
zwei weiteren Verbänden sind die verpflichtenden Maßnahmen nicht ortsangepasst und kon-
terkarieren den Gewässerschutz.
Berücksichtigung in der Verordnung zur Änderung der Düngeverordnung
Das Nitratabbaupotential besteht im Sicker- und Grundwasser im Wesentlichen aus organi-
schem Kohlenstoff sowie anorganischen Schwefelverbindungen. Belastbare Aussagen zum
standorttypischen Denitrifikationsgeschehen sowie zum Stofftransport sind nicht ohne eine
ausreichende Charakterisierung der jeweils vorliegenden geohydrologischen Situation und der
Reduktionsmittel möglich. Zudem ist bekannt, dass das Nitratabbauvermögen unter ungünsti-
gen Bedingungen lediglich wenige Jahre, unter günstigen Bedingungen hingegen wesentlich
länger erhalten bleiben kann. Es ist auch nicht immer zweifelsfrei ableitbar, ob eine geringe
Nitratkonzentration im Sicker- und Grundwasser entweder auf eine Denitrifikation oder eine
hohe Grundwasserneubildungsrate oder eine Kombination aus beidem zurückgeführt werden
kann. Im Falle einer hohen Grundwasserneubildungsrate und gleichzeitig geringer Denitrifika-
tion ist trotz geringer Nitratkonzentrationen nicht unbedingt auch von einer vernachlässigba-
ren Nitratfracht auszugehen. Allein mit Blick auf die genannten Unsicherheiten wären abwei-
chende Maßnahmen aufgrund von Denitrifikationseffekten nicht hinreichend begründbar.
Neben den verpflichtenden Maßnahmen müssen die Landesregierungen künftig mindestens
zwei weitere Maßnahmen in belasteten Gebieten vorschreiben. Diese können entweder län-
derspezifische Anforderungen beinhalten oder aus dem Maßnahmenkatalog in § 13a Absatz 3
DüV gewählt werden. Dadurch bietet sich den Ländern zusätzlich die Möglichkeit wirksame
Maßnahmen selbst zu formulieren bzw. geeignete auszuwählen.
Negative Umweltauswirkungen sind durch die Regelungen nicht zu erwarten und die Forde-
rungen werden daher innerhalb der Verordnung zur Änderung der Düngeverordnung nicht
berücksichtigt.
8.1a § 13a Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 DüV – Absenkung des Düngebedarfs um 20 Prozent
Forderung/ Kritik
Insgesamt haben 17 Verbände zu dieser Regelung Stellung genommen. Alle Verbände lehnen
die verpflichtende Absenkung des Düngebedarfs in den belasteten Gebieten ab, da die Unter-
versorgung der Pflanzen fachlich nicht gerechtfertigt sei. Vier Verbände führen an, dass eine
Unterversorgung nicht automatisch mit einer Reduzierung der Stickstoffauswaschung verbun-
den sei. Zehn Verbände erwarten, dass durch die Vorgabe ein starker Humusabbau und damit
schädliche Auswirkungen auf das Schutzgut Boden zu erwarten sind. Ein Verband sieht zudemSEITE 19 VON 29
existenzgefährdende Folgen für Grünlandbetriebe in Norddeutschland. Fünf Verbände sehen
durch die Regelung das Verursacherprinzip nicht ausreichend berücksichtigt.
Zwölf Verbände befürchten, dass aufgrund der Absenkung des Düngebedarfs nur geringere
Produktqualitäten erzeugt werden können und ggf. Produkte aus dem Ausland importiert
werden müssen, was mit hohen Einkommensverlusten, zusätzlichen CO2-Emissionen und da-
mit schädlichen Umweltauswirkungen verbunden sei. Vier Verbände sehen durch die Rege-
lung den freiwilligen Gewässerschutz behindert. Jeweils ein Verband hält die Ausnahmerege-
lungen für unzureichend und erwartet ein höheres Krankheits- oder Schädlingsrisiko.
Berücksichtigung in der Verordnung zur Änderung der Düngeverordnung
Die Forderung kann nicht berücksichtigt werden, da die Absenkung des Düngebedarfs eine
maßgebliche Bedingung der EU-Kommission zur Beilegung des Vertragsverletzungsverfahrens
wegen unzureichender Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie ist.
Die EU-Kommission hält daran fest, dass durch die Vorgabe die Nitrateinträge in die Gewässer
signifikant reduziert werden können. In den Verhandlungen mit der Kommission ist es der
Bundesregierung gelungen, dass die Absenkung nicht schlagbezogen, wie ursprünglich gefor-
dert, sondern im Betriebsdurchschnitt erfolgt. Damit erhalten die Landwirte weiterhin eine
gewisse Flexibilität, bei welchen Kulturen sie die Einsparung erbringen wollen. Damit wird
auch sichergestellt, dass weiterhin Qualitätsgetreide in Deutschland erzeugt werden kann.
Durch den Bezug auf den Betriebsdurchschnitt sind daher kaum Einschränkungen in der Nähr-
stoffversorgung oder auf die bisherige Produktion zu erwarten.
Um einer Abwärtsspirale im Ertrag vorzubeugen, ist im Verordnungsentwurf geregelt, dass zur
Ermittlung des Ertragsniveaus im Rahmen der Düngebedarfsermittlung der Durchschnitt der
Jahre 2015 bis 2019 heranzuziehen ist. Die Ermittlung erfolgt damit auf Basis eines festen Be-
zugszeitraumes.
Darüber hinaus konnte erreicht werden, dass gewässerschonend wirtschaftende Betriebe von
der Verpflichtung zur Absenkung des Düngebedarfs ausgenommen sind.
Hinsichtlich des befürchteten Humusabbaus ist darauf zu verweisen, dass die Vorgabe der Ab-
senkung des Düngebedarfs ausschließlich in den mit Nitrat belasteten Gebieten gelten wird.
In diesen Gebieten wurde überwiegend langjährig organisch gedüngt, sodass von einem ent-
sprechenden Bodenvorrat an Nährstoffen auszugehen ist. Auswirkungen auf den Humusgeh-
alt des Bodens sind daher nicht zu befürchten.
8.1b § 13a Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 DüV – Absenkung des Düngebedarfs auf Grünland um
20 Prozent
Forderung/ Kritik
Acht Verbände haben hierzu Stellung genommen. Neben Einkommenseinbußen, wird ein hö-
herer Mineraldüngereinsatz sowie die Intensivierung extensiv bewirtschafteter Teilflächen er-
wartet. Sieben Verbände fordern daher die generelle Ausnahme von Grünland, da kaum die
Gefahr einer Nitratauswaschung bestehe.
Berücksichtigung in der Verordnung zur Änderung der Düngeverordnung
Die Regelung ist das Ergebnis eines langen Diskussionsprozesses mit der EU-Kommission. Mit
den Ländern und betroffenen Dachverbänden wurde nach geeigneten Alternativen gesucht.SEITE 20 VON 29
Diese wurden von der EU-Kommission jedoch abgelehnt. Ohne die Absenkung des Düngebe-
darfs um 20 Prozent – auch auf Grünland – würde die EU-Kommission das Zweitverfahren ge-
gen Deutschland unverzüglich fortsetzen. Es ist gelungen, dass die Länder unter bestimmten
Bedingungen Ausnahmen von der 20-Prozent-Kürzung im Grünland gewähren können. Es be-
steht kein weiterer Verhandlungsspielraum.
8.2 § 13a Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 DüV – schlagbezogene Berechnung der 170 kg N-
Grenze
Forderung/ Kritik
Vier Verbände kritisieren die Regelung zur schlagbezogenen Aufzeichnung. Organische Dünge-
mittel, die den Betrieben zur Verfügung stehen, würden durch mineralische Düngemittel er-
setzt werden und eigene organische Düngemittel vom Betrieb abgegeben. Dies führe aus
Sicht dreier Verbände zu vermeidbaren Umweltbelastungen. Ein Verband fordert, dass bei in-
tensiver Grünlandnutzung, Feldgrasanbau und dem Nachweis hoher Stickstoffeffizienz auf die
Regelung verzichtet werden müsse.
Berücksichtigung in der Verordnung zur Änderung der Düngeverordnung
Auch diese Maßnahme wurde im Rahmen des Verordnungsgebungsverfahrens intensiv disku-
tiert. Im Ergebnis konnte erreicht werden, dass gewässerschonend wirtschaftende Betriebe
von der Regelung ausgenommen sind. Die schlagspezifische Ausbringungsobergrenze soll ver-
meiden, dass lagerbehälternahe Betriebsflächen einseitig mit organischen Düngemitteln ver-
sorgt werden. Eine möglichst effiziente Verwendung organischer Düngemittel ist anzustreben
und eine entsprechende Verteilung der Nährstoffe unausweichlich. Vor diesem Hintergrund
und mit Blick auf die sonst sehr positiven Umweltwirkungen erscheint ein höheres Transport-
aufkommen vertretbar.
8.3 § 13a Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 DüV – Ausdehnung der Sperrfrist für Grünland
Forderung/ Kritik
Insgesamt acht Verbände kritisieren die Verlängerung der Sperrzeit auf Grünland. Sechs Ver-
bände sehen keine fachliche Notwendigkeit, da unter Grünland keine Auswaschungsgefahr
bestünde. Die Regelung habe zudem aus Sicht von vier Verbänden nachteilige Auswirkungen
auf den Bodenschutz und sechs Verbände sehen den dadurch steigenden Bedarf an Lagerka-
pazität – insbesondere vor dem Hintergrund baurechtlicher Hemmnisse – kritisch.
Berücksichtigung in der Verordnung zur Änderung der Düngeverordnung
Diese Regelung ist eine wesentliche Forderung der EU-Kommission zur Einstellung des Zweit-
verfahrens und stellt bereits einen erreichten Kompromiss dar. Ursprünglich wurde im Ver-
tragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eine allgemein geltende Ausdehnung der Sperr-
zeiten auf Grünland gefordert.SEITE 21 VON 29
8.4 § 13a Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 DüV – Ausdehnung der Sperrfrist für Festmist
Forderung/ Kritik
Sieben Verbände haben zu dieser Regelung Stellung genommen. Sechs Verbände halten die
Regelung für fachlich nicht geboten und sehen daher auch keinen Vorteil für den Gewässer-
schutz. Durch die Ausweitung der Sperrfrist würden Bodenschutzaspekte vernachlässigt, da
aus Sicht von fünf Verbänden die Ausbringung ggf. bei nicht-optimalen Bedingungen erfolgen
müsse. Zudem haben drei Verbände bei einer Verschiebung der Ausbringung ins Frühjahr Be-
denken hinsichtlich der Futterverschmutzung bei Weidehaltung. Fünf Verbände sehen durch
die Regelung insbesondere kleinere landwirtschaftliche Betriebe benachteiligt. Vier Verbände
fordern Ausnahmeregelungen.
Berücksichtigung in der Verordnung zur Änderung der Düngeverordnung
Diese Regelung ist eine wesentliche Forderung der EU-Kommission zur Einstellung des Zweit-
verfahrens und stellt bereits einen erreichten Kompromiss dar. Ursprünglich wurde im Ver-
tragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eine deutliche Ausdehnung der allgemeinen
Sperrzeit für Festmist und Kompost gefordert. Betriebsinhaber haben vor der Ausbringung
von Düngemitteln den Bodenzustand dahingehend zu beurteilen, ob dieser ausreichend trag-
fähig ist. Andernfalls ist die Düngung zu verschieben.
8.5 § 13a Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 DüV – Verbot der Düngung zu Zwischenfrüchten ohne
Futternutzung und Wintergerste
Forderung/ Kritik
15 Verbände haben zum Verbot der Zwischenfruchtdüngung ohne Futternutzung Stellung ge-
nommen.
Davon lehnen 14 Verbände das Verbot der Düngung zu Zwischenfrüchten, Wintergerste und
Raps in den belasteten Gebieten ab, da aus ihrer Sicht ohne eine Andüngung von Zwischen-
früchten eine ausreichende Bestandesentwicklung gefährdet sei. Dies wiederum hätte zur
Folge, dass der Unkrautdruck wachse und somit auch der Pflanzenschutzmittelbedarf.
13 Verbände sehen eine ausreichende Entwicklung für den Erosionsschutz für erforderlich an.
Zwischenfrüchte könnten ohne Düngung im Herbst nicht ihre phytosanitäre Wirkung entfal-
ten.
Drei Verbände befürchten, dass durch das Verbot der Zwischenfruchtdüngung die komplette
Wirtschaftsdüngerausbringung in das Frühjahr verschoben werde, wodurch die Gefahr von
Bodenschäden und Nährstoffausträgen durch Starkregenereignisse erhöht würde und der Be-
darf an Lagerkapazität ansteige. Übergangsfristen und ein beschleunigtes Verfahren zur Ge-
nehmigung und geeignete Förderung seien erforderlich.
Berücksichtigung in der Verordnung zur Änderung der Düngeverordnung
Ein alternativer Vorschlag wurde im Rahmen der Stellungnahmen zur SUP nicht vorgebracht.
Eine Streichung der Regelung ist aufgrund der Vorgaben der EU-Kommission nicht möglich.
Die Eingaben bleiben daher aus folgenden Gründen unberücksichtigt:
- Die Vorgabe des Verbots der Düngung von Zwischenfrüchten und Wintergerste tritt erst
ab dem Jahr 2021 und nur in den belasteten Gebieten in Kraft. Außerdem besteht eine
Ausnahme vom Verbot der Düngung zu Zwischenfrüchten bis zum 1. Oktober 2021 inSEITE 22 VON 29
belasteten Gebieten, wenn ein Bauantrag auf Genehmigung der Errichtung oder Erwei-
terung von Anlagen zur Lagerung von flüssigen Wirtschaftsdüngern gestellt wurde.
- In den Verhandlungen mit der Kommission ist es der Bundesregierung gelungen, dass in
belasteten Gebieten zu Zwischenfrüchten ohne Futternutzung eine Ausbringung von
Festmist und Kompost bis 120 kg N/ha möglich ist.
- In diesen Gebieten ist in der Regel aufgrund langjährig organischer Düngung ein ent-
sprechender Bodenvorrat an Nährstoffen vorhanden, um ein Auflaufen der Zwischen-
früchte zu gewährleisten. Gefahren für den Boden-, Erosions- oder Klimaschutz beste-
hen daher nicht.
- Es liegen keine wissenschaftlichen Studien vor, welche belegen, dass Zwischenfrüchte
und Wintergerste im Herbst und Winter einen Düngebedarf haben. Düngegaben in die-
sem Zeitraum wären daher mit einem hohen Risiko von Nährstoffausträgen verbunden.
- Zudem dienen Zwischenfrüchte vorrangig dem Ziel, den im Boden verbliebenen Rest-
stickstoff der Vorfrucht und des im Herbst und Winter durch Mineralisierung organi-
scher Bodensubstanz freigesetzten Stickstoff aufzunehmen und zu nutzen.
- Die Düngung im Herbst bleibt unter bestimmten Bedingungen zu Winterraps sowie im
Grünland und mehrjährigem Feldfutterbau zulässig. Eine komplette Verlegung in das
Frühjahr erfolgt daher nicht. Betriebsinhaber haben die Ausbringung im Frühjahr dahin-
gehend zu planen, dass schädliche Auswirkungen auf die Bodenbeschaffenheit vermie-
den werden können.
8.6 § 13a Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 f. DüV – Verbot der Düngung zu Zwischenfrüchten
und Wintergerste, Beschränkung der Menge auf 60 kg N/ ha
Forderung/ Kritik
Drei Verbände sehen in der Beschränkung der zulässigen Ausbringungsmenge die bedarfsge-
rechte Nährstoffversorgung im Herbst gefährdet und erwarten, dass organische Düngemittel
durch mineralische ersetzt werden müssen. Zwei Verbände fordern, dass die zulässige Aus-
bringungsmenge auf 80 kg N/ha angehoben werden müsse.
Berücksichtigung in der Verordnung zur Änderung der Düngeverordnung
Es liegen keine belastbaren Untersuchungsergebnisse vor, welche hinreichend belegen kön-
nen, dass eine bedarfsgerechte Nährstoffversorgung der Kulturpflanzenbestände im Herbst
durch die Regelung gefährdet wäre. Es ergeben sich keine negativen Umweltauswirkungen,
sodass der Gesetzgeber an der bestehenden Regelung im Rahmen der Verordnung zur Ände-
rung der Düngeverordnung festhält.
8.7 § 13a Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 DüV – Verpflichtender Zwischenfruchtanbau vor Som-
merkulturen
Forderung/ Kritik
Neun Verbände kritisieren den verpflichtenden Zwischenfruchtanbau vor Sommerkulturen.
Fünf Verbände halten die Verpflichtung für nicht praxistauglich. Acht Verbände sehen es als
erforderlich an, dass die Möglichkeit zur Schwarzbrache erhalten bleibe. Zwei Verbände hal-
ten den für spät erntende Sommerkulturen gesetzten Termin als zu spät. Dieser müsse auf
den 1. September oder spätestens den 15. September vorgezogen werden, damit ein erfolg-Sie können auch lesen