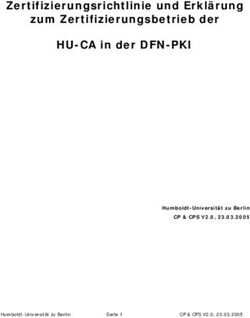6 Fragen zur Bundestagswahl 2013
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
6 Fragen zur Bundestagswahl 2013 Der Hartmannbund hat die Bundestagsparteien mit zentralen gesundheitspolitischen Fragestellungen konfrontiert. Hier sind die Antworten: (1) Krankenversicherung Mit der Gesetzlichen (GKV) und der Privaten Krankenversicherung (PKV) ruht das deutsche Gesundheitssystem auf zwei Säulen. Würden Sie dieses System weiterentwickeln oder halten Sie einen grundsätzlichen Systemumbau für erforderlich? CDU/CSU Wir bekennen uns zum Wettbewerb der Kassen als ordnendes Instrument für eine hochwertige wie effiziente Versorgung. Dazu zählt aus unserer Sicht auch die Möglichkeit der Kassen, sich bei Satzungsleistungen, Wahl- und Zusatztarifen sowie differenzierten Versorgungsangeboten zu unterscheiden. Den in den letzten Jahren eingeschlagenen Weg wollen wir fortsetzen. Eine staatliche Einheitsversicherung für alle lehnen wir entschieden ab. Die PKV und die ihr zugrunde liegende Idee der Bildung von individuellen Kapitalrücklagen, um die steigenden Kosten im Alter abzudämpfen, ist in unserem freiheitlichen Gesundheitssystem ein wichtiges Element der Nachhaltigkeit. FDP Alle Bürger profitieren vom historisch gewachsenen Nebeneinander von GKV und PKV. Der Systemwettbewerb um Preise, Leistungen und Qualität sorgt für eine medizinische Versorgung auf höchstem Niveau. Für einen Systemwechsel gibt es keinen Anlass. SPD Die SPD setzt sich für die notwendige Weiterentwicklung der dualen Gesundheitsfinanzierung zu einer solidarischen Bürgerversicherung in der Kranken- und Pflegeversicherung ein, um in Zukunft die Finanzierung der Versorgung gerechter zu gestalten. Dies ist notwendig, da uns der demografische Wandel und der medizinisch-technische Fortschritt vor enorme Herausforderungen stellen. Unser Modell einer Bürgerversicherung in der GKV setzt sich aus drei Beitragssäulen zusammen: Bürgerbeitrag, Arbeitgeberbeitrag und Steuerbeitrag. Der Bürgerbeitrag wird auf diejenigen Einkommensanteile erhoben, welche sich aus selbständiger und unselbständiger Tätigkeit oder Rentenbezug ergeben. Die Beitragsbemessungsgrenze wird entsprechend dem heutigen Niveau beibehalten und nach dem hergebrachten Verfahren fortgeschrieben. Zusatz- und Sonderbeiträge werden abgeschafft. PKV-Versicherte – insbesondere Rentnerinnen und Rentner, die heute durch PKV-Prämien enorm belastet sind – können über ihren Wechsel in die Bürgerversicherung binnen einer festzusetzenden Frist selbstständig entscheiden. Grüne Die Trennung von GKV und PKV führt vor allem im ambulanten Bereich zu schweren Fehlanreizen. Art und Ausmaß der Behandlung eines Patienten sind vielfach nicht von der Schwere seiner Erkrankung, sondern von der Art seines Krankenversicherungsschutzes abhängig. Auf Ärztinnen und Ärzte wirken massive Anreize, sich vor allem in Regionen mit vielen Privatversicherten niederzulassen – und nicht dort, wo sie dringender gebraucht
Seite 2 von 8
würden. Und ausgerechnet die wirtschaftlich leistungsfähigsten Bevölkerungsgruppen
müssen sich nicht am Solidarausgleich beteiligen. Bündnis 90/Die Grünen setzen sich deshalb
für die Einführung einer Bürgerversicherung ein. Dabei ist das heute insgesamt zur Verfügung
stehende Honorarvolumen für die Ärztinnen und Ärzte und auch das für andere
Gesundheitsberufe zu erhalten.
Linke
Das Nebeneinander von GKV und PKV als Vollversicherung ist unsinnig und einmalig in Europa.
Die PKV schwächt nicht nur die Solidarität, sondern gefährdet auch die finanzielle Stabilität
der GKV. Die PKV selbst ist als eigenständiges Versicherungssystem langfristig nicht
überlebensfähig. Bereits derzeitig existierende Finanzierungsprobleme werden sich in Zukunft
ohne neue junge Mitglieder verstärken. Außerdem führt sie bei nicht wenigen privat
Versicherten zu sozialen Härten, wie der neue Notlagentarif der Bundesregierung erneut
verdeutlicht. Wir schlagen eine gerechte und solidarische Finanzierung als Basis einer
zukunftsfesten und hochwertigen Gesundheitsversorgung vor. Alle in Deutschland lebenden
Menschen werden Mitglied der solidarischen Bürgerinnen- und Bürgerversicherung (BBV).
Sämtliche erforderlichen Leistungen werden zur Verfügung gestellt. Der medizinische
Fortschritt wird einbezogen. Alle entrichten den gleichen Prozentsatz ihres gesamten
Einkommens. Niemand soll aus der Verantwortung entlassen werden – weder durch eine
Privatversicherung, noch durch eine Beitragsbemessungsgrenze, die die höchsten Einkommen
entlastet (vgl. Bundestagsdrucksache 17/7197).
(2) Bürgerversicherung
Ist nicht die Gefahr groß, dass gerade eine Bürgerversicherung zu einer Zwei-Klassen-
Medizin führt? Durchschnittliche Versorgung für den Durchschnitt – bessere Versorgung
für diejenigen, die sich zusätzliche Leistungen „erkaufen“ können?
CDU/CSU
Wenn immer wieder von einer Zwei-Klassen-Medizin die Rede ist, muss man klarstellen, das
bei weitem nicht alle PKV-Verträge überhaupt die gleichen und nicht die besseren Leistungen
anbieten als die GKV. Was immer wieder beschrieben wird, sind die unterschiedlichen
Wartezeiten bei Ärzten. Hier haben wir im GKV-Versorgungsstrukturgesetz geregelt, dass der
Sicherstellungsauftrag der Kassenärztlichen Vereinigungen auch beinhaltet, Versicherten in
einem angemessenen Zeitraum fachärztliche Versorgung zukommen zu lassen. Damit ist in
den Gesamtverträgen auf Landesebene zu regeln, welche Zeiten im Regelfall und im
Ausnahmefall noch eine zeitnahe fachärztliche Versorgung darstellen.
FDP
Die Gefahr einer Zweiklassenmedizin steigt, wenn man den Wettbewerb ausschaltet, die
Wahlfreiheit einschränkt und die Menschen zwangsweise in ein Einheitsversicherungssystem
drängt, wie es die Bürgerversicherungsmodelle der Opposition vorsehen. In einem staatlich
kontrollierten und verwalteten Einheitssystem kommt es viel eher zu Kürzungen des
Leistungskatalogs und Rationierungen. Wer es sich leisten kann, kauft dann zusätzliche
Leistungen. Das zeigt auch der Blick auf andere Länder, die das Gesundheitswesen über
Einheitssysteme organisieren.
SPD
Die SPD setzt sich für eine einheitliche Honorarordnung ein. Die unterschiedliche Vergütung
für alle Bereiche der Versorgung von gesetzlich und privat Krankenversicherten ist die
Hauptursache für die Zwei-Klassen-Medizin. Durch die unterschiedliche Vergütung von privat
Seite 2 von 8Seite 3 von 8
und gesetzlich Versicherten werden falsche Anreize gesetzt, die im gesamten System zu
Fehlentwicklungen führen. Denn nicht die Indikation ist der Hauptmaßstab für Zugang zu
medizinischen Leistungen, sondern die Höhe der Vergütung. Die neue Honorarordnung wird
für Versicherte in der GKV/Bürgerversicherung, wie für Bestandsversicherte der PKV
gleichermaßen gelten. Gegenüber den Leistungserbringern sind Versicherte damit
statusneutral. Dies ist die Voraussetzung für eine gleiche, indikationsbezogene Behandlung.
Gesetzlich Versicherte müssen damit keine Diskriminierungen bei der medizinischen
Behandlung mehr hinnehmen. Auch in Zukunft wird sich der Leistungskatalog an der
Notwendigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit von Leistungen messen lassen
müssen. Zusatzversicherungen werden sich lediglich auf persönliche Bedürfnisse erstrecken,
die ausdrücklich nicht diesen Kriterien folgen. Die einheitliche Honorarordnung soll insgesamt
nicht zu weniger Mitteln für die Versorgung führen. Dafür werden die Honorare entsprechend
aufkommensneutral angepasst.
Grüne
Dahinter steht die These von der Rolle der PKV als vermeintlichem „Innovationsmotor“. Diese
Auffassung teilen wir nicht. Patientinnen und Patienten müssen sich darauf verlassen können,
dass die Therapien und medizinischen Produkte, die zu ihrer Behandlung eingesetzt werden,
ihren Nutzen und ihre Sicherheit auch tatsächlich unter Beweis gestellt haben. Die dafür
erforderlichen Regeln, Verfahren und Institutionen sind in der GKV aber ungleich besser
ausgebaut als in der PKV. Sehr offensichtlich geworden ist das zuletzt im Arzneimittelbereich.
Die PKV bedient sich der von der GKV durchgeführten Frühbewertungen neuer Arzneimittel,
auf deren Grundlage Rabattverhandlungen mit den Herstellern stattfinden, weil sie selbst über
keine entsprechenden Kapazitäten verfügt.
Linke
Das Gegenteil ist der Fall. Das derzeitige Nebeneinander von GKV und PKV hat eine Zwei-
Klassen-Medizin manifestiert. Dabei sollte allein die medizinische Notwendigkeit über die Art
und den Umfang einer Behandlung entscheiden. Nicht jedoch, ob die oder der Betroffene
gesetzlich, privat oder im Basistarif versichert ist. Anspruch linker Gesundheitspolitik ist es,
allen Menschen in Deutschland unabhängig vom Alter oder der Größe des Geldbeutels eine
hochwertige Gesundheitsversorgung zu ermöglichen. Eine unabhängige Studie beweist: Mit
der BBV lässt sich eine qualitativ hochwertige Versorgung langfristig sichern, obwohl die
Beiträge auf 10,5 Prozent gesenkt werden könnten. Die BBV schafft auch die Voraussetzung für
eine umfassende Reform und Aufwertung der ärztlichen Gebührenordnungen.
(3) Freiberuflichkeit des Arztes
Ärztliche Therapiefreiheit und freie Arztwahl sind wesentliche Pfeiler unseres
Gesundheitssystems. Wie schätzen Sie die Risiken ein, dass immer stärkere
Reglementierungen, zunehmende Eingriffe in die Freiberuflichkeit des Arztes und eine
mögliche Einheitsversicherung diese Werte gefährden?
CDU/CSU
Die Therapiefreiheit, die freie Arzt- und Krankenhauswahl für die Patienten sowie die
Unabhängigkeit der freien Gesundheitsberufe im Krankenversicherungssystem bilden für uns
den Kern eines freiheitlichen Gesundheitswesens. Die Beschäftigten in den Kliniken, Praxen
und ambulanten Diensten, niedergelassene Haus-, Fach- und Zahnärzte, Apotheker,
selbstständige Gesundheitshandwerker, Hebammen und Heilmittelerbringer sind Garanten
für eine qualitativ hochwertige, patientennahe Versorgung. Diese Strukturen gilt es zu
bewahren und geänderten gesellschaftlichen Verhältnissen anzupassen.
Seite 3 von 8Seite 4 von 8
FDP
Das Risiko schätzen wir als sehr hoch ein. Für uns Liberale sind Wahlfreiheit, Vielfalt und
Wettbewerb unverzichtbare Grundlagen für ein funktionierendes und leistungsfähiges
Gesundheitssystem. Mit uns wird es keine Beeinträchtigungen von freier Arzt-, Krankenhaus-
und Kassenwahl oder der Freiberuflichkeit der Heilberufe geben.
SPD
Weder stellt die SPD die freie Arztwahl der Patientinnen und Patienten in Frage, noch haben
wir uns für eine Einheitsversicherung ausgesprochen. Wir werben für unsere Vorstellungen
einer Solidarischen Bürgerversicherung, die im Kern die Überwindung der dualen Finanzierung
und die Schaffung eines Marktes der Krankenversicherungen vorsieht, in dem faire
Wettbewerbsbedingungen herrschen. Unser Ziel muss dabei der Wettbewerb um die qualitativ
beste Versorgung der Versicherten sein.
Grüne
In einem über Pflichtbeiträge finanzierten System, in dem es ein erhebliches
Informationsgefälle zwischen den Patientinnen und Patienten und den Ärztinnen und Ärzten
gibt, lassen sich Regulierungen zur Qualitätstransparenz oder auch zur Wirtschaftlichkeit der
Leistungserbringung nicht vollständig vermeiden. Der mit ihnen verbundene Aufwand ist nicht
durchgängig unnötig und zusätzlich, sondern vielfach ein notwendiger Beitrag zur
dauerhaften Aufrechterhaltung einer für alle zugänglichen Gesundheitsversorgung. Allerdings
haben Regulierungsdichte und bürokratischer Aufwand innerhalb des GKV-Systems
überhandgenommen. Das ist wesentlich den falschen Anreizstrukturen geschuldet. Die
ökonomischen Anreize sind zu wenig auf den Gesundheitsnutzen der Patientinnen und
Patienten ausgerichtet. „Belohnt“ werden stattdessen diejenigen, die möglichst viel
diagnostizieren und therapieren. Ökonomische und gesundheitsbezogene Zielstellungen fallen
auseinander. Diese Schere wollen wir etwa durch Veränderungen in den Vergütungssystemen
wieder schließen.
Linke
Die Auswirkungen der neoliberalen Gesundheitspolitik bekommen auch Ärztinnen und Ärzte
zu spüren. Eingriffe in die Therapiefreiheit, die Beschränkung der freien Arztwahl, oder
Fließbandmentalität akzeptiert DIE LINKE nicht. Das vertrauensvolle Arzt-Patienten-Verhältnis
ist ein hohes Gut. Wir setzen uns für eine wissenschaftlich fundierte, evidenzbasierte
medizinische Versorgung ein. Behandlungen sollten auf der Basis von Leitlinien stattfinden, es
sei denn, dem stehen im Einzelfall trifftige Gründe entgegen. Finanzielle Anreize und Zwänge
dürfen keinen Einfluss auf die Versorgung von Patientinnen und Patienten nehmen. DIE LINKE
befürwortet eine transparente und demokratische Selbstverwaltung, obwohl wir durchaus
Defizite bei der Transparenz, der demokratischen Legitimierung und zum Teil der Umsetzung
der Gemeinwohlverpflichtung sehen. Der Gemeinsame Bundesausschuss beweist, dass die
Ausgestaltung des Leistungskataloges auf hohem Niveau durch die gemeinsame
Selbstverwaltung erfolgen kann.
Seite 4 von 8Seite 5 von 8
(4) Krankenhäuser
Die Krankenhäuser verzeichnen einen Investitionsstau in zweistelliger Milliardenhöhe.
Mit welchen Maßnahmen werden Sie sicherstellen, dass die Länder ihrer gesetzlichen
Investitionsverpflichtung nachkommen?
CDU/CSU
Aus unserer Sicht ist es wichtig, die Krankenhäuser auf finanziell solide Füße zu stellen. Dazu
müssen möglichst schnell Länder, Kommunen, der Bund und die Krankenhäuser an einen Tisch.
Und wir sollten zeitnah nach der Wahl beginnen, den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff
umzusetzen. Das sind wir Angehörigen, Pflegerinnen und Pflegern und den Betroffenen selbst
schuldig.
FDP
Es ist Tatsache, dass die Länder ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen. Das
kann vom Bund auch nicht zwangsweise herbeigeführt werden. Wir werden aber alle
Möglichkeiten ausschöpfen, die Länder zu bewegen, ihre Pflichten zu erfüllen. Wir würden ein
monistisches System durchaus für sinnvoll halten.
SPD
Krankenhäuser brauchen eine leistungsgerechte und planbare Finanzierung. Die geteilte
Finanzierungsverantwortung zwischen der GKV für die Behandlungskosten auf der einen und
den Bundesländern für die Investitionskosten auf der anderen Seite erschwert die
angemessene wirtschaftliche Absicherung vieler Krankenhäuser zunehmend. Es ist unser
langfristiges Ziel, die Finanzierung aus einer Hand zu organisieren, um auf diese Weise mehr
Planungssicherheit zu schaffen.
Grüne
Wir schlagen eine Reform der Investitionsfinanzierung vor. Länder und Krankenkassen sollen
sich künftig die Investitionskosten teilen können. Auf jeden Euro, den die Länder bereitstellen,
sollen die Krankenkassen einen Euro drauflegen.
Linke
DIE LINKE fordert eine öffentlich organisierte, angemessen finanzierte und bedarfsgerechte
Krankenhausversorgung. Die Länder müssen eine flächendeckende Krankenhausinfrastruktur
mit ihren Investitionen sichern. Die Krankenkassen haben den Betrieb angemessen zu sichern.
Die derzeit mangelhafte Investitionsfinanzierung liegt meist nicht am politischen Willen in
den Ländern, sondern schlicht an fehlenden Mitteln. Auch deshalb fordern wir eine sozial
gerechte Steuerpolitik des Bundes. Außerdem fordert DIE LINKE seit Jahren in den Beratungen
zum Bundeshaushalt, dass der Bund die finanziell schlecht gestellten Länder 10 Jahre lang mit
jährlich 2,5 Milliarden Euro zum Abbau des Investitionsstaus unterstützen soll, so die Länder
weitere 2,5 Milliarden Euro kofinanzieren. Auf diese Weise könnte innerhalb von 10 Jahren mit
insgesamt 50 Milliarden Euro der Investitionsstau abgebaut werden.
Seite 5 von 8Seite 6 von 8
(5) Ärztemangel
Der Ärztemangel in Kliniken und in der ambulanten Versorgung ist ein akutes Problem.
Welche Konzepte in der Familienpolitik und veränderte Strukturen im
Gesundheitswesen können jungen Ärztinnen und Ärzten eine echte Perspektive
eröffnen, wieder stärker in der kurativen Medizin – ambulant wie stationär – tätig
werden zu wollen?
CDU/CSU
Bereits mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz wurden Maßnahmen zur Steigerung der
Attraktivität des Arztberufes getroffen: Die Möglichkeit für Vertragsärztinnen, sich im
zeitlichen Zusammenhang mit einer Entbindung vertreten zu lassen, wurde zum Beispiel von
sechs auf zwölf Monate verlängert. Die Möglichkeit für die Beschäftigung einer
Entlastungsassistentin bzw. eines Entlastungsassistenten wird für die Erziehung von Kindern
für bis zu 36 Monate sowie für die Pflege von Angehörigen für bis zu sechs Monate eröffnet. Die
Kassenärztlichen Vereinigungen erhalten die Möglichkeit, den 36- bzw. 6-Monatszeitraum zu
verlängern. Bei der Auswahlentscheidung über die Nachbesetzung eines Vertragsarztsitzes in
einem gesperrten Bereich werden Kindererziehungs- bzw. Pflegezeiten, durch die eine
ärztliche Tätigkeit unterbrochen wurde, fiktiv berücksichtigt. In diese Richtung werden wir in
der nächsten Legislaturperiode mit dem Ziel weiterarbeiten, jungen Ärzten eine attraktive
Berufsperspektive zu geben.
FDP
Der Schlüssel liegt in der Planbarkeit der Arbeit und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Die monetären Aspekte sind nach wie vor wichtig, aber nicht mehr allein ausschlaggebend.
Mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz haben wir viele Erleichterungen schaffen können,
zum Beispiel die Aufhebung der Residenzpflicht und die Flexibilisierung der
Elternzeitregelungen. Gerade auch für junge Ärztinnen und Ärzte wird wichtig sein, dass die
Betreuungsmöglichkeiten flächendeckend besser werden und die Angebotszeiten sich besser
am Bedarf orientieren.
SPD
Die SPD will eine moderne Familienpolitik, die Familien dabei unterstützt, ihre
unterschiedlichen Lebensentwürfe bestmöglich zu verwirklichen. Dafür brauchen wir vor allem
eine familienfreundliche Arbeitswelt, gute Ganztagsbildungs- und -betreuungsangebote.
Unsere moderne Familienpolitik orientiert sich an einem Dreiklang aus Infrastruktur, Zeit und
Geld. Vor allem eine gute Infrastruktur wird uns unser Ziel einer besseren Vereinbarkeit von
Beruf und Familie erreichen lassen. Mit Blick auf gute Arbeitsbedingungen und flexible
Arbeitszeitmodelle sind besonders die Arbeitgeber gefragt. Aber auch die Kommunen und
Länder müssen ihren Verpflichtungen nachkommen. Denn nur wenn die persönliche
Lebenswirklichkeit mit der Realität am Arbeitsplatz von Beschäftigten im Gesundheitswesen
in Einklang gebracht wird, kann eine qualitativ hochwertige Versorgung der Patientinnen und
Patienten gesichert werden.
Grüne
Dass junge Ärztinnen und Ärzte in andere Bereiche abwandern, hat viel mit veränderten
Erwartungen an die eigene Erwerbstätigkeit zu tun. Flache Hierarchien, flexible Arbeitszeiten
und familienfreundliche Arbeitsbedingungen, zum Beispiel durch das Angebot betriebseigener
Kinderbetreuung, sind heute wichtige Gründe, sich für oder gegen die Arbeit in einem
Krankenhaus zu entscheiden. Und auch im ambulanten Bereich wirken sich die veränderten
Erwartungshaltungen aus. Längst nicht mehr jeder junge Arzt oder jede junge Ärztin will sich
möglichst schnell in einer Praxis niederlassen und sich so dauerhaft festlegen. Für
Seite 6 von 8Seite 7 von 8
Krankenhausträger, gemeinsame Selbstverwaltung und Politik heißt das: Interne
Veränderungen in den Kliniken sind erforderlich, Ärztinnen und Ärzte müssen zeitweise oder
auch dauerhaft als Angestellte arbeiten können, die Finanzierung der Weiterbildung sowohl im
ambulanten und stationären Bereich muss geklärt werden – für die Krankenhäuser haben wir
vorgeschlagen, einen von Krankenkassen und Krankenhäusern gemeinsamen getragenen
Fonds einzurichten, aus dem arztbezogene Weiterbildungszuschläge finanziert werden – und
die Versorgungsgrenzen zwischen den verschiedenen Sektoren müssen durchlässiger werden.
Auch um jungen Ärztinnen und Ärzten Erfahrungen und Einblicke in verschiedene
Versorgungsbereiche zu ermöglichen.
Linke
Es muss endlich sektorenübergreifend geplant und versorgt werden. Alle Gesundheitsberufe
sollen einbezogen werden, auch die Pflegeberufe, die Heilberufe und die Hebammen. Die
Ermittlung des gesundheitlichen Bedarfs muss auf eine wissenschaftliche Basis gestellt und
kleinräumig organisiert werden. Die ineffektive und teure Trennung von ambulanten und
stationären Einrichtungen ist schrittweise zu überwinden (vgl. Antrag zur Bedarfsplanung, BT-
Drs. 17/3215). Aus Sicht der Partei DIE LINKE sollte es mehr poliklinische Strukturen geben.
Dabei ist das Vordringen von Kapitalgesellschaften zu verhindern. MVZ-Neugründungen
sollten in vorrangig unterversorgten Bereichen erfolgen. Die freie Arztwahl wie auch die
Therapiefreiheit müssen erhalten bleiben.
(6) Flächendeckende Versorgung
Welche Maßnahmen halten Sie für notwendig, um die flächendeckende Versorgung für
die Bevölkerung sicherzustellen? Ist dies auf Dauer auf dem Land überhaupt noch
realistisch? Und ist die Möglichkeit von „Zwangsrekrutierungen“, wie sie sich im Sommer
in Thüringen angedeutet haben, eine realistische Option?
CDU/CSU
Mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz haben wir schon weitreichende Möglichkeiten zur
Förderung der Versorgung geschaffen. Hier nur ein Beispiel: Ärzte, die bereit sind, sich in
unterversorgten Regionen niederzulassen, erhalten eine Vielzahl von finanziellen Anreizen. Sie
werden von Begrenzungen der Vergütung ausgenommen, können Preiszuschläge für ihre
Leistungen erhalten und von den Kassenärztlichen Vereinigungen über einen Strukturfonds
gefördert werden. Unser Ziel ist auch weiterhin, die Anreize so zu setzen, dass die
flächendeckende Versorgung gewährleistet wird. Beim Thema ärztliche Vergütung wurde die
strikte Budgetierung zu einem flexiblen und regionalisierten vertragsärztlichen
Honorarsystem weiterentwickelt. Dies bietet eine verlässliche und leistungsgerechte
Vergütung, welche es für Ärztinnen und Ärzte deutlich attraktiver macht, sich an der
ambulanten Versorgung in unterversorgten oder drohend unterversorgten Gebieten zu
beteiligen. Auch sorgt der damit verbundene Bürokratieabbau für eine höhere
Arbeitszufriedenheit der Ärztinnen und Ärzte. Uns ist wichtig, dass eine gute Versorgung durch
Ärzte und Krankenhäuser auch in ländlichen Regionen gewährleistet bleibt. In dieser
Legislaturperiode haben wir richtige und wichtige Anreize gesetzt. Wir werden diese
Maßnahmen auf ihren Erfolg hin überprüfen und zielgerichtet weiterentwickeln.
FDP
Die wohnortnahe medizinische Versorgung der gesamten Bevölkerung hat für uns oberste
Priorität. Dafür haben wir uns in dieser Wahlperiode eingesetzt und werden es auch in den
kommenden vier Jahren tun. Zwang in jedweder Form wird uns dabei aber genauso wenig
weiterhelfen wie zum Beispiel Honorarabschläge. Vielmehr müssen wir die Vereinbarkeit von
Seite 7 von 8Seite 8 von 8
Familie und Beruf weiter stärken, sinnvolle Anreize für die Niederlassung im ländlichen Raum
setzen und die Planungs- und Nachfolgeregelungen weiter flexibilisieren. Einen wichtigen
ersten Schritt sind wir mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz gegangen. Nun ist es Aufgabe
der Selbstverwaltung, die Maßnahmen vor Ort zu konkretisieren und umzusetzen.
SPD
Im Rahmen der Diskussionen um das GKV-Versorgungsstrukturgesetz hat die SPD konkrete
Vorschläge unterbreitet. Wir haben zahlreiche Maßnahmen vorgeschlagen, wie gerade die
primärärztliche Versorgung gesichert werden kann, zum Beispiel:
Aufkauf von Arztsitzen aus Mitteln der Kassenärztlichen Vereinigungen.
arbeitsentlastende Maßnahmen für die betroffenen Ärztinnen und Ärzte.
Anstellung von Entlastungs- und Dauerassistentinnen und -assistenten (nach §§ 32 und
32b ZV).
Bei Nichtbesetzungsmöglichkeit ist der Arztsitz im Kreise der beteiligten Akteure
auszuschreiben.
Delegation des medizinischen Notfalldienstes in die Hände professioneller mobiler
Notfallversorgungseinheiten.
Praxis-Sharing: Wechselnde ärztliche Besetzung (Allgemeinmedizin und allgemeine
fachärztliche Versorgung)
Mobile Untersuchungseinheiten in unterversorgten Regionen.
Patienten-Shuttles.
Grüne
Größer werdende Versorgungslücken sehen wir vor allem bei der hausärztlichen Versorgung.
Um diese wieder zu schließen, wird ein ganzes Maßnahmenbündel erforderlich sein: Vom
Aufbau von Ärztezentren in Kreisstädten, über das Angebot „rollender Arztpraxen“, bis hin zur
stärkeren Beteiligung von Krankenhäusern an der ambulanten Versorgung. Darüber hinaus ist
in der Primärversorgung eine neue Arbeitsteilung zwischen Ärzteschaft und qualifizierten
Pflegekräften sowie anderen Gesundheitsfachberufen erforderlich.
Linke
Für DIE LINKE ist die Erreichbarkeit gesundheitlicher Leistungen von zentraler Bedeutung.
Modelle wie fahrende und angemessen ausgestattete Arztpraxen, Shuttledienste zu Praxen
oder Poliklinik und Gemeindeschwestern müssen ausgebaut werden. Ärztinnen und Ärzten
muss das Arbeiten auf dem Land erleichtert werden. Einige Tätigkeiten, die heute von
Ärtzinnen und Ärzten erledigt werden, können durch andere Berufsgruppen, beispielsweise
durch Gemeindeschwestern, ausgeführt werden.
Seite 8 von 8Sie können auch lesen