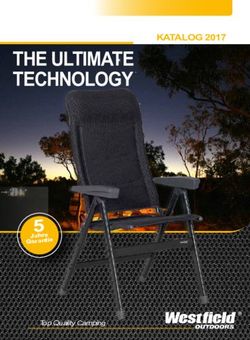Artenschutzfachbeitrag (AFB) zum Bebauungsplan Nr. 73 "Parkplatz Berufsschulcampus in Grünhufe"
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Artenschutzfachbeitrag (AFB)
zum Bebauungsplan Nr. 73
„Parkplatz Berufsschulcampus
in Grünhufe“
Auftraggeber: Hansestadt Stralsund
Amt für Planung und Bau
Abt. Planung und Denkmalpflege
18408 Stralsund
Auftragnehmer und
Bearbeiter: Dipl.-Biol. Thomas Frase
John-Brinckman-Str. 10
18055 Rostock
www.bstf.de
Rostock, 13.01.2022B-Plan 73 Parkplatz Berufsschulcampus in Grünhufe Artenschutzfachbeitrag
Inhaltsverzeichnis
1 EINLEITUNG....................................................................................................................... 3
2 RECHTLICHE GRUNDLAGEN UND METHODIK............................................................... 4
3 PLANUNG UND WIRKFAKTOREN .................................................................................... 9
3.1 PLANUNG ....................................................................................................................... 9
3.2 DARSTELLUNG DER W IRKFAKTOREN DES VORHABENS .................................................... 10
4 ERMITTLUNG DES ZU PRÜFENDEN ARTENSPEKTRUMS ........................................... 12
4.1 RELEVANZPRÜFUNG ..................................................................................................... 12
4.2 ARTERFASSUNG UND UNTERSUCHUNGSRAUM ................................................................ 12
4.2.1 Fledermäuse ....................................................................................................... 13
4.2.2 Brutvögel ............................................................................................................. 13
4.2.3 Reptilien .............................................................................................................. 13
4.2.4 Amphibien ........................................................................................................... 13
5 PRÜFUNGSRELEVANTE ARTEN – BESTANDS- UND KONFLIKTANALYSE ............... 14
5.1 FLEDERMÄUSE ............................................................................................................. 14
5.1.1 Bestandsanalyse ................................................................................................. 14
5.1.2 Konfliktanalyse .................................................................................................... 15
5.2 BRUTVÖGEL ................................................................................................................. 18
5.2.1 Bestands- und Konfliktanalyse der streng geschützten bzw. gefährdeten
Vogelarten......................................................................................................................... 20
5.2.2 Bestands- und Konfliktanalyse der sonstigen europäischen Vogelarten .............. 21
6 MAßNAHMENÜBERSICHT .............................................................................................. 24
6.1 VERMEIDUNGSMAßNAHMEN ........................................................................................... 24
6.2 ERSATZMAßNAHMEN ..................................................................................................... 25
ZUSAMMENFASSUNG ........................................................................................................... 26
7 LITERATUR ...................................................................................................................... 27
8 ANLAGE 1: RELEVANZPRÜFUNG.................................................................................. 30
9 ANLAGE 2: FORMBLÄTTER DER ARTEN DES ANHANGS IV DER FFH-RL ................ 36
10 ANLAGE 3: FORMBLÄTTER DER EUROPÄISCHEN VOGELARTEN ............................ 58
Dipl. Biol. Thomas Frase 2 / 66B-Plan 73 Parkplatz Berufsschulcampus in Grünhufe Artenschutzfachbeitrag
1 Einleitung
Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 73 „Parkplatz Berufsschul-
campus in Grünhufe“ im Stadtgebiet der Hansestadt Stralsund ist auf der Grundlage von Be-
standserfassungen die Prüfung der Einhaltung der Vorgaben des besonderen Artenschutzes
gemäß § 44 (1) Nr. 1-4 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) erforderlich.
In dem vorliegenden Gutachten werden:
die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 (1) BNatSchG, die durch das
Vorhaben erfüllt werden könnten, hinsichtlich der auf europäischer und nationaler Ebene
besonders geschützten Arten ermittelt und dargestellt sowie
die naturschutzfachlichen Voraussetzungen gemäß § 45 (7) BNatSchG für eine Befrei-
ung von den Verboten gemäß § 67 BNatSchG untersucht, soweit für diese nach § 44 (5)
BNatSchG eine Prüfpflicht besteht.
Diese gutachterliche Untersuchung wird folgend als Artenschutzfachbeitrag (AFB) zur speziel-
len artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) bezeichnet.
Der vorliegende Artenschutzfachbeitrag (AFB) folgt methodisch den Vorgaben von FROELICH &
SPORBECK (2010) unter Einbeziehung der Ausführungen von LBV-SH & AFPE (2016), STMI
(2013), EISENBAHN BUNDESAMT (2012), TRAUTNER (2008), LANA (2010) und EU-KOMMISSION
(2007).
Dipl. Biol. Thomas Frase 3 / 66B-Plan 73 Parkplatz Berufsschulcampus in Grünhufe Artenschutzfachbeitrag
2 Rechtliche Grundlagen und Methodik
Im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern unterliegen mehr als 1.000 Tier- und Pflanzenarten
einem gesetzlichen Schutz gemäß der Definition des § 7 (2) Nr. 13 & 14 BNatSchG, für die bei
Planungen und Vorhaben die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorgaben des § 44 (1) Nr.
1-4 BNatSchG zu prüfen ist.
Die Einstufung der Arten in die unterschiedlichen nationalen bzw. internationalen Schutzeinstu-
fungen ist in der folgenden Abbildung 1 dargestellt.
Abbildung 1: Übersicht über das System der geschützten Arten.
Nach den Vorgaben des BNatSchG sind formalrechtlich die Arten der nachstehenden Rechts-
normen in die fachliche Prüfung der Verletzung der Verbote des § 44 (1) Nr. 1-4 BNatSchG ein-
zubeziehen:
Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der FFH-RL (Richtlinie 92/43/EWG) aufgeführt
sind. Diese Arten sind gemäß der Definition des § 7 (2) Nr. 13 und 14 BNatSchG zu-
gleich besonders und streng geschützt.
Europäische Vogelarten im Sinne des Artikels 1 der VS-RL (Richtlinie 2009/147/EG).
Nach LANA (2010) sind alle empfindlichen Arten, d. h. Arten der Roten Liste mit dem
Gefährdungsstatus „vom Aussterben bedroht“, „stark gefährdet“ oder „gefährdet“,
Gegenstand der Betrachtung. Darüber hinaus werden ungefährdete Vogelarten berück-
sichtigt, soweit sie nach BArtSchV Anlage 1, Spalte B als streng geschützt eingestuft
sind. Alle weiterhin vorkommenden Vogelarten werden zu Artengruppen zusammenge-
fasst behandelt.
Dipl. Biol. Thomas Frase 4 / 66B-Plan 73 Parkplatz Berufsschulcampus in Grünhufe Artenschutzfachbeitrag
Arten der Anhänge A und B der EU Artenschutzverordnung (Verordnung EU 338/97 des
Rates). Diese Arten werden gemäß der Definition des § 7 (2) Nr. 13 und 14 BNatSchG
als besonders bzw. streng geschützt eingestuft.
Besonders und streng geschützte Tier- und Pflanzenarten der Anlage 1 der BArtSchV.
Bei der Bearbeitung der artenschutzrechtlichen Prüfung ist gemäß § 44 (5) BNatSchG zu be-
achten, dass bei nach § 15 zulässigen und nach § 17 (1) oder (3) zugelassenen oder von einer
Behörde durchgeführten Eingriffen in Natur und Landschaft sowie bei Vorhaben im Sinne des
§ 18 (2) Satz 1, die Zugriffsverbote nur für in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/ EWG
aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten gelten, die in einer Rechtsve-
rordnung nach § 54 (1) Nr. 2 aufgeführt sind. Sind andere besonders geschützte Arten betrof-
fen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen
die Zugriffsverbote vor.
Da eine entsprechende Rechtsverordnung nach § 54 (1) Nr. 2 derzeit noch aussteht, hat es
sich in der Genehmigungspraxis inzwischen als bestandsmäßig durchgesetzt, dass in den Bun-
desländern allgemein eine fachliche Prüfung der Erfüllung der Verbotstatbestände des § 44 (1)
Nr. 1-4 BNatSchG bezüglich der Vorkommen von Arten des Anhangs IV FFH-RL sowie der Eu-
ropäischen Vogelarten gefordert wird.
Diese Arten werden auch als gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten bezeichnet. Für die
ausschließlich nach BArtSchV und nach EU-ArtSchV besonders geschützten Arten des § 7 (2)
BNatSchG wird die Problembewältigung entsprechend der geltenden Fachpraxis in der Ein-
griffsregelung (§ 15 BNatSchG) erreicht.
Um eine fachlich genügende und nachvollziehbare Prüfung der Verletzung der Verbote des
§ 44 (1) Nr. 1-4 BNatSchG bezüglich der potenziell bestehenden Vorkommen dieser arten-
schutzrechtlich relevanten Arten im Wirkraum einer Planung bzw. eines Vorhabens zu gewähr-
leisten, erfolgt zu Beginn der Untersuchung zum AFB als erster Schritt eine Abschichtung des
zu prüfenden Artenspektrums in Anlehnung an FROELICH & SPORBECK (2010) bzw. LANA
(2010). Im Weiteren werden anhand der von der Planung zu erwartenden Wirkfaktoren die Ver-
botstatbestände nach § 44 (1) BNatSchG für die potenziell betroffenen Arten untersucht (Konf-
liktanalyse). Aus den Ergebnissen weiterer naturschutzfachlicher Untersuchungen in Verbin-
dung mit den Habitatansprüchen der Arten werden ggf. Maßnahmen zur Vermeidung von Be-
einträchtigungen (z. B. Bauzeitenregelung) in die Untersuchung der Verbotstatbestände einbe-
zogen.
Die Konfliktanalyse wird anhand der im § 44 (1) Nr. 1-4 BNatSchG aufgeführten sogenannten
Zugriffsverboten durchgeführt. Diese lassen sich in drei Komplexen behandeln:
1. Tötungsverbot der besonders geschützten Tiere u. Pflanzen (§ 44 (1) Nr. 1 & 4
BNatSchG)
Hierzu ist in der Konfliktanalyse folgende Frage zu beantworten:
Werden wild lebende Tiere oder wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten getö-
tet oder ihre Entwicklungsformen beschädigt oder zerstört?
Die Faktoren nachstellen und fangen kommen im Zusammenhang mit Eingriffen in Natur und
Landschaft gewöhnlich nicht zum Tragen und sind in diesem Zusammenhang von vornherein
auszuschließen.
Dipl. Biol. Thomas Frase 5 / 66B-Plan 73 Parkplatz Berufsschulcampus in Grünhufe Artenschutzfachbeitrag
2. Störungsverbot der streng geschützten Arten und der Europäischen Vogelarten
(§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG)
Hierzu ist in der Konfliktanalyse folgende Frage zu beantworten:
Werden wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten er-
heblich gestört?
Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der loka-
len Population einer Art verschlechtert.
3. Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestätten bzw. Standorten der be-
sonders geschützten Tier- und Pflanzenarten (§ 44 (1) Nr. 3 & 4 BNatSchG)
Hierzu ist in der Konfliktanalyse folgende Frage zu beantworten:
Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten der besonders geschützten Tiere bzw. Standorte der
besonders geschützten Pflanzen entnommen, beschädigt oder zerstört?
Grundsätzlich greift der Verbotstatbestand des § 44 (1) 3 BNatSchG dann, wenn ganze, regel-
mäßig genutzte Reviere oder Fortpflanzungsstätten sowie Ruhestätten beseitigt werden. Als
Beseitigung im Sinne des Gesetzes ist eine direkte Überprägung der Fortpflanzungs- und Ru-
hestätte bzw. wesentlicher Teile der Fortpflanzungs- und Ruhestätte sowie eine durch äußere
Einflussfaktoren, wie z. B. Störungen, hervorgerufene Nichtmehrnutzung der Fortpflanzungs-
und Ruhestätte anzusehen.
Nach § 44 (5) liegt jedoch für entsprechende Eingriffe und Vorhaben kein Verstoß gegen ein-
zelne Zugriffsverbote vor, wenn:
1. das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifi-
kant erhöht und dieses Risiko bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten
Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann,
2. die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme,
die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen
vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen
Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet
ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind,
3. die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Hierzu ist
es möglich, vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festzulegen, die als CEF-Maßnahmen
(continuous ecological funktionality-measures) die kontinuierliche ökologische Funktio-
nalität betroffener Fortpflanzungs-oder Ruhestätten gewährleisten.
Demnach kann § 44 (5) BNatSchG dann genutzt werden, wenn nach Ausschöpfung aller ver-
hältnismäßigen Vermeidungsmaßnahmen ein Restrisiko der Tötung bzw. Verletzung bestehen
bleibt, das dem „allgemeinen Lebensrisiko“ entspricht, welches in der vom Menschen besiedel-
ten Kulturlandschaft immer gegeben ist (LBV-SH & AFPE 2016).
Von den Zugriffsverboten des § 44 (1) BNatSchG können die zuständigen Landesbehörden im
Einzelfall auf der Grundlage von § 45 (7) BNatSchG unter besonderen Bedingungen Ausnah-
men zulassen:
Dipl. Biol. Thomas Frase 6 / 66B-Plan 73 Parkplatz Berufsschulcampus in Grünhufe Artenschutzfachbeitrag
1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher
wirtschaftlicher Schäden,
2. zum Schutz der heimischen Tier- und Pflanzenwelt,
3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken
dienenden Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung,
4. im öffentlichen Interesse (Gesundheit, öffentliche Sicherheit, günstige Auswirkung auf
die Umwelt) oder
5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses ein-
schließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art.
Eine Ausnahme ist jedoch nur dann zu erteilen, wenn alle Ausnahmevoraussetzungen durch
eine Planung oder ein Vorhaben erfüllt werden. Konkret bedeutet das:
wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und
sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert.
Um den Erhaltungszustand einer Population zu sichern, können FCS-Maßnahmen (favourable
conservation status - günstiger Erhaltungszustand) ergriffen werden. Hinsichtlich der zeitlichen
und räumlichen Komponenten besteht bei diesen Maßnahmen eine größere Flexibilität als bei
vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen.
In der nachfolgenden Abbildung werden der Prüfablauf der saP sowie die Prüfung der Ausnah-
metatbestände gemäß § 45 (7) BNatSchG schematisch dargestellt.
Dipl. Biol. Thomas Frase 7 / 66B-Plan 73 Parkplatz Berufsschulcampus in Grünhufe Artenschutzfachbeitrag
Abbildung 2: Schematische Darstellung des Prüfablaufs der speziellen artenschutzrechtlichen
Prüfung – saP (aus BERNOTAT et al. 2018).
Dipl. Biol. Thomas Frase 8 / 66B-Plan 73 Parkplatz Berufsschulcampus in Grünhufe Artenschutzfachbeitrag
3 Planung und Wirkfaktoren
3.1 Planung
Alle Planungsdetails wurden der Begründung zum Planvorentwurf mit Stand vom Februar 2021
sowie dem Plan mit geändertem Geltungsbereich vom Dezember 2021 entnommen. Bei we-
sentlichen Änderungen der Planung muss gegebenenfalls der AFB bzw. müssen die hier abge-
leiteten Maßnahmen angepasst werden.
Das Plangebiet befindet sich im Stadtgebiet Grünhufe, Stadtteil Freienlande. Der ca. 1,3 ha
große Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst Teile der Flurstücke 281, 282, 283, 287,
288, 289, 274/4 und 466 der Flur 1 der Gemarkung Grünhufe. Er wird wie folgt begrenzt:
Im Westen, Norden und Osten durch den Stadtteilpark Grünhufe (nördlicher Teil) und
im Süden durch die Lindenallee.
Ziel der Planung ist die Schaffung von Stellflächen sowie einer Sporthalle für den Berufsschul-
campus Grünhufe.
Abbildung 3: Lage des Geltungsbereichs des B-Plan Nr. 73 im Stadtgebiet der Hansestadt Stral-
sund.
Dipl. Biol. Thomas Frase 9 / 66B-Plan 73 Parkplatz Berufsschulcampus in Grünhufe Artenschutzfachbeitrag
3.2 Darstellung der Wirkfaktoren des Vorhabens
Der Bebauungsplan Nr. 73 der Hansestadt Stralsund „Parkplatz Berufsschulcampus in
Grünhufe“ kann bau-, anlage- und betriebsbedingt unterschiedliche Wirkungen auf die streng
geschützten Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten entfalten, was
im Einzelfall zu Verletzungen der Verbotstatbestände des § 44 (1) Nr. 1 - 4 BNatSchG führen
könnte. Nachfolgend werden die potenziell artenschutzrechtlich relevanten Beeinträchtigungen
der zu betrachtenden Arten bzw. Artengruppen aufgeführt. Die dargestellten Beeinträchtigun-
gen sind derart formuliert, dass jeweils nur ein Verbotstatbestand des § 44 (1) BNatSchG erfüllt
sein könnte. Somit entstehen möglicherweise nahezu gleichlautende Formulierungen, die je-
doch Bezug auf unterschiedliche Verbotstatbestände nehmen. Diese Vorgehensweise ermög-
licht eine klare und nachvollziehbare Prüfung der vorgehend in Kapitel 2 (Methodik) dargestell-
ten und im artenschutzrechtlichen Gutachten zu beantwortenden Fragestellungen.
Zu den potenziell zu erwartenden Wirkungen zählen:
1. baubedingte Beeinträchtigungen
Als baubedingte Beeinträchtigungen von streng geschützten Pflanzen- und Tierarten des An-
hangs IV FFH-RL sowie Europäischen Vogelarten, die im Sinne der artenschutzrechtlichen Re-
gelungen erheblich sein könnten, sind im Wesentlichen folgende Sachverhalte zu prüfen:
1/a – Schadstoffemissionen durch den Baustellenbetrieb, z. B. durch die eingesetzten
Baugeräte und Fahrzeuge (Abgase, Leckagen, Einsatz wassergefährdender Stoffe
u. ä.), und damit verbunden die potenzielle Gefährdung von Fortpflanzungs- und
Lebensstätten von Tieren sowie Standorten von Pflanzen (§ 44 (1) Nr. 3 & 4
BNatSchG),
1/b –°Vergrämung und Verdrängung durch visuelle Effekte, Scheuchwirkungen, Erschüt-
terungen und Schallemissionen durch Baugeräte, Aushubarbeiten, Baustellenfahr-
zeuge und im Baustellenbereich anwesende Personen (zu § 44 (1) Nr. 2
BNatSchG),
1/c –°Flächeninanspruchnahme durch Baustelleneinrichtung und Arbeitsstreifen; und
damit verbunden die mögliche Zerschneidung von Wanderrouten durch Baustel-
leneinrichtung und Fahrtrassen (zu § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG),
1/d –°Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch Gehölzentnahme und Flä-
chenberäumung bei der Bauvorbereitung sowie während der Bauphase (zu § 44
(1) Nr. 3 BNatSchG),
1/e –°Verlust von Individuen durch Gehölzentnahme und Flächenberäumung bei der
Bauvorbereitung sowie während der Bauarbeiten (zu § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG).
2. anlagebedingte Beeinträchtigungen
Als anlagebedingte Beeinträchtigungen von streng geschützten Pflanzen- und Tierarten des
Anhangs IV FFH-RL sowie Europäischen Vogelarten, die im Sinne der artenschutzrechtlichen
Regelungen erheblich sein könnten, sind im Wesentlichen folgende Sachverhalte zu prüfen:
2/a –°dauerhafte Flächeninanspruchnahme von Lebensräumen und damit dauerhafter
Entzug als Lebensraum für streng geschützte Pflanzen- und Tierarten sowie Euro-
päische Vogelarten in Folge der Gehölzentnahme und Überbauung der Flächen
(zu § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG).
Dipl. Biol. Thomas Frase 10 / 66B-Plan 73 Parkplatz Berufsschulcampus in Grünhufe Artenschutzfachbeitrag
3. betriebsbedingte Beeinträchtigungen
Als betriebsbedingte Beeinträchtigungen von streng geschützten Pflanzen- und Tierarten des
Anhangs IV FFH-RL sowie Europäischen Vogelarten, die im Sinne der artenschutzrechtlichen
Regelungen erheblich sein könnten, sind im Wesentlichen folgende Sachverhalte zu prüfen:
3/a –°Scheuchwirkungen und Vergrämung durch Bewegungsreize und Geräuschemis-
sionen in Folge des Betriebs der Sporthalle und des Parkplatzes (zu § 44 (1) Nr. 2
BNatSchG).
Nach der vorgehenden Aufstellung der potenziell wirksamen Beeinträchtigungen von streng
geschützten Arten sowie von Europäischen Vogelarten ist nicht prinzipiell davon auszugehen,
dass durch das Vorhaben bau-, anlage- und betriebsbedingt eine Erfüllung der Verbotstatbe-
stände des § 44 (1) BNatSchG auszuschließen ist.
Dementsprechend folgt im nächsten Schritt die eigentliche artenschutzrechtliche Prüfung aus
gutachterlicher Sicht.
Dipl. Biol. Thomas Frase 11 / 66B-Plan 73 Parkplatz Berufsschulcampus in Grünhufe Artenschutzfachbeitrag
4 Ermittlung des zu prüfenden Artenspektrums
4.1 Relevanzprüfung
Um eine fachlich genügende und nachvollziehbare Prüfung der Verletzung der Verbote des
§ 44 (1) Nr. 1-4 BNatSchG bezüglich der potenziell bestehenden Vorkommen dieser arten-
schutzrechtlich relevanten Arten im Wirkraum einer Planung bzw. eines Vorhabens zu gewähr-
leisten, erfolgt zu Beginn der Untersuchung zum AFB als erster Schritt eine Abschichtung des
zu prüfenden Artenspektrums in Anlehnung an FROELICH & SPORBECK (2010). Diese Vorge-
hensweise (Relevanzprüfung) wird auch von STMI (2013) sowie der LANA (2010) empfohlen.
Die Abschichtung erfolgt über das potenzielle oder reale Vorkommen der Arten im Untersu-
chungsraum. Dafür werden folgende Kriterien herangezogen:
Eine Art ist untersuchungsrelevant, wenn
ein positiver Vorkommensnachweis durch eine Untersuchung vorliegt oder
die Art auf Grund der vorhandenen Lebensraumausstattung potenziell vorkommen kann,
eine Untersuchung jedoch nicht stattfand.
Eine Art ist nicht untersuchungsrelevant, wenn
sie im Untersuchungsraum als ausgestorben oder verschollen gilt bzw. die Art bei den
durchgeführten Untersuchungen nicht nachgewiesen werden konnte oder
ihr Vorkommen außerhalb des Wirkraums des Vorhabens liegt (d. h. ihr Verbreitungs-
gebiet sich nicht auf den Wirkraum des Vorhabens erstreckt oder ihr Vorkommen im
Wirkraum auf Grund fehlender notwendiger Lebensraumausstattung nach fachlicher
Einschätzung unwahrscheinlich ist).
Die Abschichtung erfolgt in Mecklenburg-Vorpommern einheitlich in tabellarischer Form nach
den Vorgaben von FROELICH & SPORBECK (2010). Die entsprechenden Tabellen befinden sich in
Anlage 1: Tabellen A-1 und A-2.
4.2 Arterfassung und Untersuchungsraum
Gemäß § 44 (1) Nr. 1 - 4 BNatSchG unterliegen neben allen Europäischen Vogelarten auch die
Arten des Anhangs IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) der Europäischen Union
(92/43/EWG) den in diesem Paragraphen aufgeführten Zugriffsverboten. Dabei handelt es sich
um ausgewählte Arten der Säugetiere, Reptilien, Amphibien, Fische, Pflanzen, Mollusken und
einzelner Insektengruppen.
Der AFB baut auf Kartierungen zu den Artengruppen Fledermäuse, Brutvögel, Amphibien und
Reptilien auf, die im Jahr 2021 (BSTF 2021a) vorgenommen wurden. Die Kartierungen erfolg-
ten für diese Artengruppen im alten Geltungsbereich zuzüglich eines Umfelds von 50 m (siehe
Abbildung 5). Weiterhin wurde am 08.12.2021 die neu hinzugekommene Fläche eines ange-
passten Geltungsbereichs begutachtet und auf potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten
untersucht sowie der lokale Artbestand mittels Potenzialanalyse abgeschätzt (BSTF 2021b).
Dipl. Biol. Thomas Frase 12 / 66B-Plan 73 Parkplatz Berufsschulcampus in Grünhufe Artenschutzfachbeitrag 4.2.1 Fledermäuse Aus der Gruppe der Säugetiere weisen die Fledermäuse eine artenschutzrechtliche Relevanz auf. Bezüglich dieser Gruppe erfolgten Erfassungen der Baumquartieren sowie Erfassungen von potenziell nutzbaren Quartierstrukturen in Bäumen. Die Auswahl der Erfassungsmethoden ist von der jeweiligen Aufgabenstellung abhängig und folgte den Vorgaben von MESCHEDE & HELLER (2000) UND DIETZ & SIMON (2005). Die Gruppe der Fledermäuse wird nachfolgend artenschutzrechtlich bearbeitet. 4.2.2 Brutvögel Die Ermittlung der Brutvögel im Untersuchungsraum erfolgte im Rahmen von acht Kartiergängen (davon zwei Nachtbegehungen) im Zeitraum vom 03. März bis 07. Juni 2021. Die Methodik der Brutvogelerfassung richtet sich nach SÜDBECK et al. (2005) und entspricht den allgemein anerkannten Standards der Brutvogelerfassung. Die Brutvögel werden nachfolgend artenschutzrechtlich bearbeitet. 4.2.3 Reptilien Zum Nachweis von Reptilien wurden vom 13. April bis zum 07. Juni 2020 regelmäßig alle als Sonnplätze geeignete Habitate – insbesondere Randbereiche und Ruderalfluren – aufgesucht. Tagesverstecke wie Holzstücke, flächige Ablagerungen oder Steine sind im Rahmen der Kartie- rungen aufgedeckt und kontrolliert worden. Weiterhin erfolgte eine Erfassung der Reptilien mit- tels künstlicher Verstecke („Reptilienpappen“). Es wurden keine artenschutzrechtlich relevanten Reptilien im Untersuchungsgebiet nachgewie- sen. 4.2.4 Amphibien Eine gezielte Erfassung der Amphibien erfolgte im Rahmen von Gewässerbegehungen sowie Kontrollen der Wege auf wandernde oder überfahrene Individuen vom 03. März bis zum 07. Juni 2021. Wasserführende Gewässer wurden gezielt abgekeschert sowie mit Amphibien- Lebendfallen nach SCHLÜPPMANN (2009) und KRONSHAGE & GLANDT (2014) untersucht. Weiter- hin wurde auf Hör- und Sichtnachweise (z. B. abspringende und rufende Amphibien) geachtet und Biotope, die als Verstecke geeignet sind, abgesucht. Es wurden keine artenschutzrechtlich relevanten Amphibien im Untersuchungsgebiet nachge- wiesen. Dipl. Biol. Thomas Frase 13 / 66
B-Plan 73 Parkplatz Berufsschulcampus in Grünhufe Artenschutzfachbeitrag 5 Prüfungsrelevante Arten – Bestands- und Konfliktanalyse 5.1 Fledermäuse 5.1.1 Bestandsanalyse Die Untersuchungen auf Winterquartiere oder Schwarmquartiere erbrachte keine Nachweise im Gehölzbestand des Untersuchungsgebiets. Auch mit den Wildkameras wurden keine Fleder- mäuse nachgewiesen. Somit kann davon ausgegangen werden, dass im Untersuchungsgebiet keine größeren Wochenstuben oder Winterquartiere vorhanden sind. Allerdings wurden im Ge- hölzbestand 11 Bäume mit 11 potenziell nutzbaren Quartierstrukturen erfasst (Abbildung 4). Weiterhin muss zumindest im Geltungsbereich von einer Nutzung als Jagdgebiet ausgegangen werden. Dafür in Betracht kommen die in Tabelle 1 aufgeführten sieben Fledermausarten. Abbildung 4: Lage der potenziell nutzbaren Quartierstrukturen im Gehölzbestand. Dipl. Biol. Thomas Frase 14 / 66
B-Plan 73 Parkplatz Berufsschulcampus in Grünhufe Artenschutzfachbeitrag
Tabelle 1: Potenziell im Untersuchungsgebiet vorkommende Fledermausarten
wissenschaftlicher Name deutscher Name Schutz / Gefährdung
Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus MV 3, D G, FFH IV, BASV
Myotis daubentonii Wasserfledermaus MV 4, FFH IV, BASV
Myotis nattereri Fransenfledermaus MV 3, FFH IV, BASV
Nyctalus noctula Abendsegler MV 3, D V, FFH IV, BASV
Pipistellus pygmaeus Mückenfledermaus MV - , D D, FFH IV, BASV
Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus MV 4, FFH IV, BASV
Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus MV 4, FFH IV, BASV
Plecotus auritus Braunes Langohr MV 4, D V, FFH IV, BASV
*Schutz / Gefährdung: Rote Liste Mecklenburg-Vorpommerns (LABES et al. 1991): MV 1 - Vom Aussterben bedroht; MV 2 -
Stark gefährdet; MV 3 - Gefährdet; MV 4 - Potenziell gefährdet; - -bislang wurde h wenn keine
Einstufung vorgenommen, da erst nach Erscheinen der RL als eigene Art bestätigt.
Rote Liste Deutschlands (MEINIG et al. 2020): D V - Vorwarnliste, D G - Gefährdung unbekannten
Ausmaßes; D - Daten unzureichend.
BASV: Nach der Bundesartenschutzverordnung besonders geschützte Art.
FFH IV: Anhang. IV der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie)
5.1.2 Konfliktanalyse
Im Folgenden werden die Zugriffsverbote des Artenschutzrechts für alle Fledermausarten ge-
meinsam dargestellt und abgeprüft. Auf eine einzelartliche Prüfung wird aus Gründen der Über-
sichtlichkeit verzichtet.
Tötungsverbot (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG)
Im Geltungsbereich sollen die Gehölzbestände auf den Standorten der Sporthalle und der
Parkplätze gerodet werden. Nach bisherigem Planungsstand werden die potenziellen Quartiere
Nr. 1, 2 und 7 verlorengehen.
Allgemeingültige und längerfristig gültige Aussagen und Sicherheiten sind durch die hohe Quar-
tierwechseldynamik baumbewohnender Fledermausarten artenschutzrechtlich kaum zu erbrin-
gen. Insbesondere schwer nachzuweisende Einzeltiere und kleine Gruppen können bei den
Erfassungen leicht übersehen werden. Somit muss davon ausgegangen werden, dass alle po-
tenziell nutzbaren Quartierstrukturen zeitweise besetzt sein können. Um die Tötung oder Ver-
letzung von Fledermäusen im Rahmen der Baufeldberäumung auszuschließen, ist es empfeh-
lenswert, die Zeiträume mit dem geringsten Gefährdungspotenzial für die Entnahme der Bäume
vorzusehen. Für risikominimierte Fällungen bietet sich im Allgemeinen der Zeitraum von Mitte
August bis Mitte Oktober an, da die Tiere in dieser Zeit temperaturbedingt über eine relativ hohe
Mobilität verfügen. Allerdings stehen dem die Brutzeiten der Vögel entgegen (siehe unten). Ein-
griffe in die Gehölzbestände des Baufeldes sollten daher nur im Einklang mit den Vermei-
dungsmaßnahmen der im Baufeld nachgewiesenen Brutvögel erfolgen.
Somit ist es notwendig, dass unmittelbar vor Beginn der Rodungsarbeiten durch eine fachkun-
dige Person im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung (ÖBB) eine detaillierte Untersu-
chung der Quartierstrukturen Nr. 1, 2 und 7 auf Fledermäuse erfolgt und eine Besiedelung der
Dipl. Biol. Thomas Frase 15 / 66B-Plan 73 Parkplatz Berufsschulcampus in Grünhufe Artenschutzfachbeitrag
Gehölze ausgeschlossen wurde. Bei Funden von Fledermäusen sind die Fällarbeiten in dem
Bereich zunächst einzustellen und die ÖBB stimmt sich mit der unteren Naturschutzbehörde
(UNB) über das weitere Vorgehen ab.
Hieraus ergibt sich die Empfehlung bei geplanten Baumfällungen eine fachlich versierte ökolo-
gische Baubegleitung zu gewährleisten, um Tötungen sicher vermeiden zu können.
Vermeidungsmaßnahme V 1
Maßnahme Einsatz einer fachlich versierten ökologischen Baubegleitung (ÖBB), die die Entnahme der
Gehölze betreut und diese im Vorfeld auf Besatz kontrolliert. Bei Funden von Fledermäusen in
den betroffenen Gehölzen werden die Fällarbeiten eingestellt und die ÖBB stimmt sich mit der
unteren Naturschutzbehörde (UNB) über das weitere Vorgehen ab.
Begründung Vermeidung der Verletzung, Tötung und Störung
Zielarten Fledermäuse
Störungsverbot (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG)
Hinsichtlich der von der Baustelle ausgehenden akustischen und optischen Störreize kann, auf-
grund lediglich geringer Überschneidungen der Aktivitätszeiten der dämmerungs- und nachtak-
tiven Fledermäuse mit den am Tage stattfindenden Bautätigkeiten, eine Betroffenheit ausge-
schlossen werden.
Anlage- und betriebsbedingte Störungen im Bereich der Bebauung ergeben sich aus der Instal-
lation einer Nachtbeleuchtung und der damit verbundenen Beeinträchtigung von Jagdhabitaten.
Um die Störungen soweit aufzufangen, dass sie auf die lokale Population nicht „erheblich“ wir-
ken, ist es erforderlich, die Beleuchtung auf dem überplanten Gebiet auf ein notwendiges Maß
zu beschränken (VOIGT et al. 2019, SCHROER et al. 2019). Das bedeutet im Besonderen:
• Die Beleuchtungsstärke darf nicht über die nach EU-Standards erforderlichen
Mindestmaße hinaus gehen.
• Vermeidung störender Lichtausbreitung in angrenzende Räume durch gerichtete
Beleuchtung von oben nach unten.
• Einsatz von vollabgeschirmten LED-Lampen mit Farbtemperaturen von 2.700
Kelvin oder weniger sowie Wellenlängen > 540 nm.
Vermeidungsmaßnahme V 2
Maßnahme Beschränkung der Außenbeleuchtung im Plangebiet:
Die Beleuchtungsstärke darf nicht über die nach EU-Standards erforderliche Mindest-
maß hinaus gehen,
Vermeidung störender Lichtausbreitung in angrenzende Räume durch gerichtete Be-
leuchtung von oben nach unten,
Einsatz von vollabgeschirmten LED-Lampen mit Farbtemperaturen von 2.700 Kelvin
oder weniger sowie Wellenlängen > 540 nm.
Begründung Vermeidung der erheblichen Störung der lokalen Population
Zielarten Fledermäuse
Bei Einhaltung der vorgenannten Maßnahmen kann ausgeschlossen werden, dass der Verbots-
tatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG im Zusammenhang mit dem Vorhaben eintritt.
Dipl. Biol. Thomas Frase 16 / 66B-Plan 73 Parkplatz Berufsschulcampus in Grünhufe Artenschutzfachbeitrag
Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 3 i.V.m § 44 (5)
BNatSchG)
Da die potenziellen Quartierstrukturen Nr. 1, 2 und 7 betroffen sein werden, müssen diese
durch geeignete Kästen im Verhältnis von 1:1 (Verlust zu Ersatz, geringe Quartierwertigkeit)
ersetzt werden. Die Auswahl und Anbringung der drei Ersatzquartiere sollte in den umliegenden
Gehölzbeständen nach folgenden Kriterien erfolgen:
• 2 Stk. Fledermaushöhle mit zwei Einschlüpfen 12 mm (nistkasten-hasselfeldt.de)
• 1 Stk. Fledermaushöhle mit dreifacher Vorderwand 18 mm (nistkasten-
hasselfeldt.de)
• Anbringung in unterschiedlichen Höhen (> 5 m - Schutz vor Vandalismus)
• Anbringung mit unterschiedlicher Exposition (von schattig bis sonnig, am Be-
standsrand / im Bestand)
• Gewährleistung guter Anflugmöglichkeiten (Beseitigung der unteren Äste und auf-
kommender Gehölze)
• Gewährleistung einer langen Hangzeit (> 10 Jahre) durch a) die Auswahl günsti-
ger Gehölzbestände mit hoher Umtriebszeit und b) durch die Verwendung einer
zweckmäßigen Aufhängevorrichtung (Dickenwachstum!)
Diese Maßnahme muss vor der Entnahme der Gehölze abgeschlossen und funktionsfähig sein.
Bei Einhaltung der vorgeschlagenen Maßnahmen sind erhebliche Beeinträchtigungen der Fle-
dermausarten im Untersuchungsgebiet auszuschließen, es liegt kein Verstoß gegen die Verbo-
te des § 44 (1) Nr. 1 - 3 BNatSchG vor.
Ersatzmaßnahme CEF 1
Maßnahme Anbringen von 3 Fledermauskästen in den umliegenden Gehölzen nach folgenden Kriterien:
2 Stk. Fledermaushöhle mit zwei Einschlüpfen 12 mm (nistkasten-hasselfeldt.de)
1 Stk. Fledermaushöhle mit dreifacher Vorderwand 18 mm (nistkasten-hasselfeldt.de)
Anbringung in unterschiedlichen Höhen > 5 m (Schutz vor Vandalismus)
Anbringung mit unterschiedlicher Exposition (von schattig bis sonnig, am Bestands-
rand / im Bestand)
Gewährleistung guter Anflugmöglichkeiten (Beseitigung der unteren Äste und auf-
kommender Gehölze)
Gewährleistung einer langen Hangzeit (> 10 Jahre) durch a) die Auswahl günstiger
Gehölzbestände mit hoher Umtriebszeit und b) durch die Verwendung einer zweckmä-
ßigen Aufhängevorrichtung (Dickenwachstum!).
Diese Maßnahme muss vor der Entnahme der Gehölze abgeschlossen und funktionsfähig
sein.
Begründung Sicherung der ökologischen Funktion von Fortpflanzungs- und Ruhestätten
Zielarten Fledermäuse
Dipl. Biol. Thomas Frase 17 / 66B-Plan 73 Parkplatz Berufsschulcampus in Grünhufe Artenschutzfachbeitrag
5.2 Brutvögel
Im Verlauf der Brutvogelkartierung wurden insgesamt 15 Vogelarten als Brutvögel innerhalb des
Untersuchungsgebiets ermittelt, die nachfolgend der artenschutzrechtlichen Prüfung unterzogen
werden.
In Tabelle 2 sind alle wertgebenden, gefährdeten und besonders geschützten Brutvögel des
Untersuchungsgebietes grau hervorgehoben, die nach FROELICH & SPORBECK (2010) einzelart-
lich betrachtet werden müssen. Von den beobachteten Vogelarten unterliegt der Feldschwirl
einer starken Gefährdung. Die räumliche Zuordnung der Nachweise ist Abbildung 5 zu entneh-
men.
Bei der Begehung am 08.12.2021 wurde im Gehölzbestand des erweiterten Untersuchungs-
raums ein Amselnest nachgewiesen. Ansonsten entspricht die Habitataustattung vollumfänglich
der des alten Untersuchungsraums. Auch unter Berücksichtigung der straßennahen Lage ist
somit durch die Verschiebung des Geltungsbereichs nicht von einer Erweiterung des Arten-
spektrums bei der Gruppen der Brutvögel auszugehen.
Tabelle 2: Gesamtartenliste der Brutvögel im erweiterten Untersuchungsgebiet. Wertgebende,
gefährdete und besonders geschützte Brutvögel sind grau hervorgehoben.
Schutz/ Gefährdung/
Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Status Brutzeit
Bedeutung
1. Columba palumbus Ringeltaube - BV E 02 – E 11
2. Cyanistes caeruleus Blaumeise - BV M 03 – A 08
3. Locustella naevia Feldschwirl MV 2, D 2 BV E 04 – A 08
4. Parus major Kohlmeise - BV M 03 – A 08
5. Passer domesticus Haussperling MV V BV E 03 – A 09
6. Phylloscopus collybita Zilpzalp - BV A 04 – M 08
7. Phylloscopus trochilus Fitis - BV A 04 – E 08
8. Pica pica Elster - BV A 01 – M 09
9. Prunella modularis Heckenbraunelle - BV A 04 – A 09
10. Sylvia atricapilla Mönchsgrasmücke - BV E 03 – A 09
11. Sylvia borin Gartengrasmücke - BV E 04 – E 08
12. Sylvia communis Dorngrasmücke - BV E 04 – E 08
13. Troglodytes troglodytes Zaunkönig - BV E 03 – A 08
14. Turdus merula Amsel - BV A 02 – E 08
15. Turdus philomelos Singdrossel - BV M 03 – A 09
* Schutz §§: nach Bundesartenschutzverordnung und BNatSchG streng geschützte Art
EG: Nach der Richtlinie 2009/147/EG (EU-Vogelschutzrichtlinie) sind für diese Vogelarten besondere Schutz-
maßnahmen hinsichtlich ihrer Lebensräume anzuwenden, um ihr Überleben und ihre Vermehrung in ihrem Ver-
breitungsgebiet sicherzustellen.
Gef. Rote Liste der Brutvögel Mecklenburg-Vorpommerns (VÖKLER et al. 2014): MV 3: gefährdet, MV V: potenziell
gefährdet (Vorwarnliste).
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands (RYSLAVY et al. 2020): D 2: stark gefährdet D 3: gefährdet, D V: potenzi-
ell gefährdet (Vorwarnliste).
Bed.B-Plan 73 Parkplatz Berufsschulcampus in Grünhufe Artenschutzfachbeitrag Abbildung 5: Ergebnisse der Brutvogelerfassung im Untersuchungsgebiet. Dipl. Biol. Thomas Frase 19 / 66
B-Plan 73 Parkplatz Berufsschulcampus in Grünhufe Artenschutzfachbeitrag
5.2.1 Bestands- und Konfliktanalyse der streng geschützten bzw. gefährdeten Vogelar-
ten
An dieser Stelle sind die Arten zu behandeln, für die auf Grund ihrer besonderen Lebensweise
und ihrer Habitatansprüche gegenwärtig eine Gefährdungseinschätzung besteht bzw. die einem
strengen Schutz gemäß der Definition des § 7 (2) Nr. 14 BNatSchG unterliegen oder die im An-
hang I der Vogelschutzrichtlinie geführt werden.
Die Angaben zur Lebensweise und den Aktionsradien der Arten wurden VÖKLER (2014), GE-
DEON et al. (2014), GLUTZ VON BLOTZHEIM (1985-1999) und FLADE (1994) entnommen, die An-
gaben zu den Brutzeiten der vom Vorhaben betroffenen Vogelarten entstammen der Zusam-
menstellung des LUNG (2016).
Feldschwirl / Locustella naevia MV 2, D 2
In dem außerhalb des Geltungsbereichs liegenden Schilflandröhricht wurde zweimal ein sin-
gendes Männchen der Art Feldschwirl nachgewiesen. Das besiedelte Habitat weist eine hohe
Eignung als Fortpflanzungs- und Ruhestätte für die Art auf.
Als Bruthabitate besiedelt der Feldschwirl innerhalb Deutschlands insbesondere Uferzonen,
Nieder- und Hochmoore mit Großseggenrieden, Hochstaudenfluren, landseitige Schilfzonen,
Pfeifengraswiesen, extensiv genutzte Feuchtwiesen und Weiden mit einzelnen Büschen sowie
Brachen, feuchte Dünentäler und Grabenränder. Die Reviergröße beträgt in Abhängigkeit der
Habitatausstattung zwischen 0,3 und 2,1 ha. In M-V ist der Feldschwirl flächig verbreitet. Der
aktuelle Bestand wird in M-V mit 5.000 - 8.500 Brutpaaren angegeben. Wesentliche Ursache für
den Rückgang der Art dürfte die Intensivierung der Landwirtschaft sein. Die Fluchtdistanz liegt
zwischen 10 und 20 m.
Tötungsverbot (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG)
Eine baubedingte Gefährdung durch die Baufeldfreimachung im Eingriffsbereich während der
Brutzeit ist trotz der Lage des Revierzentrums außerhalb des Plangeltungsbereichs für den
Feldschwirl zumindest störungsbedingt nicht auszuschließen. Betroffen sind nur die Entwick-
lungsformen der Art, da die adulten Tiere flugfähig sind. Zur Vermeidung der Tötung von Indivi-
duen sind somit eine Bauzeitenregelung und das Einhalten kontinuierlich fortlaufender Bauab-
läufe zwingend notwendig, wobei sich die Ausschlusszeit nach den Brutzeiten aller Arten richtet
(Tabelle 2). Die restriktivsten Zeiten verweisen dabei auf die Arten Amsel und Ringeltaube. So-
mit ergibt sich als Richtwert ein Ausschlusszeitraum vom 01. Februar bis zum 30. November für
die Baufeldfreimachung und den Beginn der Bauarbeiten. Wenn die Bauarbeiten zwischen dem
30. November und 01. Februar begonnen und ohne größere Pause fortgeführt werden, kann
eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos für die Arten ausgeschlossen werden.
Vermeidungsmaßnahme V 3
Maßnahme Die Baufeldfreimachung inklusive Baumfällung sowie die anschließenden Bauarbeiten müssen
zwischen 30. November und 01. Februar begonnen und ohne größere Pausen fortgeführt
werden.
Begründung Vermeidung der Verletzung, Tötung und Störung
Zielarten Brutvögel
Dipl. Biol. Thomas Frase 20 / 66B-Plan 73 Parkplatz Berufsschulcampus in Grünhufe Artenschutzfachbeitrag
Störungsverbot (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG)
Aufgrund der Entfernung des Brutstandortes zum Plangeltungsbereich, des temporären Cha-
rakters der Bauarbeiten sowie unter Berücksichtigung der Bauzeitenregelung können erhebli-
che Störungen der Art durch das Vorhaben sowohl bau-, anlage- als auch betriebsbedingt aus-
geschlossen werden.
Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 3 i.V.m § 44 (5)
BNatSchG)
Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Feldschwirls sind von dem Vorhaben nicht direkt betrof-
fen. Auch eine störungsbedingte Entwertung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte kann unter
Berücksichtigung der Bauzeitenregelung sowohl bau-, anlage- als auch betriebsbedingt ausge-
schlossen werden.
5.2.2 Bestands- und Konfliktanalyse der sonstigen europäischen Vogelarten
Auf der Grundlage der Definition des § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG sind alle Europäischen Vo-
gelarten im Sinne des Art. 1 EU-Vogelschutzrichtlinie als besonders geschützt einzustufen.
Wie bei FROELICH & SPORBECK (2010) angeführt, kann die spezielle artenschutzrechtliche Prü-
fung auf Grund der großen Artenvielfalt der Vögel in zusammengefassten Gruppen, wie ökolo-
gischen Gilden oder bestimmten Habitatnutzer-Typen, erfolgen. Dieses Vorgehen ist allgemein
in der Genehmigungspraxis anerkannt und spiegelt den Sachverhalt wider, dass unter fachli-
chen Gesichtspunkten eine erhebliche Beeinträchtigung des lokalen Bestandes bei den häufi-
gen Arten nicht möglich erscheint und somit die ökologische Funktion der Lebensstätten, insbe-
sondere in ihrem räumlichen Zusammenhang, erhalten bleibt. Für diese Arten ist selbst bei ei-
nem realen Verlust von brütenden Tieren die Populationsregulation durch nachwandernde Tiere
so stark, dass unmittelbar nach Freiwerden des Brutplatzes andere Tiere der Art die Nische
besetzen.
Soweit die Arten nicht bereits auf Artniveau einer Betrachtung unterzogen wurden, werden an
dieser Stelle die ungefährdeten Brutvogelarten zu folgenden Gruppen zusammengefasst be-
handelt:
Gilde 1. Ungefährdete Vogelarten mit Bindung an Wälder oder Gehölze
Die hier zusammengefassten Vogelarten besitzen bei aller Verschieden-
heit hinsichtlich ihrer Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen die
Gemeinsamkeit, dass Gehölze einen wesentlichen Teil ihres Habitats
ausmachen. Bei Baum- und Strauchbrütern sowie bei Höhlen- oder Halb-
höhlenbrütern, die vorrangig Baumhöhlen nutzen, besteht die Funktion als
Neststandort. Darüber hinaus werden Arten einbezogen, die zwar am Bo-
den brüten, aber Gehölze als wesentliches Habitatelement besitzen.
Arten Amsel, Blaumeise, Dorngrasmücke, Elster, Fitis, Gartengrasmücke,
Kohlmeise, Mönchsgrasmücke, Ringeltaube, Singdrossel, Sprosser,
Zaunkönig, Zilpzalp
max. Brutzeiten 01. Februar bis 30. November
Dipl. Biol. Thomas Frase 21 / 66B-Plan 73 Parkplatz Berufsschulcampus in Grünhufe Artenschutzfachbeitrag
Gilde 2. Siedlungs- und Gebäudebrüter
Die hier zusammengefassten Vogelarten besitzen bei aller Verschieden-
heit hinsichtlich ihrer Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen die
Gemeinsamkeit, dass sie im Untersuchungsraum eine stärkere Bindung
an Gebäude zeigen. Die Neststandorte befinden sich in oder an Gebäu-
den bzw. in deren unmittelbaren Umgebung.
Arten Haussperling
max. Brutzeiten 31. März bis 10. September
1. Ungefährdete Vogelarten mit Bindung an Wälder oder Gehölze
Die Arten sind sowohl Brutvögel des direkten Eingriffsbereichs als auch der angrenzenden Ha-
bitate. Die Revierzentren der Arten befinden sich im oder angrenzend an das Plangebiet in den
entsprechenden Gehölzbiotopen.
Tötungsverbot (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG)
Obwohl sich die Revierzentren der meisten Arten außerhalb des Plangebiets befinden (Abbil-
dung 4), besteht die Gefahr, dass es im Zuge der Baufeldfreimachung zu einer störungsbeding-
ten Brutaufgabe kommt. Zur Vermeidung der Tötung von Individuen sind somit eine Bauzeiten-
regelung und das Einhalten kontinuierlich fortlaufender Bauabläufe zwingend notwendig, wobei
sich die Ausschlusszeit nach den Brutzeiten der Arten richtet (Tabelle 2). Die restriktivsten Zei-
ten verweisen dabei auf die Arten Amsel und Ringeltaube. Auch wenn die Ringeltaube während
der Erfassungen weit entfernt vom Eingriffsbereich nachgewiesen wurde, kann ein potenzielles
Vorkommen der Art im angepassten Geltungsbereich nicht ausgeschlossen werden
Somit ergibt sich als Richtwert ein Ausschlusszeitraum vom 01. Februar bis zum 30. November
für die Baufeldfreimachung und den Beginn der Bauarbeiten. Wenn die Bauarbeiten zwischen
dem 30. November und 01. Februar begonnen und ohne größere Pause fortgeführt werden,
kann eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos für die Arten ausgeschlossen werden
(Vermeidungsmaßnahme V 3).
Störungsverbot (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG)
Aufgrund der Entfernung der Brutstandorte zum Plangebiet, des temporären Charakters der
Bauarbeiten sowie unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahme V 3 können erhebliche
Störungen der Arten durch das Vorhaben sowohl bau-, anlage- als auch betriebsbedingt ausge-
schlossen werden.
Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 3 i.V.m § 44 (5)
BNatSchG)
Im Zuge der Planung werden die Bruthabitate der Gehölzbrüter im Vorhabensgebiet verloren-
gehen, entsprechende Habitate im Zuge der Eingriffsregelung allerdings auch neu geschaffen.
Zudem erlischt der Schutz der Fortpflanzungsstätte für die Frei- und Bodenbrüter im Allgemei-
nen nach dem Ende der Brutperiode (LUNG 2016). Als potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten der Höhlenbrüter sind von dem Vorhaben die potenziellen Quartierstrukturen in den Ge-
Dipl. Biol. Thomas Frase 22 / 66B-Plan 73 Parkplatz Berufsschulcampus in Grünhufe Artenschutzfachbeitrag
hölzbeständen betroffen (siehe Abbildung 4, Nr. 1, 2 und 7). Diese müssen vor der Gehölzent-
nahme durch drei Nistkästen für Höhlenbrüter aus Holzbeton ersetzt und in dem Gehölzbestand
außerhalb des Eingriffsbereichs installiert werden.
CEF-Maßnahme E 2
Maßnahme Ersetzen der potenziellen Quartierstrukturen durch Installation von insgesamt 3 Nistkästen für
Höhlenbrüter aus Holzbeton im Gehölzbestand außerhalb des Eingriffsbereichs. Diese Maß-
nahme muss vor der Entnahme der Gehölze abgeschlossen und funktionsfähig sein.
Begründung Sicherung der ökologischen Funktion von Fortpflanzungs- und Ruhestätten
Zielarten Brutvögel
2. Siedlungs- und Gebäudebrüter
Der Haussperling ist kein Brutvogel des direkten Eingriffsbereichs. Die Revierzentren der Art
befinden sich außerhalb des Plangebiets am Gebäude der Berufsschule.
Tötungsverbot (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG)
Die Revierzentren der Art Haussperling befinden sich außerhalb des Plangebiets. Eine bau-,
anlage- und betriebsbedingte signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos ist für die Arten somit
vollständig auszuschließen.
Störungsverbot (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG)
Aufgrund der Entfernung der Brutstandorte zum Plangebiet sowie des temporären Charakters
der Bauarbeiten können erhebliche Störungen der Art durch das Vorhaben sowohl bau-, anla-
ge- als auch betriebsbedingt ausgeschlossen werden.
Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 3 i.V.m § 44 (5)
BNatSchG)
Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art Haussperling sind von dem Vorhaben nicht betroffen.
Auch eine störungsbedingte Entwertung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann sowohl bau-
, anlage- als auch betriebsbedingt ausgeschlossen werden.
Dipl. Biol. Thomas Frase 23 / 66B-Plan 73 Parkplatz Berufsschulcampus in Grünhufe Artenschutzfachbeitrag
6 Maßnahmenübersicht
Nachfolgend werden die Maßnahmen aufgeführt, deren Umsetzung zur Einhaltung der arten-
schutzrechtlichen Vorgaben des § 44 (1) BNatSchG erforderlich ist. Dabei handelt es sich um
Maßnahmen zur Vermeidung sowie zum Ersatz von vorhabensbedingten Beeinträchtigungen,
die zu einer Verletzung der Verbote des § 44 (1) Nr. 1-4 BNatSchG führen können.
6.1 Vermeidungsmaßnahmen
Vermeidungsmaßnahme V 1
Maßnahme Einsatz einer fachlich versierten ökologischen Baubegleitung (ÖBB), die die Ent-
nahme der Gehölze betreut und diese im Vorfeld auf Besatz kontrolliert. Bei Fun-
den von Fledermäusen in den betroffenen Gehölzen werden die Fällarbeiten ein-
gestellt und die ÖBB stimmt sich mit der unteren Naturschutzbehörde (UNB) über
das weitere Vorgehen ab.
Begründung Vermeidung der Verletzung, Tötung und Störung
Zielarten Fledermäuse
Vermeidungsmaßnahme V 2
Maßnahme Beschränkung der Außenbeleuchtung im Plangebiet:
• Die Beleuchtungsstärke darf nicht über die nach EU-Standards erforderliche
Mindestmaß hinaus gehen,
• Vermeidung störender Lichtausbreitung in angrenzende Räume durch ge-
richtete Beleuchtung von oben nach unten,
• Einsatz von vollabgeschirmten LED-Lampen mit Farbtemperaturen von
2.700 Kelvin oder weniger sowie Wellenlängen > 540 nm.
Begründung Vermeidung der erheblichen Störung der lokalen Population
Zielarten Fledermäuse
Vermeidungsmaßnahme V 3
Maßnahme Die Baufeldfreimachung inklusive Baumfällung sowie die anschließenden Bauar-
beiten müssen zwischen 30. November und 01. Februar begonnen und ohne
größere Pausen fortgeführt werden.
Begründung Vermeidung der Verletzung, Tötung und Störung
Zielarten Brutvögel
Dipl. Biol. Thomas Frase 24 / 66B-Plan 73 Parkplatz Berufsschulcampus in Grünhufe Artenschutzfachbeitrag
6.2 Ersatzmaßnahmen
Ersatzmaßnahme CEF 1
Maßnahme Anbringen von 3 Fledermauskästen in den umliegenden Gehölzen nach folgen-
den Kriterien:
• 2 Stk. Fledermaushöhle mit zwei Einschlüpfen 12 mm (nistkasten-
hasselfeldt.de)
• 1 Stk. Fledermaushöhle mit dreifacher Vorderwand 18 mm (nistkasten-
hasselfeldt.de)
• Anbringung in unterschiedlichen Höhen > 5 m (Schutz vor Vandalismus)
• Anbringung mit unterschiedlicher Exposition (von schattig bis sonnig, am Be-
standsrand / im Bestand)
• Gewährleistung guter Anflugmöglichkeiten (Beseitigung der unteren Äste und
aufkommender Gehölze)
• Gewährleistung einer langen Hangzeit (> 10 Jahre) durch a) die Auswahl gün-
stiger Gehölzbestände mit hoher Umtriebszeit und b) durch die Verwendung
einer zweckmäßigen Aufhängevorrichtung (Dickenwachstum!).
Diese Maßnahme muss vor der Entnahme der Gehölze abgeschlossen und funk-
tionsfähig sein.
Begründung Sicherung der ökologischen Funktion von Fortpflanzungs- und Ruhestätten.
Zielarten Fledermäuse
CEF-Maßnahme E 2
Maßnahme Ersetzen der potenziellen Quartierstrukturen durch Installation von insgesamt 3
Nistkästen für Höhlenbrüter aus Holzbeton im Gehölzbestand außerhalb des
Eingriffsbereichs. Diese Maßnahme muss vor der Entnahme der Gehölze abge-
schlossen und funktionsfähig sein.
Begründung Sicherung der ökologischen Funktion von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten
Zielarten Brutvögel
Dipl. Biol. Thomas Frase 25 / 66Sie können auch lesen