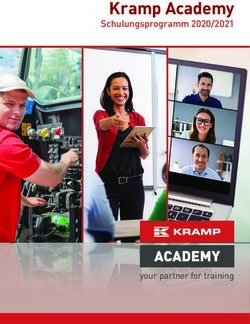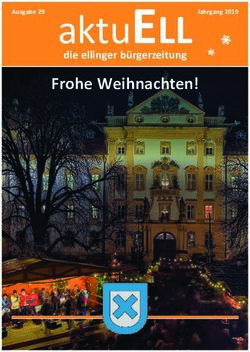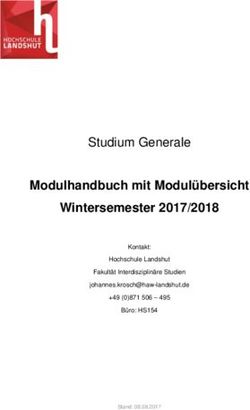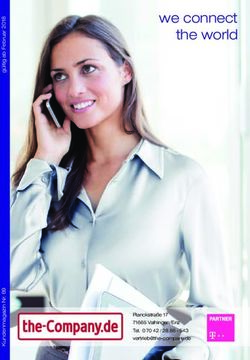CSR-Module Handout für die Umsetzung in der Ausbildung - für die Bereiche Logistik, Verkauf, Bürokommunikation - ergolog
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
CSR-Module Handout für die Umsetzung in der Ausbildung für die Bereiche Logistik, Verkauf, Bürokommunikation Entwickelt von Birgitt Wählisch Im Rahmen des Projektes CAESAR Gesellschaftliche Verantwortung im Mittelstand
Inhaltsverzeichnis 1 Einführung und Hintergrund 4 2 Methodisches Herangehen 5 3 Aufbau dieses Handbuches 6 4 Zur Auswahl der Schlüsselthemen 6 5 Zielgruppe - lernbenachteiligte Jugendliche 6 5.1 Schlussfolgerungen für die Arbeit mit lernbenachteiligten Jugendlichen 7 5.2 Zusammenfassung zu den Methoden 9 6 Rahmenbedingungen 9 7 Die übergreifenden Themen 10 7.1 Einführung in das Thema - CSR und Nachhaltigkeit 10 7.2 CO2 und Klimawandel 11 7.3 Globalisierung und Verantwortung 12 7.4 Kreislaufwirtschaft - vom Abfall zur Ressource 14 7.5 Nachhaltige Unternehmen als Arbeitgeber 16 8 Das Modul - Bereich Logistik 16 8.1 Transport und Umwelt 16 8.2 CSR und Markt - was wollen Kundinnen und Kunden? 19 8.3 Energieeffizienz 19 8.4 Einordnung in die Ausbildungsrahmenpläne 20 9 Das Modul - Bereich Verkauf 22 9.1 Nachhaltigkeit im Lebensmittelbereich 22 9.2 Textilien - fair gehandelt 25 9.3 CSR und Markt 29 9.4 Einordnung in den Ausbildungsrahmenplan 31 10 Das Modul - Bürokommunikation 33 10.1 Ressourcen schonen - von Energie bis Büromaterial 33 CSR-Handout Seite 2 von 76 Birgitt W ählisch 13.11.2014
10.2 Papier - Rohstoff aus der Natur? 33 10.3 Reiseplanung umweltbewusst 34 10.4 Green Meeting - ein Gesamtkonzept 34 10.5 Einordnung in die Ausbildungsrahmenpläne 35 11 Beschreibung der einzelnen Übungen 39 11.1 CO2 Emissionen berechnen 39 11.2 Nachhaltiger Transport? – Pro und Kontra 40 11.3 Faire Zusammenarbeit 41 11.4 Quiz zur Entsorgung 45 11.5 Verpackung und Nachhaltigkeit 46 11.6 Entsorgung von Verpackungsmitteln 47 11.7 Lernlandschaft - Wege einer Plastiktasche 48 11.8 Pro und Kontra Kunststoffe 53 11.9 Erneuerbare Energien 54 11.10 Energie sparen 55 11.11 Nachhaltige Unternehmen als Arbeitgeber 56 11.12 Bio-Label im Lebensmittelhandel 57 11.13 Nachhaltige Textilien 60 11.14 Papier ordentlich entsorgen! 61 11.15 Papier - Ressourcen schonen 63 11.16 Green Meeting 64 12 Glossar 65 13 Weiterführende Links 70 14 Literaturverzeichnis 74 CSR-Handout Seite 3 von 76 Birgitt W ählisch 13.11.2014
1 Einführung und Hintergrund
Im Rahmen des durch den ESF geförderten Programms „CSR – Gesellschaftliche Verantwortung im
1
Mittelstand“hatte das Projekt CaeSaR die grundlegende Zielstellung, Unternehmen das Thema
Corporate Social Responsibility (CSR) vorzustellen und betriebliche CSR-Projekte zu unterstützen.
CSR steht für die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen und umfasst die ökologische,
ökonomische und soziale Ebene. Eine frühzeitige Sensibilisierung zum Thema CSR bereits während
der Ausbildung bzw. im Rahmen der betrieblichen Weiterbildung ist ein wichtiger Bestandteil.
In der TÜV Rheinland Akademie GmbH wurden im Rahmen des Projektes CaeSaR Module zur
Integration in die Ausbildung Jugendlicher erarbeitet. Die Module wurden auf Jugendliche in den
Ausbildungsbereichen Logistik, Büro und Verkauf zugeschnitten. Als Schwerpunkt, der sich wie ein
roter Faden durch alle Themenbereiche zieht, wurde der Bezug zum Markt aus verschiedenen
Perspektiven gewählt. Innerhalb des Projektzeitraums wurden alle hier vorgestellten Module in drei
Ausbildungsgruppen mit insgesamt 34 Jugendlichen erprobt und nach den praktischen Erfahrungen
noch einmal angepasst.
Eine Sensibilisierung kann nur funktionieren, wenn der Bezug zur eigenen Lebensrealität gelingt.
Deshalb wurde bei der Gestaltung der Seminare besonderer Wert auf einen Bezug zu
Ausbildungsinhalten und zu praktischen Erfahrungen in der Ausbildung gelegt. Die Inhalte orientieren
sich an den Ausbildungsplänen, gehen teilweise aber über die Rahmenvorgaben hinaus und stellen
eine Ergänzung dar.
Die Module sollen den Ausbildungsalltag unterbrechen und Zeit zum Nachdenken und zur Reflexion
eigenen Tuns bieten. Deshalb kann hier außerhalb von Leistungsdruck gelernt werden. Die
Jugendlichen lernen, andere Perspektiven einzunehmen und mit Komplexität umzugehen.
Der Fokus wird bei allen Themenstellungen auf das Thema „Nachhaltigkeit“gelegt. Corporate Social
Responsibility wird begrifflich zwar eingeführt, erweist sich aber als Konzept zu sperrig für die
Jugendlichen, da es eher auf das Management zielt. Deshalb wird im Folgenden vornehmlich von
„Nachhaltigkeit“gesprochen. Genutzt werden für die Behandlung der Themen vielfältige
Anknüpfungspunkte aus dem unmittelbaren Lebensumfeld der Jugendlichen, ob es um den Erhalt
natürlicher Lebensgrundlagen, soziale Gerechtigkeit oder die Etablierung nachhaltiger Ideen am Markt
geht. Die Vermittlung spezifischen Wissens macht dabei den geringeren Teil aus. Es kommt eher
darauf an in der allgegenwärtigen Wissensüberflutung, die Daten und Fakten richtig einordnen zu
lernen. In diesem Sinn dienen die Module vor allem dazu, dass die Auszubildenden erfahren, was sich
1
Das Projekt CaeSaR - Gesellschaftliche Verantwortung im Mittelstand ist ein ESF-Projekt des
Qualifizierungsförderwerks Chemie GmbH (QFC)
CSR-Handout Seite 4 von 76
Birgitt W ählisch
13.11.2014hinter „CSR“und „Nachhaltigkeit“verbirgt, wo die Themen in ihrem Arbeitsbereich eine Rolle spielen und was sie selbst für Verbesserungen tun können. Die vorliegenden Materialien ermöglichen es Ausbilderinnen und Ausbildern, Module oder auch einzelne Übungen oder inhaltlichen Teile in die Ausbildung zu integrieren und die im Projekt gewonnenen Erfahrungen für sich zu nutzen. Natürlich kann das Material auch für den Unterricht in den Berufsschulen genutzt werden. 2 Methodisches Herangehen Das Konzept verfolgt einen handlungsorientierten Ansatz. Im Mittelpunkt der Module steht nicht die Wissensvermittlung, sondern die Motivation der Jugendlichen, sich mit den Themen rund um Nachhaltigkeit zu beschäftigen und eigene Verhaltensweisen zu hinterfragen und zu verändern. Deshalb wird der Fokus auf Diskussionen und die Arbeit an speziellen Projekten/Übungen gelenkt. Alle Einzelthemen folgen dem Schema Problem erkennen, Lösungsmöglichkeiten finden und Umsetzungsideen entwickeln. Es wird versucht immer an reale Arbeitserfahrungen anzuknüpfen und persönliche Interessen und Erfahrungen zu berücksichtigen. Die Jugendlichen sollen sich in der Vermittlung wieder finden. Theoretisches Wissen über CSR und Nachhaltigkeit wird nur soweit vermittelt, wie es zum Verständnis der Zusammenhänge unbedingt notwendig ist. Zugunsten der Behandlung exemplarischer Beispiele wird auf inhaltliche Vollständigkeit innerhalb eines Themenkanons verzichtet. Die Wissensvermittlung wird immer untersetzt mit dazugehörigen Übungen oder Diskussionen. Verzichtet wird auf Aufgaben, die Leistungsdruck erzeugen. Motiviert werden soll für einen offenen Austausch ohne vornehmliche Leistungsbeurteilung. Besonders herausgearbeitet werden positive Beispiele, an denen sichtbar wird, was Veränderungen bewirken können. Durch die Fokussierung der von den Jugendlichen wahrgenommenen Medien auf Probleme bis hin zur Überhöhung soll der weit verbreiteten Resignation „wir können doch nichts tun“, entgegen gewirkt werden. Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit berührt immer auch die Wertvorstellungen der Teilnehmer/innen. Deshalb sind ein individueller Zugang und eine Atmosphäre der Wertschätzung wichtig. Es werden in den Modulen keine fertigen Urteile, sondern Ansätze zum Nachdenken vermittelt. Die Module sollen abwechslungsreich gestaltet werden. Vorgeschlagen wird eine Methodenvielfalt von Präsentation über Gruppenarbeit bis zum Quiz. Einen besonders emotionalen Zugang verschafft der Einsatz geeigneter Videos. CSR-Handout Seite 5 von 76 Birgitt W ählisch 13.11.2014
3 Aufbau dieses Handbuches
Das Handout enthält zu jedem Modul kurze Ausführungen zu wichtigen inhaltlichen Punkten, die zu
vermitteln sind. Sie ergänzen die zusätzlich bereit gestellten Power Point Präsentationen. Außerdem
werden in einem gesonderten Teil alle Übungen ausführlich beschrieben. Die dazu notwendigen
Übungsblätter werden ebenfalls als Vorlagen bereitgestellt. Alle sind so konzipiert, dass sie auch
einzeln in bestehende Unterrichtskonzepte eingebaut werden können. Im Anhang zu diesem Handout
finden Sie Vorschläge für Ablaufpläne jeweils für zweitägige und für zwei halbtägige Module für
Logistik, Büro und Verkauf, die alle veröffentlichten Materialien strukturiert aufnehmen.
Bewusst wurden alle Materialien in offenen Formaten veröffentlicht und können mit entsprechender
Urheberangabe verwendet und verändert werden.
4 Zur Auswahl der Schlüsselthemen
Die Schlüsselthemen werden jeweils mit kurzen Präsentationen oder mit dazu passenden Materialien
eingeführt. Die Themen wurden auf Grundlage der Ausbildungsrahmenpläne und praktischer
Erfahrungen ausgewählt. Die Module sind so flexibel konzipiert, dass die Themenbereiche auch
einzeln in den laufenden Lehrbetrieb eingebaut werden können. In den drei Ausbildungsbereichen ist
der Einstieg ähnlich - die gesetzten Themenschwerpunkte und Übungen sind unterschiedlich. In den
Abschnitten zu den inhaltlichen Schwerpunkten werden die für den Einsatz in den Modulen
erarbeiteten Präsentationen mit Zusatzinformationen untersetzt.
Hauptthemen, die sich an unterschiedlichen Stellen wieder finden sind:
• CSR und Nachhaltigkeit - Einordnung der Begriffe und Problembewusstsein
• Auswirkungen der Globalisierung - Fairness für alle
• Ansprüche von Verbraucher/innen - Verhältnis von Markt und Nachhaltigkeit
• Umgang mit Ressourcen - von Energieeffizienz bis Kreislaufwirtschaft
• Soziale Verantwortung - nachhaltiger Umgang mit Personal
5 Zielgruppe - lernbenachteiligte Jugendliche
Bei der praktischen Erprobung der Module wurde in Gruppen mit lernbenachteiligten Jugendlichen
gearbeitet. Bei der TÜV Rheinland Akademie GmbH werden unterschiedliche schulische
Ausbildungen für diese Gruppen angeboten. Erprobt wurden die Module in den Ausbildungsbereichen
Fachlagerist/in, Verkäufer/in und Fachpraktiker/in Büro.
Als benachteiligt eingestufte Jugendliche weisen in der Praxis eine große Bandbreite von
Einschränkungen auf. Oft liegen mehrere Benachteiligungen gleichzeitig vor. Ein Großteil hat
Lerneinschränkungen aufgrund sozialer Desintegration. Das Scheitern dieser Jugendlichen hat in der
CSR-Handout Seite 6 von 76
Birgitt W ählisch
13.11.2014Schulkarriere oft eine sehr lange Geschichte. Häufig finden sich in diesen Gruppen Migrantinnen und Migranten mit Sprachproblemen, die ansonsten eine normale Auffassungsgabe aufweisen. Dazu kommen Auszubildende mit verschiedenen kognitiven Einschränkungen, wie zum Beispiel die Lese- Rechtschreib-Schwäche, aber auch körperliche Einschränkungen, z.B. aufgrund von Epilepsie. Es handelt sich also in jedem Fall um höchst inhomogene Gruppen mit einem hohen Anspruch an die individuelle Ansprache und dem Schaffen von flexiblen Zugängen, um möglichst alle erreichen zu können. Der Zugang zu „Nachhaltigkeit“, einem so komplexen Thema erforderte nach den Erfahrungen vor Ort mit der Zielgruppe konzeptionelle Anpassungen, die hier noch einmal zusammen gefasst werden. 5.1 Schlussfolgerungen für die Arbeit mit lernbenachteiligten Jugendlichen 1. Kürzere Lernsequenzen Viele Jugendliche mit Lernbenachteiligungen haben Schwierigkeiten mit der Aufmerksamkeit. Die Konzentration für eine Aufgabe lässt sehr schnell nach. Deshalb sollten die Aufgaben eher in kleinere Sequenzen aufgeteilt werden. 2. Wechsel der Methoden Methodische Abwechslung trägt zu einer erhöhten Konzentration bei. Lernintensive Phasen sollten sich mit eher spielerischen Elementen abwechseln. 3. Gestaltung von Gruppenarbeiten Das selbstorganisierte Lernen erfordert Disziplin und Organisationsvermögen. In Gruppen mit Lernbenachteiligten sollten die Aufgaben sehr klar formuliert und nicht zu komplex sein. Da die Neigung besteht, vom Thema abzuschweifen, ist während der Gruppenphase eine moderierende Begleitung unerlässlich. Zeit und erwartetes Ergebnis müssen ganz klar benannt werden. Vor allem sollten an die Teamorganisation nicht zu hohe Ansprüche gestellt werden. Für den Arbeitsablauf sind nach Bedarf mehr Vorgaben (Arbeitsschritte) zu benennen. Insgesamt sollten Gruppenphasen nicht länger als 30 min (Aufmerksamkeit) umfassen. 4. Gestaltung von Rechercheaufgaben Selbstorganisierte Recherchen zu einem komplexen Thema stellen eine sehr hohe Anforderung dar. Deshalb sollten auch hier überschaubare Aufgabenstellungen gewählt werden, möglichst Antworten auf eine konkrete Frage. Oft werden die gefundenen Websites mit dem Ergebnis gleichgesetzt. Deshalb sollte schon die Fragestellung zum Lesen und Reflektieren anregen. Hilfreich kann auch die Unterstützung mit möglichen Links sein, die in die Recherche einbezogen werden sollten. Zu bevorzugen sind Websites mit kurzen Texten und vielen Illustrationen zu den jeweiligen CSR-Handout Seite 7 von 76 Birgitt W ählisch 13.11.2014
Sachverhalten. Häufig genutzt wird von Jugendlichen Wikipedia - gerade diese Artikel sind aber häufig weniger hilfreich, weil die Beiträge zu umfangreich, textlastig, komplex und widersprüchlich sind. In der Regel werden alle gefundenen Internetseiten als wahr und objektiv angesehen. Unterstützung muss bei den Recherchen deshalb hinsichtlich der Einordnung gegeben werden. So kann insgesamt die Medienkompetenz der Jugendlichen an praktischen Beispielen geschult werden. Das ist für Nachhaltigkeitsthemen, die häufig verschiedene Aspekte beinhalten, besonders wichtig. 5. Förderung des Problembewusstsein Das Problembewusstsein ist bei den Jugendlichen vor allem für ihren unmittelbaren Alltag ausgeprägt. Ein komplexer Blick auf Probleme fehlt oftmals. Die Problemanalyse soll deshalb insbesondere durch konkrete Fragen und Ableitungen aus dem eigenen Umfeld erfolgen. Dabei ist es hilfreich, die Einordnung in komplexe Zusammenhänge möglichst zu visualisieren. 6. Praxisbezug Der in den meisten Fällen geforderte Praxisbezug ist häufig gar nicht so leicht herzustellen. In der beruflichen Praxis sind die lernbenachteiligten Jugendlichen oft nur in Teilaufgaben eingebunden. Zum Teil lernen sie den betrieblichen Alltag nur über Praktika kennen. Damit fehlt nicht selten der Blick auf das Gesamtunternehmen und die Gesamtzusammenhänge. Es ist bei den Aufgaben genau zu überlegen, inwieweit die Jugendlichen einen Bezug zur betrieblichen Praxis überhaupt herstellen können. Als Alternative bleibt die Einbeziehung der Lebenswelt der Jugendlichen. Es besteht sonst die Gefahr, dass die angedachten praktischen Bezüge reine Theorie bleiben. Lernen ist vielfach an der Vorbereitung von Prüfungen/Abschlüssen ausgerichtet, also eher extrinsisch motiviert. Deshalb ist der Bezug „wozu etwas gelernt werden soll“immer wieder neu herzustellen und einzufügen. 8. Positive Orientierung Aufgrund der Erfahrungen und vieler Medienberichte ist die Resignation vieler Jugendlicher erschreckend hoch. Die Haltung „da kann man ohnehin nichts machen“ist sehr verbreitet. Deshalb sollte gerade bei den Nachhaltigkeitsthemen immer wieder auf bereits erreichte Veränderungen (z.B. sauberere Seen) hingewiesen werden. Bei den Themen ist nicht bei der Problembeschreibung stehen zu bleiben, sondern es sind immer auch Veränderungsmöglichkeiten aufzuzeigen. 9. Emotionale Ansprache und Ermutigung Viele benachteiligte Jugendliche benötigen insbesondere emotionale Zuwendung und Ermutigung. Deshalb sind ihre Erfahrungen in jedem Fall ernst zu nehmen und angemessen darauf zu reagieren. Der Verzicht auf Leistungskontrollen und stark leistungsorientierten Übungen verringert den Druck und ermöglicht den individuellen Zugang zum Thema. 10. Zu eigenem Tun motivieren CSR-Handout Seite 8 von 76 Birgitt W ählisch 13.11.2014
Am Ende der Module sollten alle Jugendlichen Ideen entwickelt haben, was sie selbst verändern können, worin ihr Beitrag liegt. Das Thema Nachhaltigkeit bleibt kein theoretisches Konstrukt, sondern wird erlebbare Realität. Wichtig ist die Authentizität der Lehrperson. Von den Jugendlichen wird sehr genau beobachtet und nachgefragt, ob nur das Thema abgehandelt wird oder die Person auch selbst ein eigenes Verhältnis zu Nachhaltigkeit hat. Das Themenfeld erfordert eine Reflexion eigenen Handelns, um als glaubwürdig wahrgenommen zu werden. Dabei gehört zur Glaubwürdigkeit, mit eigenen Schwächen offen umzugehen. Es geht nicht darum ein perfekt und immer nachhaltiges Verhalten zu demonstrieren, sondern es geht darum, die eigene Sensibilität für Fragen der Umwelt, der sozialen Fairness und des bewussten Umgangs mit allen Ressourcen zu zeigen. 5.2 Zusammenfassung zu den Methoden Besonders gut kamen in den Gruppen spielerische (Quiz) und visualisierende Methoden (Lernlandschaft) an. Außerdem eignen sich Aufgaben mit einem klaren Ergebnis (Informationsblatt zur Papierentsorgung) gut. Kurze Videos können ebenfalls einen emotionalen Einstieg in Themen bieten. Weniger geeignet sind komplexe Gruppenaufgaben mit hohem Selbstorganisationsaufwand (Planspiele u.ä.). 6 Rahmenbedingungen Für die vorgeschlagenen Module ist eine Gruppengröße von 10 bis maximal 16 Teilnehmer/innen vorgesehen. In sehr kleinen Gruppen von unter 8 Personen müssen die Übungen zum Teil angepasst werden. Bei noch größeren Gruppen kommen Einzelne in den Diskussionen zu wenig zu Wort und einige Übungen, bei denen die einzelnen Ergebnisse betrachtet werden sollen, geraten zu lang. Bei der Behandlung von Nachhaltigkeitsthemen muss natürlich auch der Rahmen entsprechend nachhaltig gestaltet werden. Das bedeutet, an allen Stellen nur so viel Material wie nötig einzusetzen, also keine Materialschlachten. Bereits hier beginnt die Vorbildwirkung. Die Papierausdrucke sind auf das Notwendige zu beschränken und sollen Recyclingpapier nutzen. Ein Großteil der Präsentationen erfolgt mittels Beamer. Bei Internetrecherchen sollte darauf geachtet werden, dass nicht (wie oftmals gewohnt) jede Recherche ausgedruckt wird. Kärtchen und Flipcharts können für Präsentationen vorbereitet und mehrfach genutzt werden. Außerdem sollte eine richtige Entsorgung der Materialien selbstverständlich sein. CSR-Handout Seite 9 von 76 Birgitt W ählisch 13.11.2014
7 Die übergreifenden Themen Einige Themen werden identisch in allen drei Modulen aufgegriffen. So eignen sich die Themen CO2 und Klimawandel besonders gut um in die Nachhaltigkeit einzuführen und den Bezug zu eigenen Erfahrungen zu ermöglichen. Hier stellen wir zunächst die Themenbereiche vor, die in allen drei Gruppen behandelt werden. 7.1 Einführung in das Thema - CSR und Nachhaltigkeit Zu CSR und Nachhaltigkeit gibt es eine ungeheure Menge an Daten und Fakten, die in der Fülle eher zu einer Informationsüberflutung führen. In den Modulen werden deshalb am Anfang nur einige Begriffe geklärt. Im Mittelpunkt steht der emotionale Zugang, der am schnellsten über bekannte und beobachtbare Problemfelder wie Umweltverschmutzung oder Klimawandel zu schaffen sind. Gut ist es hier aktuelle Bezüge herzustellen, die gerade in den Massenmedien verhandelt werden. Gleichzeitig soll von Anfang an aufgezeigt werden, dass Veränderungen möglich sind. Ausgeprägt ist eine relativ pessimistische Haltung mit der Aussage „Wir können ohnehin nichts tun.“Aufgezeigt werden soll, dass kleine Veränderungen große Wirkung haben können, um die Motivation zu erhöhen, sich um die scheinbaren Kleinigkeiten im Arbeitsalltag zu kümmern. In der Präsentation wurde das Thema Verbot der Phosphate in Waschmitteln in Deutschland gewählt - die Erholung der Gewässer ist sichtbar und dass es mehr Badeseen mit guter Wasserqualität gibt, ist ein Ergebnis, das auch die Jugendlichen erleben können. Gleichzeitig zeigt das Thema, dass Umweltthemen nicht immer mit einem Verlust an Lebensqualität einhergehen müssen. Der Begriff „Nachhaltigkeit“lässt sich über den begrifflichen Ursprung - Wald und nachhaltige Waldwirtschaft - gut und sinnlich vermitteln. Schwieriger lässt sich der Begriff Corporate Social Responsibility (CSR) verankern. Der CSR-Ansatz ist sehr abstrakt und weit weg von der Realität der Jugendlichen. Die Auszubildenden haben in der Regel mit Managementaufgaben nichts zu tun. Hier kann vor allem aufgezeigt werden, was CSR-Konzepte für Mitarbeiter/innen und Kunden erreichen. Immer mehr Unternehmen engagieren sich im Bereich Nachhaltigkeit/ CSR. Die Motive verdeutlichen auch, weshalb die Etablierung dieser Themen nicht unbedingt Kosten verursacht, sondern Engagement für Umwelt und soziale Belange auch Geld sparen kann. Mit der Einführung werden die drei Ebenen von Nachhaltigkeit eingeführt, das sogenannte magische Dreieck von Ökologie - Sozialem - Ökonomie. Dieser Dreiklang wird bei allen späteren Themen immer wieder aufgegriffen. Die Einführung soll insgesamt den Umfang und die Vielfältigkeit des Themas verdeutlichen. Außerdem werden die Jugendlichen von Anfang an angeregt, im eigenen Umfeld auf Veränderungsmöglichkeiten zu achten. Das ist auch das Thema der ersten Gruppendiskussion. → Power Point Präsentation: Einführung - Worum geht es? CSR-Handout Seite 10 von 76 Birgitt W ählisch 13.11.2014
7.2 CO2 und Klimawandel Als übergreifendes Thema im Bereich Nachhaltigkeit ist das Thema CO2-Emissionen geeignet. Da Klimawandel als ein Problem allgemein bekannt ist und zahlreiche Themen von Transport bis Produktentwicklung berührt, wurde über diesen Schwerpunkt der übergreifende Einstieg in die Thematik gewählt. In den Nachrichten ist der Klimawandel immer wieder präsent - hier wird noch einmal vertieft, was CO2-Emissionen überhaupt sind und wie darauf Einfluss genommen werden kann. Es werden Grundlagen aus der Schule (was ist CO2 und Treibhauseffekt) wiederholt. Für die weitere Beschäftigung mit dem Thema sollen in dieser Sequenz vor allem die globalen Probleme verdeutlicht werden. Neben Informationen wird mit dem Einsatz des Videos „Die Rechnung“ein emotionaler Zugang geschaffen, mit dem die Diskussion „Was kann getan werden - was können wir tun?“eingeleitet werden kann. Praktisch lassen sich Einflussfaktoren besonders gut mit Hilfe von Klimarechnern erfahren. Hier wird durch die Berechnung und damit ein Ergebnis am Ende eine aktive Beschäftigung mit dem Thema angeregt. Die frei verfügbaren Klimarechner richten sich an Privatpersonen. Eine Berechnung für Unternehmen wäre aufgrund der Unterschiedlichkeit der Unternehmen und der fehlenden Daten nicht ohne Weiteres möglich. Deshalb wird der Zugang über den Privatbereich gewählt. Klimarechner, wie z.B. von Klimaktiv gGmbH, umfassen die Bereiche: • Lifestyle • Mobilität • Wohnen • Ernährung Besonders geeignet ist der Klimarechner für Jugendliche - Check Dein Klima http://jugend.klimaktivist.de Ein Vorteil dieses Rechners besteht darin, dass keine Verbrauchszahlen benötigt werden. Die Ansprache ist aber eher für jüngere Erwachsene gedacht. Bei der Verwendung anderer Klimarechner müssen zumindest Zahlen zu Fernwärme, Stromverbrauch u.ä. vorgegeben werden In der Diskussion können danach die Faktoren zur Senkung der CO2-Emissionen für die Unternehmen abgeleitet werden. Ergänzt werden können an dieser Stelle Informationen zur Neutralisierung von CO2-Emissionen. Das bedeutet, dass Unternehmen oder Privatpersonen auf Grundlage des CO2-Ausstoßes z.B. bei einer Flugreise Ausgleichzahlungen vornehmen. Diese Zahlungen werden in erster Linie für Klimaschutzprojekte verwendet - eine der größten Organisationen in diesem Bereich Atmosfair gGmbH: www.atmosfair.de/ CSR-Handout Seite 11 von 76 Birgitt W ählisch 13.11.2014
→ Power Point Präsentation: CO2 und Klimawandel - Von kleinen Ursachen und großer Wirkung → Video: Die Rechnung „Drei Freunde treffen sich in der Kneipe und berichten aus ihrem Leben. Auto, Urlaub, Energie und Ernährung ergeben ein buntes Klimasündenregister. Mit dem Auftreten der Kellnerin nimmt der Film eine überraschende Wendung... Das Drehbuch zu dem etwa vierminütigen Kurzfilm stammt von Heiner Rosch, Dirk Wenzel und Peter Wedel. Letzterer inszenierte den Film mit Benno Fürmann, Bjarne Mädel, Christoph Tomanek und Ina Paule Klink in den Hauptrollen.“ Download über: www.eco-film.de → Übung: CO2 Emissionen berechnen 7.3 Globalisierung und Verantwortung Der weltweite Handel schafft vielfältige Probleme, das ist auch den meisten Jugendlichen aufgrund zahlreicher Medienberichte durchaus bewusst. In diesem Themenbereich werden Fakten zu Problemen aufgrund von Globalisierung an einem oder mehreren Beispielen zusammen getragen. Außerdem wird ein Verständnis entwickelt, wie faire weltweite Zusammenarbeit aussehen kann. Als Einstieg in das Thema wurde das Handy gewählt. Alle Auszubildenden haben ein Handy und nutzen es intensiv. Die wenigsten machen sich bei dem kleinen Gerät Gedanken darüber, woher es kommt und welche Teile darin verbaut werden. Es stellt damit ein gutes Beispiel für Globalisierung dar. Außerdem gibt es zu dem Bereich relativ viel gut aufbereitetes Material. Die Jugendlichen sollen anhand von Materialien bzw. eigener Internetrecherche erarbeiten, was fair (bzw. unfair) an Produktion und Handel ist. Mit dem Beispiel des fairen Smartphones oder Fairphones kann erfahrbar gemacht werden, wie gerade in einem von großen Konzernen beherrschten Markt auch Alternativen entwickelt werden können. Das zeigt sich in mehrfacher Hinsicht: • ein kleineres Unternehmen (Niederlande) • Transparenz in der Kostenkalkulation • Nachvollziehbare Lieferkette • neuer Weg jenseits von Kostendrückerei - möglichst faire Bedingungen • andere Finanzierungsform (Crowdfunding) Über faire Handys gibt es weiterführendes Material unter : www.makeitfair.org In den Materialien, z.B. zu Fair Trade, werden immer wieder die ILO-Kernarbeitsnormen erwähnt. Diese sollen als Grundlage erläutert werden. Anhand der internationalen Normen lässt sich diskutieren, wie die Bedingungen in Deutschland aussehen. Verdeutlicht werden kann der hohe CSR-Handout Seite 12 von 76 Birgitt W ählisch 13.11.2014
Standard - z.B. sind Kinderarbeit oder Zwangsarbeit kein Thema. Gleichzeitig kann diskutiert werden,
wie gerechte und faire Arbeitsbedingungen aussehen und welche Rolle dabei Nachhaltigkeit spielt.
Im Bereich der Siegel (hier der technische Bereich) zeigen sich die unterschiedlichen Ansätze im
Vergleich zwischen dem Blauen Engel, der in erster Linie auf technische Regelungen setzt und dem
TCO Certified, bei dem auch eine soziale Komponente enthalten ist.
TCO Certified Blauer Engel
Produkte Monitore, Notebooks, Desktop- Desktop-PCs, Notebooks, Monitore
PCs; Tablets; Smartphones (RAL-UZ 78) / Drucker, Kopierer,
Multifunktionsgeräte (RAL-UZ 171)
Soziales Kernarbeitsnormen der ILO Keine spezifischen Angaben
Schadstoffe Kunststoffgehäuse frei von PVC und Kunststoffgehäuse frei von PVC und
bromierten Flammschutzmitteln bromierten Flammschutzmitteln
Langlebigkeit Ersatzteile 3 Jahre nach Reparatur und Ersatzteile 5 Jahre nach
Produktionseinstellung (zusätzlich Produktionseinstellung
bei Smartphones: wechselbarer
Akku)
Ergonomie/ Gesundheit helles Display, niedriges niedriges Lüftergeräusch (zusätzlich bei
Lüftergeräusch (zusätzlich bei Druckern: geringe Feinpartikel-Emission)
Smartphones: Headset)
Nachweise Testergebnisse von unabhängigen Selbstauskünfte von Herstellern,
Laboren, Berichte von Testergebnisse von unabhängigen
unabhängigen Auditoren Laboren
Produktdatenbank tcodevelopment.com blauer-engel.de
siehe c’
t 3/13, S. 110 - (Tabelle gekürzt aus ct 2014 Heft 4 S.132 - Artikel von Christian Wölbert: Fairsiegelt)
CSR-Handout Seite 13 von 76
Birgitt W ählisch
13.11.2014→ Video: Kleines Handy - große Wirkung
http://csr.jugend-und-bildung.de/webcom/show_article.php/_c-849/i.html
„Denis, ein jugendlicher Vieltelefonierer, wird in dieser Reportage in die Zentrale von Germanwatch begleitet,
einer Organisation mit Sitz in Berlin, die sich für globale Gerechtigkeit und den Erhalt der Lebensgrundlagen
engagiert. Der Jugendliche erfährt, unter welchen teils sozial und ökologisch inakzeptablen Bedingungen
Mobiltelefone hergestellt werden. Denis erkennt, wie wichtig gesellschaftlich verantwortungsbewusstes Handeln
ist – auch für die Unternehmen. Doch wie kann er als Konsument das Verhalten von Unternehmen beeinflussen?
(Dauer: 5:02 Minuten)“- produziert im Projekt „MitVerantwortung“
→ Übung: Faire Zusammenarbeit
→ Power Point Präsentation: Globalisierung und Verantwortung - Was ist eigentlich fair?
7.4 Kreislaufwirtschaft - vom Abfall zur Ressource
In allen Unternehmen spielt das Thema Kreislaufwirtschaft inzwischen in unterschiedlichem Maß eine
Rolle. Mit der Entsorgung von Materialien und damit mit der Kreislaufwirtschaft haben alle drei
Bereiche - Logistik, Verkauf und Büro zu tun. Die Jugendlichen sollen Hintergrundwissen erhalten zur
Abfallvermeidung, - verwertung und -beseitigung. Beim Thema Vermeidung kann zunächst beim
privaten Konsum angefangen werden, um danach Möglichkeiten in den Unternehmen bzw. der
Ausbildungsstätte zu entdecken. Gefördert werden soll die Sensibilität für den Wert von „Abfall“als
Rohstoff.
Bei der Verwertung lernen die Jugendlichen die Materialien hinsichtlich ihrer Recyclingmöglichkeiten
unterscheiden und werden damit für die sortenreine Sortierung motiviert. Der spielerische Einstieg mit
einem Quiz zur Entsorgung motiviert zur weiteren Beschäftigung mit dem Thema. Es wird hier sehr
schnell klar, dass die eindeutige Zuordnung „Was gehört zur Entsorgung wohin?“keine so leicht zu
lösende Aufgabe ist. Außerdem kann die Motivation sich damit zu beschäftigen, auch durch das
Verdeutlichen der unterschiedlichen Entsorgungssysteme (Hausmüll - grüner Punkt) und damit das
Eingehen auf ökonomische Aspekte erhöht werden. Besonders eingegangen wird dabei auf:
• Altglas
o ca. 82 % Wiederverwertung - Glas lässt sich ohne Qualitätsverluste beliebig oft
einschmelzen
• Papier
o ca. 83 Recycling - Altpapier lässt sich bis zu 5 x wieder verwerten
o z.B. Pappkartons bestehen zu mehr als 90 % aus Recycling-Fasern.
• Verpackungsmüll
o problematisch und kostenintensiv die gelbe Tonne - Mischung unterschiedlicher
Materialien
o müssen erst sortiert werden
CSR-Handout Seite 14 von 76
Birgitt W ählisch
13.11.2014o relativ unproblematisch - Dosenrecycling - da sich Weißblech magnetisch vom
anderen Müll trennen lässt
o bei den verschiedenen Kunststoffen schwierig - hier wird nur ca. 50 % wieder
verwertet
o ein großer Teil wird verbrannt - das spart immerhin Öl und fossile Brennstoffe
• Schadstoffe
o insbesondere im Bereich Lager/Logistik kommen Auszubildende auch mit
Schadstoffen in Kontakt
Das Thema Kreislaufwirtschaft ist sehr komplex. Besonders schwierig macht es die Tatsache, dass
klare Aussagen oft gar nicht möglich sind. Ob etwas gut oder schlecht für die Umwelt ist, hängt von
sehr vielen unterschiedlichen Faktoren ab. In den öffentlichen Diskussionen existieren viele, oft auch
widersprüchliche Aussagen zu den Themen. Für diese Komplexität sollen die Jugendlichen
sensibilisiert werden.
Dafür geeignet ist das Thema Kunststoffe. Kunststoffe haben inzwischen durch die verschiedensten
Medienberichte und die einseitige Berichterstattung ein Negativimage. Als Einstieg wird das Beispiel
„Plastiktüte“genutzt. Auf Nachfrage wird ein Großteil sagen, dass sie schlecht für die Umwelt ist und
am besten ganz darauf verzichtet werden sollte. Deshalb wird an diesem für alle nachvollziehbaren
Beispiel dargestellt, welche unterschiedlichen Faktoren hier zusammen wirken. Methodisch wird hier
die Lernlandschaft zur Darstellung genutzt. Dabei werden der gesamte Produktlebenszyklus
betrachtet und unterschiedliche Umweltfaktoren berücksichtigt. So erfordern Papiertaschen z.B. mehr
Transportkapazität als Papiertüten gleicher Größe (Europallette - 30.000 Plastiktaschen gegenüber
5.000 Papiertaschen gleicher Größe - Quelle Dürrstein, 2013 S. 22). Diskutiert werden müssen also
unterschiedliche Faktoren. Dabei wird auch auf die Umweltprobleme eingegangen, die einen
besonders sensiblen Umgang mit den Produkten erfordern.
In einem kleinen Quiz innerhalb der Power Point Präsentation sollen die Jugendlichen
Verrottungszeiten schätzen. So verrottet ein Zellstofftaschentuch in 3 Monaten Plastikfolie in 30 bis 40
Jahren und Gläser sind auch nach 4.000 Jahren noch auffindbar. Die meisten schätzen die Zeiten,
viel zu kurz ein. Damit wird dem Thema Kreislaufwirtschaft und entsprechende Entsorgung noch
einmal Nachdruck verliehen.
→ Übung: Quiz zur Entsorgung
→ Power Point Präsentation: Kreislaufwirtschaft - Vom Abfall zur Ressource
→ Übung: Verpackung und Nachhaltigkeit
→ Übung: Lernlandschaft - Wege einer Plastiktasche
CSR-Handout Seite 15 von 76
Birgitt W ählisch
13.11.2014→ Power Point Präsentation: Kunststoffe und Umweltverträglichkeit - incl. Schätzaufgabe zur Verrottung → Übung: Pro und Kontra Kunststoffe 7.5 Nachhaltige Unternehmen als Arbeitgeber Die Jugendlichen sollen auch für die soziale Komponente von Nachhaltigkeit sensibilisiert werden. Da alle früher oder später vor Bewerbungsverfahren in Unternehmen stehen, kann die Bedeutung des Nachhaltigkeitsansatzes besonders über die Arbeitgeber-Auswahl vermittelt werden. Viele vor allem große Unternehmen veröffentlichen inzwischen CSR- oder Nachhaltigkeitsberichte bzw. Leitbilder auf ihren Websites. Hier können die Jugendlichen selbst vergleichen, was sagen die Veröffentlichungen aus, wo würde ich mich eher bewerben. Die Auszubildenden sollen damit Anhaltspunkte für ihre realen Bewerbungsverfahren erhalten. → Video: CSR in Unternehmen http://csr.jugend-und-bildung.de/webcom/show_article.php/_c-847/_lkm-557/i.html „Eine junge Reporterin untersucht, auf welche Weise Unternehmen ihrer gesellschaftlichen und ökologischen Verantwortung gerecht werden können. Zusammen mit einem Unternehmensvertreter der Messe Leipzig inspiziert sie mehrere Schauplätze in und um die Messe. Wie können Unternehmen Umweltschutz und soziale Belange in ihren Betrieb integrieren und dabei auch ökonomisch profitieren? (Dauer: 5:03 Minuten)“ → Übung: Nachhaltige Unternehmen als Arbeitgeber 8 Das Modul - Bereich Logistik Orientierung für die gewählten Schwerpunkte bieten die branchenspezifischen Kernpunkte der Green Logistics. Die Schwerpunkte stehen nicht solitär nebeneinander, sondern haben viele Überschneidungspunkte. So hängen die Themen CO2-Emissionen und Transport eng zusammen. Diese Überschneidungen werden in den Diskussionen zur thematischen Vertiefung genutzt. 8.1 Transport und Umwelt Im Bereich Logistik sind der Transport und vor allem die Transportplanung ein Schlüsselthema. Im Seminar sollen die Jugendlichen, Vor- und Nachteile der einzelnen Transportarten auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten einschätzen lernen. In der kurzen Einführung lernen die Jugendlichen vor allem die Problembereiche kennen, die mit wachsendem Verkehr verbunden sind. Hier wird über die CO2-Emissionen hinaus auch das Thema Feinstaubbelastung angesprochen. Der Wunsch mobil zu sein, ist legitim - aber wie kann damit sinnvoll umgegangen werden? Die Jugendlichen erkunden selbst das Pro und Kontra verschiedener Transportmöglichkeiten und beziehen dabei sowohl ökonomische als auch ökologische Aspekte. Die Erarbeitungen können ggf. durch die Präsentation ergänzt werden. CSR-Handout Seite 16 von 76 Birgitt W ählisch 13.11.2014
Angeregt werden soll eine Diskussion zum Verkehr der Zukunft und zu Entwicklungen in der Logistik.
Die Jugendlichen können dazu ergänzend Beispiele im Internet recherchieren - vor allem zu
o Optimierten Fahrzeugen - Leichtbau, Aerodynamik, Hybridantrieb
o Alternativen Treibstoffen
Außerdem sind die Auswirkungen optimierter Verkehrsleitsysteme und die Veränderungen in der
Tourenplanung (Telematik) mögliche Themen.
Beispiele sind zu finden unter:
www.oekosystem-erde.de/html/verkehrszukunft.html
www.ecodesign-beispiele.at
Grundlage der Übung zu Vor- und Nachteilen der Transportarten ist folgende Tabelle:
Transportart Vorteile Nachteile
Straßengütertransport Zeit- und Kostenersparnis im Nah- und keine zeitgenauen
Flächenverkehr, Fahrpläne,
u.U. Zeitersparnis im Fernverkehr, Witterungsabhängigkeit,
flexible Fahrplangestaltung, Abhängigkeit von
Eignung für spezifische Ladegüter, Verkehrsstörungen,
Anpassungsfähigkeit bei Annahmezeiten begrenzte Ladefähigkeit,
Ausschluss bestimmter
Gefahrgüter (z.B.
Ammoniakwasser)
Schienengüterverkehr Größere Einzelladegewichte als beim Schienennetz begrenzt,
LKW, Gleisanschlüsse oder
exakte Fahrpläne, Einsatz sog. Straßenroller
weitgehend störungsfrei, erforderlich,
Gefahrgüter zulässig Zusatzkosten bei Anmietung
von Spezialwagen,
für geringe Transportmengen
ungeeignet
Luftfrachttransport Hohe Transportgeschwindigkeit, Hohe Transportkosten,
Unabhängigkeit von Infrastruktur am Ausschluss gewisser
Boden Gefahrgüter,
Flughafen erforderlich,
CSR-Handout Seite 17 von 76
Birgitt W ählisch
13.11.2014ungebrochener Transport
meist nicht zu realisieren,
besondere Verpackungen
notwendig
Seeschifffahrts- Große Einzelladegewichte, Zugang zu Seehäfen
gütertransport große Laderäume, erforderlich,
Angebot von Spezialschiffen Abhängigkeiten von Sturm,
Eisgang und Nebel,
im Linienverkehr
Abhängigkeit von festen
Routen (anders als bei
Charterung von Schiffen),
besondere Verpackung
notwendig,
ungeeignet für verderbliche
Güter,
ungebrochener Transport
meist nicht zu realisieren
Zusammenfassender Vergleich der Verkehrsträger (vgl. Koch; Susanne, 2012, S. 93) - Anregung für
die Übung
Herzustellen ist in dieser Sequenz die Verbindung zwischen Transportoptimierung und Lagerhaltung.
Auf der einen Seite steht die Beschaffung größerer Mengen mit Rabatten und Einsparungen von
Transportkosten, auf der anderen Seite verursacht auch die Lagerhaltung Kosten. So ist die
Transportoptimierung immer als Komplex mit verschiedenen Seiten zu betrachten.
Außerdem kann hier die zunehmende Globalisierung thematisiert werden. Ein Großteil unserer Waren
kommt inzwischen auf dem Seeweg aus aller Welt.
Foto: C. Wählisch
CSR-Handout Seite 18 von 76
Birgitt W ählisch
13.11.2014Im Brainstorming haben die Jugendlichen die Möglichkeit, sich zukünftige Entwicklungen auszumalen. Die Phantasie kann mit der Darstellung neuerer Entwicklungen, wie sehen Verkehrssysteme der Zukunft aus, angeregt werden. Gleichzeitig sollen eigene Einflussmöglichkeiten zum Thema wachsender Mobilität und Umweltbelastung sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich aufgezeigt werden. → Power Point Präsentation: Transport und Umwelt - Wie funktioniert umweltfreundlicher Verkehr? → Übung: Nachhaltiger Transport - Pro und Kontra → Power Point Präsentation: Vor- und Nachteile der Transportmöglichkeiten 8.2 CSR und Markt - was wollen Kundinnen und Kunden? Im Lager/Logistikbereich muss als erstes noch einmal verdeutlicht werden, wer alles zu den Kundinnen und Kunden gehört. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Lagerbereiche zum Teil auch als interne Dienstleister für das Unternehmen fungieren und den Auszubildenden hier der Kundenbegriff nicht geläufig ist. Das Thema CSR wird oft mit einer Verursachung von Kosten in Verbindung gebracht. Deshalb soll hier CSR und Nachhaltigkeit noch einmal unter dem Aspekt von möglichen Kostenreduzierungen aufgenommen werden. Gesammelt werden Argumente, die für Nachhaltigkeitsmaßnahmen sprechen. Dabei sind Aspekte der Imagewandel und die Bedeutung von nachhaltiger Ausrichtung für bestimmte Kundengruppen. → Power Point Präsentation: CSR und Markt 8.3 Energieeffizienz Das Thema Energieeffizienz ist geeignet, das Bewusstsein für Nachhaltigkeitsthemen im unmittelbaren Umfeld zu schulen. Vertieft werden soll das Wissen über erneuerbare Energien und den Begriff Ökostrom. Gemeinsam werden Möglichkeiten der Energieeinsparung erarbeitet. Überall, wo Energie verbraucht wird, kann geschaut werden, ob es nicht auch effizienter geht. In Unternehmen gibt es viele kleine Verhaltens-Maßnahmen, die zu Einsparungen führen: • Geräte und Licht ausschalten • Kein Stand by • Richtig Lüften • Angemessene Raumtemperatur CSR-Handout Seite 19 von 76 Birgitt W ählisch 13.11.2014
Auf der anderen Seite steht der richtige Einsatz von Investitionen. So sollte bei der Anschaffung von
Geräten auf die Energieeffizienzklassen geachtet werden. Hier können die Jugendlichen angeregt
werden, zu recherchieren, welche es gibt und wie sie sich unterscheiden.
Am Beispiel dargestellt werden können Baumaßnahmen, die unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten
geplant sind. Anschaulich wird hier das Zusammenspiel von Wärmedämmung über Raumgestaltung
bis zur Nutzung alternativer Energiequellen. Die Tendenz besteht in der Entwicklung intelligenter
Systeme, die sich selbst steuern. Diese halten Einzug in immer mehr Bereiche auch im
Logistikbereich.
→ Power Point Präsentation: Energieeffizienz - Geht es auch mit weniger?
→ Übung: Erneuerbare Energie
→ Übung: Energie sparen
8.4 Einordnung in die Ausbildungsrahmenpläne
Die Ausbildung zur/m Fachlagerist/in ist eine anerkannte Ausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz
(BBiG). Die bundesweit geregelte 2-jährige Ausbildung wird in Industrie und Handel sowie im
Handwerk angeboten. Die Ausbildung als Fachlagerist/in kann durch die darauf aufbauende
Ausbildung Fachkraft für Lagerlogistik ergänzt werden (3. Ausbildungsjahr). In der Ausbildung
werden zahlreiche Kenntnisse und Fähigkeiten entwickelt, die mit den CSR-Modulen vertiefend
vermittelt werden können. Bezugspunkte finden sich insbesondere in folgenden Abschnitten des
Ausbildungsrahmenplans - gegliedert nach den Ausbildungsjahren:
zu vermittelnde Fertigkeiten und Kenntnisse im
1. Ausbildungsjahr
2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes
2
d.) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der betriebsverfassungs- oder
personalvertretungsrechtlichen Organe des ausbildenden Betriebes beschreiben
.
5. Arbeitsorganisation; Information und Kommunikation
a.) den Lager- und Transportbereich sowie den eigenen Arbeitsbereich in den betrieblichen Ablauf
einordnen und daraus Konsequenzen für das eigene Handeln ableiten
6. Logistische Prozesse; qualitätssichernde Maßnahmen
a.) gesetzliche und betriebliche Vorschriften bei der güterspezifischen Lagerung anwenden
2
Die Nummerierung bezieht sich auf die Lernziele der Ausbildungsrahmenplans vom 26.7.2004
CSR-Handout Seite 20 von 76
Birgitt W ählisch
13.11.2014Kenntnisse der Berufsbildposition 2. Ausbildungsjahr 5. Arbeitsorganisation; Information und Kommunikation g.) Auswirkungen von Information, Kommunikation und Kooperation auf Betriebsklima und Arbeitsleistung beachten 6. Logistische Prozesse; qualitätssichernde Maßnahmen e.) gesetzliche und betriebliche Vorschriften bei Verpackung und Transport anwenden f) qualitätssichernde Maßnahmen im eigenen Arbeitsbereich durchführen, dabei zur kontinuierlichen Verbesserung von Arbeitsvorgängen beitragen 9. Lagerung von Gütern c.) Maßnahmen zur Qualitäts- und Werterhaltung durchführen 11. Versand von Gütern c.) Sendungen entsprechend der Gütereigenschaften und der Verkehrsmittel verladen und verstauen 3. Ausbildungsjahr 8. Annahme von Gütern e.) Rückgabe von Leergut, Verpackung und Ladehilfsmitteln nach rechtlichen und betrieblichen Vorgaben durchführen und dokumentieren 10. Kommissionierung und Verpackung von Gütern c.) Transportverpackungen und Füllmaterialien hinsichtlich Güterart, Transportart, Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit auswählen Während der gesamten Ausbildung sind Aspekte des Umweltschutzes (§ 7 Nr. 4) zu berücksichtigen und zu vermitteln. In den Prüfungen (Zwischenprüfung und Abschlussprüfung) muss vom Prüfling gezeigt werden, dass er in der Lage ist Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutzmaßnahmen praktisch anzuwenden. CSR-Handout Seite 21 von 76 Birgitt W ählisch 13.11.2014
9 Das Modul - Bereich Verkauf
Das Thema Nachhaltigkeit spielt im Handel inzwischen eine wichtige Rolle. Große
Handelsunternehmen werben mit Nachhaltigkeit, mit Umweltbewusstsein und fairem Handel, um ein
möglichst positives Image zu vermitteln. Verbraucherinnen und Verbraucher fragen zunehmend nach
nachhaltig produzierten Produkten, so dass sich auch die Angebotsstruktur verändert. Von
Nischenprodukten gelangen immer mehr dieser Waren in den Mainstream. Das erfordert auch vom
Verkaufspersonal mehr Wissen über die Zusammenhänge, um Kundinnen und Kunden fachgerecht
informieren zu können. Eingegangen wird in diesem Material auf die Spezialisierungsrichtungen
Lebensmittel- und Textilverkauf.
9.1 Nachhaltigkeit im Lebensmittelbereich
Inzwischen gibt es so viele verschiedene Label, das sie die Verbraucher/innen eher verwirren.
Deshalb ist es besonders wichtig, dass das Verkaufspersonal auf Fragen reagieren kann. Häufig
gestellt wird die Frage - „Ist das wirklich ‚
Bio‘
?“. Kurz gesagt, wo Bio drauf steht, muss im bestimmten
Rahmen auch Bio drin sein, denn durch das EU-Recht sind die Begriffe „Bio“, „aus kontrolliert
biologischen Anbau“ und „Öko“geschützt. Das bedeutet, dass wenn diese Begriffe verwendet
werden, die Kriterien des Bio-Siegels eingehalten werden müssen. Betriebe, die konsequent
ökologisch produzieren, gehen in ihren Ansätzen oft über die Anforderungen des EU-Bio-Siegels
hinaus.
Ökologischer Landbau bedeutet, einen möglichst geschlossenen Nährstoffkreislauf zu ermöglichen,
die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten und zu fördern, sowie Tiere artgerecht zu halten. Damit leisten
ökologisch arbeitende landwirtschaftliche Betriebe ihren Beitrag zum Erhalt der Kulturlandschaft. Die
Besonderheiten dieser Wirtschaftsweise bedingen einen erhöhten Arbeitsaufwand, niedrigere Erträge
bzw. Leistungen. Deshalb sind Bioprodukte in der Regel teurer als herkömmlich hergestellte Produkte.
Gütesiegel sind immer Qualitätsversprechen - aber die dahinter stehenden Kriterien sind sehr
unterschiedlich.
Umfangreiche Informationen zu diesem Thema bietet das Informationsportal der Bundesanstalt für
Landwirtschaft und Ernährung:
www.oekolandbau.de
VORSICHT - nicht geschützt sind Begriffe wie „umweltschonend“„unbehandelt“oder „naturnah“.
CSR-Handout Seite 22 von 76
Birgitt W ählisch
13.11.2014Übersicht verbreitete Label im Lebensmittelbereich
EU- Biosiegel
Erhalten nur Erzeuger, die entsprechend der EU-
Ökoverordnung produzieren u.a.
• 95 % der Zutaten aus ökologischem Anbau
• ca. 50 Zusatzstoffe zugelassen
• Vorgaben zur Stallgröße, Futter und
Haltungsbedingungen
Einschränkungen hinsichtlich des Einsatzes von
Pflanzenschutzmitteln
Deutsches Biosiegel
Kennzeichnung oft parallel mit dem EU-Biosiegel
Seit 2001
entspricht der EU-Ökoverordnung
Überwachung der Biobetriebe durch staatlich
zugelassene private Kontrollstellen
www.oekolandbau.de
Ecovin- Biosiegel
Bundesverband ökologischer Weinbau
Spezielle Regelungen für den Weinbau
www.ecovin.de
demeter zertifiziert von demeter e.V.
geht über die EU-Richtlinie hinaus
strengere Maßstäbe z.B. bei der Zulassung von
www.demeter.de Zusatzstoffen, alle Zutaten aus ökologischer
Produktion
ca. 330 Hersteller zertifiziert
CSR-Handout Seite 23 von 76
Birgitt W ählisch
13.11.2014Naturland Siegel einer der größten ökologischen Anbauverbände
Deutschlands
strengere Maßstäbe als EU-Richtlinie z.B. keine
www.naturland.de Teilbetriebsumstellung
im Verband ca. 53.000 Bauern
Bioland Siegel Siegel von Bioland e.V.
Es gibt Richtlinien für unterschiedliche Erzeugnisse
Zusätzliche Vor-Ort Kontrollen
www.bioland.de Im Verein sind ca. 6.000 Erzeuger
EDEKA - Bio
Wertkost Eigenmarke
Geht nicht über die EU-Verordnung hinaus und
ergänzt somit werbewirksam das Bio-Siegel
www.edeka.de
Pro Planet Vergabe innerhalb der REWE-Group
Rund 500 Produkte tragen das Label
www.proplanet.de eigene Nachhaltigkeitskriterien
MSC
Vergeben von MSC - internationale gemeinnützige
Marine Stewardship Council Organisation
Kennzeichnet Fische, die nach nachhaltigen
Richtlinien gefangen wurden
Soll der Überfischung der Meere entgegen wirken
CSR-Handout Seite 24 von 76
Birgitt W ählisch
13.11.2014Neben der Beschäftigung mit den Gütesiegeln sollten auch andere Aspekte diskutiert werden. Ein Beispiel ist die Gesamtbilanz beim Einkauf von Obst. Die Kundinnen und Kunden wollen Frische und guten Geschmack möglichst das ganze Jahr über. Die ganzjährige Verfügbarkeit erfordert einen enorm hohen Aufwand, die Aufzucht in Gewächshäusern, lange Transportwege oder aufwändige Lagerung. Das heißt, die Orientierung auf einen saisonalen Einkauf trägt zur Nachhaltigkeit bei. Da die Kenntnis über Saisonzeiten oft aufgrund der ganzjährigen Angebote nicht mehr präsent sind, kann hier ergänzend ein kleines Quiz (Was gibt es wann?) durchgeführt und mit einem Saisonkalender überprüft werden. Saisonkalender unter: www.aid.de/ernaehrung/saisonkalender.php Angesprochen werden sollte in diesem Zusammenhang das Thema Lebensmittelverschwendung. „Ein Drittel aller weltweit produzierten Lebensmittel wird verschwendet oder geht verloren, in Industrieländern sogar etwa die Hälfte aller Produkte.“Der größte Teil wird in privaten Haushalten, Restaurants und Kantinen weggeschmissen. „Jeder EU-Bürger wirft pro Jahr durchschnittlich 179 Kilogramm Obst, Gemüse, Fleisch und andere Nahrungsmittel in die Tonne. Einer Studie der Welternährungsorganisation zufolge werden in Europa sogar jährlich 280 Kilogramm Lebensmittel pro Einwohner weggeworfen, obwohl häufig noch nicht einmal das Haltbarkeitsdatum erreicht worden ist.“ Aber auch der Handel hat einen Anteil an der Lebensmittelverschwendung. Die Diskussion, wie auch die Mitarbeiter/innen im Handel einen Beitrag zu weniger Abfall leisten können, führt die Jugendlichen unmittelbar in ihre eigene Arbeitsrealität. Zahlen und Fakten zum Thema Lebensmittelverschwendung bietet das Informationszentrum für die Landwirtschaft: /www.proplanta.de → Power Point Präsentation: Nachhaltigkeit im Lebensmittelhandel - Alles Bio? → Übung: Bio-Label im Lebensmittelhandel 9.2 Textilien - fair gehandelt Der Druck auf die Textilindustrie ist aufgrund der Skandale in den letzten Jahren groß. Zu niedrige Sicherheitsstandards und schlechte Arbeitsbedingungen vor allem in den Fabriken in Asien, haben weltweit Aufsehen erregt. Im Modul wird die fortgeschrittene Globalisierung verdeutlicht. Oft sind die langen Wege den Textilien gar nicht anzusehen. Die Nachfrage nach Billigtextilien ist trotzdem nach wie vor hoch. Es gibt nur marginale Veränderungen im Konsumverhalten. Die zukünftigen Verkäufer/innen erfahren insbesondere, woran nachhaltig produzierte Textilien zu erkennen sind und was sie von herkömmlich produzierten unterscheidet. CSR-Handout Seite 25 von 76 Birgitt W ählisch 13.11.2014
Gute Anhaltspunkte dazu liefert die Organisation Clean Clothes Campaign (CCC). Von 2010 bis 2012
wurden insgesamt 61 Unternehmen im Bereich Mode zu ihren Nachhaltigkeitsstrategien befragt -
Ergebnisse unter: www.cleanclothes.at/de/firmen-check
Die Kampagne
• fordert Bekleidungsmarken und -unternehmen dazu auf, konkrete und messbare Schritte zu
unternehmen, die existenzsichernde Löhne entlang der Lieferkette sicherstellen
• setzt sich bei nationalen Regierungen in textilproduzierenden Ländern für Mindestlöhne ein
• regt europäische Regierungen dazu an, die Verantwortlichkeit der Unternehmen für
existenzsichernde und menschenwürdige Arbeitsbedingungen zu regulieren
Das Beispiel zeigt
deutlich - dass die
Produktionslöhne vor
Ort nur den kleinsten
Anteil am Preis
ausmachen.
Auch im Textilbereich gibt es verschiedene Siegel - die Jugendlichen sollen erfahren, welche Siegel
besonders verbreitet sind und was sich dahinter verbirgt.
CSR-Handout Seite 26 von 76
Birgitt W ählisch
13.11.2014Sie können auch lesen