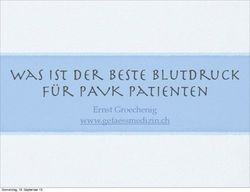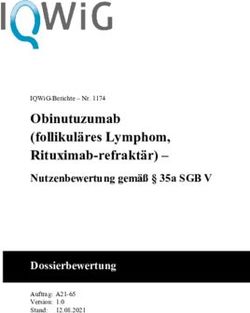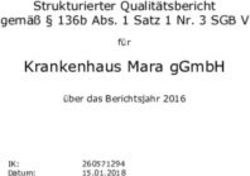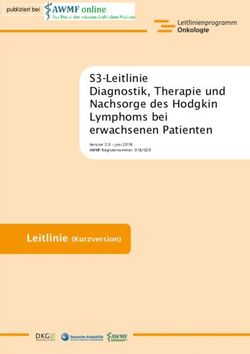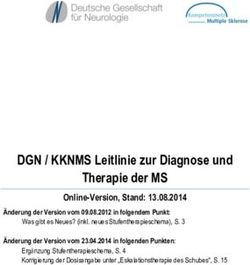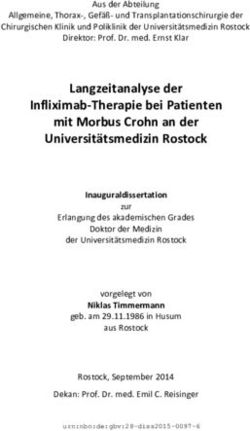DG PARO-Jahrestagung 2017 in Dresden Posterpräsentationen
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Abstracts der Posterpräsentationen n 333
DG PARO-Jahrestagung 2017 in Dresden
Posterpräsentationen
Poster 1
Untersuchung von Ghrelin und Chemerin bei Parodontitis und unterschiedlichem
Körpergewicht
N. Arnold, H. F. R. Jentsch, V. Richter, J. Deschner, T. Kantyka, S. Eick
Ziel: Ernährung und Körpergewicht sind modifizierende Faktoren bei Entstehung und Verlauf einer Parodontitis.
Der Zweck dieser Studie war es, zwei Moleküle (Ghrelin, Chemerin), die in Verbindung mit Nahrungsauf-
nahme und Fettleibigkeit freigesetzt werden, bei Patienten mit und ohne Parodontitis unter Berücksichtigung
von unterschiedlichem Körpergewicht zu untersuchen.
Material und Methoden: Die beiden Hauptgruppen (chronische Parodontitis [CP] und parodontal Gesunde-/
Gingivitis [Gin]) wurden in eine normalgewichtige Gruppe (BMI < 25) und eine Gruppe von Übergewichtigen
(BMI ≥ 25) unterteilt. Neben Bakterien des subgingivalen Biofilms wurden die Konzentrationen von azyliertem
und Gesamt-Ghrelin, Chemerin und Interleukin (IL) -1β in Speichel, Sulkusflüssigkeit (GCF) und Serum untersucht.
Ergebnisse: Die subgingivale Präsenz von Treponema denticola war in den CP-Gruppen sowie in der
Gin-Gruppe mit BMI ≥ 25 signifikant höher als in der Gin-Gruppe mit BMI < 25. Im GCF unterschied sich
die Menge von Gesamt-Ghrelin zwischen den Gruppen signifikant (p < 0,05), die niedrigsten Spiegel wur-
den in der CP-Gruppe mit BMI ≥ 25 gemessen. Die Konzentrationen von Chemerin in der GCF waren in
jeder CP-Gruppe signifikant höher als in der Gin-Gruppe mit BMI < 25. Von den gemessenen Biomarkern
differierte jedoch am deutlichsten der IL-1β-Gehalt, im GCF wurden die höchsten Werte in der CP-Gruppe
mit BMI < 25 und die niedrigsten Werten in der Gin-Gruppe mit BMI < 25 gefunden. Es wurden keine sig-
nifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen bei Chemerin und bei azyliertem Ghrelin im stimulierten
Gesamtspeichel sowie bei azyliertem und Gesamt-Ghrelin im peripheren Blutserum gefunden. Der BMI
korrelierte mit dem Serumspiegel von Chemerin.
Schlussfolgerungen: Parodontitis und Übergewicht sind mit niedrigem Ghrelin- und hohem Chemerinspiegel
im GCF assoziiert, jedoch stellt die Bestimmung der Moleküle keinen ausreichenden Hinweis für das Be
stehen einer Parodontitis dar.
Poster 2
Auswertung subgingivaler Plaqueproben in der Praxis oder im Labor? – Eine Diagnostikstudie
I. Elez, K. Nickles, T. Aldiri, T. Ramich, S. Scharf, B. Schacher, P. Eickholz
Ziel: Vergleich der Analysen subgingivaler Plaqueproben mit Strip-PCR im Labor und vor Ort (z. B. in der Praxis).
Material und Methoden: Insgesamt wurden 20 Patienten (6 weiblich) im Alter von 33 bis 76 Jahren
(56,5 ± 15,0) mit den Diagnosen unbehandelte aggressive (n = 5) oder generalisierte, schwere chronische
(n = 15) Parodontitis eingeschlossen. An den jeweils tiefsten Taschen pro Quadrant wurden nach relativer
Trockenlegung mittels Watterollen jeweils zwei sterile Papierspitzen gleichzeitig nach subgingival platziert
und für 20 Sekunden belassen. Anschließend wurde jeweils eine Papierspitze von jeder Stelle in eines von
zwei separaten Transportgefäßen gegeben und mit jeweils einer Papierspitze von den anderen drei Stellen
Parodontologie 2017;28(3):333–364334 n A bstracts der Posterpräsentationen
des gleichen Patienten gepoolt. Von den so entstehenden zwei Poolproben wurde eine zur Auswertung ins
Labor geschickt (Hain microIDent, Hain Lifescience, Nehren) und die andere vor Ort (Hain micro Ident
direct-Test und das Gerät TwinCycler, Hain Lifescience, direct) für das Vorliegen von Aggregatibacter
actinomycetemcomitans (A. a.) und Porphyromonas gingivalis (P. g.) ausgewertet.
Ergebnisse: Beide Analyseverfahren kamen für A. a. zu identischen Ergebnissen (positiv: 6; McNemar-
Chi-Quadrat-Test = 0, p = 1,0; Cohens Kappa = 1,0, p < 0,001). Für P. g. waren 8 Proben mit direct und
9 mit Labor positiv (McNemar-Chi-Quadrat-Test = 1,0, p = 0,317 und Cohens Kappa = 0,90, p = 0,001).
Schlussfolgerungen: Diese Analysen zum Vergleich der Auswertung subgingivaler Plaqueproben mit Strip-PCR
im Labor und vor Ort (direct) zeigen für A. a. und P. g. sehr gut übereinstimmende Ergebnisse.
Poster 3
Subgingivale Mikroflora bei chronischer und aggressiver Parodontitis 5 Jahre nach
Parodontitistherapie
T. Ramich, A. Asendorf, B. Schacher, K. Nickles, G. Oremek, H. Sauer-Eppel, M. Wohlfeil, P. Eickholz
Ziel: Untersuchung der subgingivalen Mikroflora 5 Jahre nach systematischer Therapie aggressiver (AgP)
und schwerer chronischer (ChP) Parodontitis.
Material und Methoden: Bei 25 ChP- (10 weiblich, 6 Raucher, 8 positiv für A. actinomycetemcomitans) und
17 AgP-Patienten (8 weiblich, 2 Raucher, 10 positiv für A. actinomycetemcomitans) wurde eine systema-
tische Parodontitistherapie durchgeführt und deren Effekt auf die subgingivale Mikroflora untersucht: vor
Therapie (T0), 3 Monate (T1) und 5 Jahre (T2) nach Therapie. Bei Nachweis von A. actinomycetemcomitans
erfolgte die subgingivale Instrumentierung mit unterstützender Antibiotikagabe. Zu T0, 1 und 2 erfolgte die
Erhebung klinischer Parameter (Sondierungstiefen, BOP) und Entnahme subgingivaler Plaqueproben, die
auf A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis, T. forsythia und T. denticola untersucht wurden. Aus den ST
sowie BOP wurde das „periodontal inflammed surface area“ (PISA) berechnet.
Ergebnisse: Die PISA-Werte verringerten sich in beiden Gruppen: ChP: T0 1483,2 ± 448,9 mm²;
T1 432,5 ± 223,4 mm²; T2 131,3 ± 123,7 mm²; AgP: T0 1156,9 ± 469,9 mm²; T1 396,0 ± 163,1 mm²;
T2 109,7 ± 93,6 mm² (p < 0,001). Bei ChP und AgP verringerten sich P. gingivalis, T. forsythia und
T. denticola von T0 zu T1 signifikant. Bei ChP nahm P. gingivalis von T1 zu T2 deutlich aber nicht signifikant
wieder zu. Zu T0 war A. actinomycetemcomitans bei AgP (4,56 [0/5,59]) häufiger als bei ChP (0 [0/4,78],
p = 0,034) und nur für AgP konnte eine signifikante Reduktion erreicht werden (T1 und T2: 0 [0/0], p < 0,05).
Zu T2 lag P. gingivalis signifikant niedriger bei AgP (0 [0/4,55]) als bei ChP (5,72 [0/6,70], p = 0,004).
Schlussfolgerungen: Nur für AgP ließ sich A. actinomycetemcomitans subgingival signifikant reduzieren.
*Die Studie wurde von der Freiherr Carl von Rothschild´sche Stiftung Carolinum unterstützt.
Poster 4
Interleukin 8 und Leukozyten im Serum 5 Jahre nach Parodontitistherapie
A. Asendorf, T. Ramich, B. Schacher, K. Nickles, G. Oremek, H. Sauer-Eppel, R. Schubert, M. Wohlfeil,
P. Eickholz
Ziel: Untersuchung der Serumkonzentration von Interleukin 8 (IL-8) und der Leukozytenzahl 5 Jahre nach
systematischer Therapie aggressiver (AgP) und schwerer chronischer (ChP) Parodontitis.
Parodontologie 2017;28(3):333–364Abstracts der Posterpräsentationen n 335
Material und Methoden: Bei 25 ChP- (10 weiblich, 6 Raucher) und 17 AgP-Patienten (8 weiblich, 2 Raucher)
wurde eine systematische Parodontitistherapie durchgeführt und deren Effekt auf systemische Ent
zündungsparameter untersucht: vor Therapie (T0), 3 Monate (T1) und 5 Jahre (T2) nach Therapie. Zu T0,
1 und 2 erfolgte die Erhebung klinischer Parameter (Sondierungstiefen, Attachmentverlust, BOP) und
Entnahme venösen Blutes. Aus den ST sowie BOP wurde das „periodontal inflammed surface area“ (PISA)
und aus den Blutproben die Serumkonzentration von IL-8 und der Leukozyten bestimmt.
Ergebnisse: Die ST-/PISA-Werte verringerten sich in beiden Gruppen. ChP: T0 3,9 ±0,6 mm/
1483,2 ± 448,9 mm²; T1 2,6 ± 0,3 mm/432,5 ± 223,4 mm²; T2 1,9 ± 0,5 mm/131,3 ± 123,7 mm²; AgP:
T0 3,4 ± 0,6 mm/1156,9 ± 469,9 mm²; T1 2,5 ± 0,3 mm/396,0 ± 163,1 mm²; T2 1,8 ± 0,4 mm/109,7 ± 93,6 mm²
(p < 0,001). Zu T1 lag IL-8 bei ChP signifikant höher als bei AgP (28 [22/43]/19 [10,8/33,3] pg/ml;
p = 0,023). Zu T2 lag IL-8 bei ChP signifikant niedriger als zu T1 (16,4 [12,3/20,8]/ 28 [22/43] pg/ml;
p < 0,001). Nur bei ChP zeigten sich signifikante Veränderungen der Leukozytenzahl (T0: 6,11 ± 1,44; T1:
5,34 ± 1,4, p < 0,05; T2: 7,73 ± 2,89 nl-1, p < 0,05).
Schlussfolgerungen: Nur für ChP ließen sich über den Beobachtungszeitraum von 5 Jahren signifikante
Veränderungen von IL-8 und Leukozytenzahl beobachten.
*Die Studie wurde von der Freiherr Carl von Rothschild´sche Stiftung Carolinum unterstützt.
Poster 5
Attachmentverlust-abhängige Zuverlässigkeit des Dental-MRTs zur Bestimmung der
parodontalen Restknochenhöhe
M. A. Rütters, A. Heil, J. Gradl, M. Bendszus, T-S. Kim
Ziel: Die Evidenz zeigt, dass die Bestimmung parodontaler Restknochenhöhe mittels Dental-MRT (dentale
Magnetresonanztomografie) möglich zu sein scheint. Bisher wurde jedoch nicht untersucht, ob die Verläss-
lichkeit des Verfahrens unabhängig vom vorhandenen klinischen Attachmentverlust ist oder ob eine Zunahme
des Knochenabbaus, was bei schweren Parodontitiden der Fall ist, mit einer ungenaueren Messung der par-
odontalen Restknochenhöhe im MRT einhergeht. Ziel der vorliegenden Studie war es daher zu untersuchen,
ob die Genauigkeit der Messungen im MRT abhängig vom Ausmaß des klinischen Attachmentverlusts ist.
Material und Methoden: Bei 5 Patienten mit einer klinisch diagnostizierten Parodontitis wurde je 1 MRT
angefertigt. 20 vitale Zähne ohne pulpennahe Restaurationen und ohne metallische Restaurationen wurden
in die Untersuchung eingeschlossen. Von zwei kalibrierten verblindeten Untersuchern wurden die vorhan-
denen Bilder hinsichtlich der bestehenden Restknochenhöhe mesial und distal zweimal im Abstand von
4 Wochen ausgemessen. Insgesamt wurden 40 Messungen je Sitzung durchgeführt. Die Messungen wur-
den in 2 Gruppen aufgeteilt. Der 1. Gruppe wurden alle Messstellen mit einem klinischen Attachmentverlust
≤ 4 mm zugeteilt, der 2. Gruppe alle Messstellen mit einem klinischen Attachmentverlust ≥ 5 mm. Innerhalb
dieser Gruppen wurden die Intra- und Interrater-Korrelationen der Messungen errechnet.
Ergebnisse: 14 Messstellen zählten zu Gruppe 1 und 26 Messstellen zu Gruppe 2. Der mittlere klinische
Attachmentverlust in Gruppe 1 betrug 3,5 mm (± 0,65 SD) und 7 mm (± 2,65 SD) in Gruppe 2. Die Interrater-
Korrelation in Gruppe 1 lag bei 0,778, in Gruppe 2 betrug sie 0,880. Eine Fisher-Transformation mit an-
schließendem Signifikanztest zeigte keinen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Korrelationen.
Die Intrarater-Korrelation betrug für Untersucher 1 in Gruppe 1 0,990 und in Gruppe 2 0,991. Für Unter-
sucher 2 betrug diese in Gruppe 1 0,996 und in Gruppe 2 0,994.
Schlussfolgerungen: Als Schlussfolgerung kann gesagt werden, dass die Messungen der Restknochenhöhe
mittels MRT unabhängig vom Ausmaß des Attachmentverlusts hohe Inter- und Intrarater-Korrelationen
zeigen.
Parodontologie 2017;28(3):333–364336 n A bstracts der Posterpräsentationen
Poster 6
DG PARO / CP GABA Forschungsförderung:
Präsentation der Ergebnisse DG PARO
Polymorphismen im Gen der non-coding RNA ANRIL als parodontale und kardiovaskuläre
Risikomarker (Longitudinale Kohortenstudie)
S. Schulz, L. Seitter, A. Schlitt, K. Werdan, B. Hofmann, C. Gläser, H-G. Schaller, S. Reichert
Ziel: Bereits seit Langem wird ein Zusammenhang zwischen parodontalen und kardiovaskulären Erkrankun-
gen vermutet. Als Schnittstelle beider Erkrankungen werden u. a. gemeinsame genetische Risikofaktoren
diskutiert. Das Ziel der Studie bestand darin, Polymorphismen im Kandidatengen ANRIL auf mögliche
Assoziationen zur schweren Parodontitis und als prognostische Marker für kardiovaskuläre Ereignisse zu
evaluieren.
Material und Methoden: 1.002 Patienten mit angiographisch gesicherter Stenose (> 50 %) wurden in die
Studie einbezogen und neben der Routinediagnostik auch parodontal untersucht. Nach 3 Jahren wurden
diese Patienten hinsichtlich eines definierten kombinierten Endpunktes (Myokardinfarkt, Tod durch
Myokardinfarkt, Schlaganfall/TIA, Tod durch Schlaganfall) mündlich oder schriftlich evaluiert. Mittels PCR,
SSP, RFLP und Sequenzierung wurden die Polymorphismen rs1333049 und rs3217992 im ANRIL-Gen
genotypisiert.
Ergebnisse: Patienten mit schwerer Parodontitis waren im Vergleich zu Patienten mit milder Parodontitis
signifikant häufiger Träger der Genotypen AA und GG (rs3217992) im Vergleich zu Patienten mit milder
Parodontitis (p = 0,022). Im multivariaten Vergleich unter Berücksichtigung von Alter, Geschlecht, Rauchen,
BMI und Plaque-Index wurde diese Assoziation bestätigt (OR = 1,37, 95 % KI: 1,02–1,82, p = 0,034).
In Bezug auf die Prognose nach einem kardiovaskulären Ereignis konnten wir zeigen, dass A-Allel- bzw.
AA-Genotypträger (rs3217992) ein erhöhtes Risiko bzgl. des kombinierten Endpunktes hatten (Kaplan-
Meier-Kurve, Log-Rank-Test: A-Allel p = 0,029, AA-Genotyp p = 0,035). In der multivariaten Cox-
Regression (Kofaktoren: Alter, Geschlecht, BMI, Rauchstatus, Diabetes) wurden das A-Allel bzw. der
AA-Genotyp als koronare Prognosefaktoren bestätigt (A-Allel: HR = 1,74, 95 % KI: 1,05–2,87, p = 0,03;
AA-Genotyp: HR = 1,63, 95 % KI: 1,1–2,4, p = 0,014). Für den rs1333049-Polymorphismus konnte keine
Assoziation zur schweren Parodontitis (Chi-Quadrat-Test, binäre logistische Regression) bzw. zum Auftreten
eines kombinierten kardiovaskulären Endpunktes (Kaplan-Meier-Statistik, Log-Rank-Test, Cox-Regression)
gezeigt werden.
Schlussfolgerung: Der Polymorphismus rs3217992 im ANRIL-Gen wurde als unabhängiger parodontaler
Risikomarker bei Patienten mit Koronarstenose bestätigt. Darüber hinaus kann dieser Polymorphismus auch
als Prognosemarker für zukünftige kardiovaskuläre Folgeereignisse herangezogen werden.
*Die Studie wurde unterstützt durch die Deutsche Herzstiftung, Hain-Lifescience und die DG PARO.
Parodontologie 2017;28(3):333–364Abstracts der Posterpräsentationen n 337
Poster 7
DG PARO / CP GABA Forschungsförderung:
Präsentation der Ergebnisse DG PARO
sRAGE in Assoziation zur Parodontitis und kardiovaskulärem Outcome bei
KHK-Patienten
S. Reichert, U. Triebert, A. Navarrete Santos, B. Hofmann, H-G. Schaller, A. Schlitt, S. Schulz
Ziel: Lösliche Rezeptoren für Endprodukte der fortgeschrittenen Glykierung (sRAGE) können AGEs binden
und damit die AGE-RAGE Signalübertragung sowie Pathogenese der Parodontitis und Atherosklerose be-
einflussen. Deshalb untersuchten wir, ob die periphere sRAGE-Konzentration mit Parodontitissymptomen
und neuen kardiovaskulären Ereignissen bei Patienten mit KHK assoziiert ist.
Material und Methoden: 933 stationäre Patienten mit KHK (66,8 ± 11,0 Jahre, 73,7 % Männer) wurden
parodontal hinsichtlich der Plaque- und Blutungsindizes, der Prävalenz einer schweren Parodontitis (approxi
maler Attachmentverlust ≥ 5 mm an mindestens 30 % der Zähne), 11 parodontaler Bakterien sowie
internistischer Vorerkrankungen untersucht. Die Inzidenz neuer kardiovaskulärer Ereignisse (kombinierter
Endpunkt: Myokardinfarkt, kardialer Tod, TIA/Schlaganfall, Tod nach Schlaganfall) wurde nach 3 Jahren
Follow-up erhoben. sRAGE im Serum wurde mit ELISA (R&D Systems, USA) bestimmt. Die Bakterienanalyse
der subgingivalen Plaque erfolgte mit PCR-SSO (microIdentplus11, Hain-Lifescience, Nehren).
Ergebnisse: Patienten mit einem sRAGE-Spiegel von mindestens 1000 pg/ml hatten signifikant höhere
Plaque- (p = 0,005) und Blutungsindizes (p = 0,001) und waren signifikant häufiger positiv für Prevotella
intermedia (p < 0,0001). Dagegen gab es keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich der Prävalenz einer
schweren Parodontitis. Ein sRAGE-Level von mindestens 1000 pg/ml war mit einer höheren Inzidenz für
neue kardiovaskuläre Ereignisse (26,4 % vs. 14,1 %, p < 0,0001) assoziiert. Dieses Resultat blieb auch nach
Cox-Regression mit Adjustierung für bekannte Risikofaktoren für KHK signifikant (Hazard Ratio = 1,54,
95 % KI 1,03 bis 2,29, p = 0,036).
Schlussfolgerungen: sRAGE-Level ≥ 1000 pg/ml waren nicht zur schweren Parodontitis aber zur Inzidenz
rekurrenter kardiovaskulärer Ereignisse assoziiert.
*Die Studie wurde unterstützt durch die Deutsche Herzstiftung, Hain-Lifescience und die DG PARO.
Poster 8
Die Reliabilität zweier röntgenologischer Verfahren bei der Diagnose interradikulärer
Osteolysen
P. Schleich, N. El Sayed, L. Uhlmann, T-S. Kim
Ziel: Die Orthopantomografie (OPT) ist eine häufig genutzte Bildgebung in der Zahnmedizin, welche zur
Diagnose parodontaler Defekte herangezogen wird. Die Anwendung der dreidimensionalen digitalen
Volumentomographie zur präziseren Identifikation parodontaler Defekte wird häufig diskutiert. In dieser
Untersuchung wird, anhand von Bildern aus dem klinischen Alltag, die Intrarater- und Interrater-Reliabilität
bei der Diagnose interradikulärer parodontaler Defekte untersucht.
Parodontologie 2017;28(3):333–364338 n A bstracts der Posterpräsentationen
Material und Methoden: Zur Bestimmung der Intrarater-Reliabilität wurden die OPT- und DVT-Aufnahmen
von 80 Patienten aus der Ambulanz der Abteilung für Mund-Kiefer und Gesichtschirurgie der Universität
Heidelberg durch einen Prüfarzt doppelt ausgewertet. Die Interrater-Reliabilität wurde durch den Vergleich
der Ergebnisse zweier Prüfärzte errechnet, die eine Auswertung der Aufnahmen von 20 Patienten aus dem-
selben Patientenpool durchführten. Für die Auswertung war lediglich entscheidend, ob ein interradikulärer
parodontaler Defekt in einem Verfahren wiedererkannt werden kann oder nicht. In dieser Studie wurde zur
statistischen Erhebung der Reliabilität die B-Statistik verwendet. Die B-Statistik zeigt sich bei einer, wie in
diesem Fall vorliegenden, asymmetrischen Verteilung der Daten (extrem viele Zähne bei denen keine
Messungen durchgeführt wurde), dem häufig verwendeten Cohens Kappa überlegen.
Ergebnisse: OPT/DVT: Interrater-Reliabilität 0,82/0,79; Intrarater-Reliabilität 0,89/0,85. Nach der Inter
pretation der B-Statistik durch Munoz und Bangdiwala entspricht ein B-Wert > 0,65 einer nahezu perfekten
Übereinstimmung.
Schlussfolgerungen: Beide Verfahren weisen eine ausgezeichnete Reliabilität bei der Befundung von inter-
radikulären Osteolysen auf. Das OPT übertrifft das DVT in seiner Reliabilität bei dieser Untersuchung leicht.
Diese Studie zeigt, dass eine Diagnose von interradikulären parodontalen Defekten, anhand von Aufnahmen
aus dem klinischen Alltag, mit einer ausgezeichneten Reliabilität getroffen werden kann.
Poster 9
Impact of toothbrush amplitude on noncontact biofilm removal: Preliminary results
J. C. Schmidt, M. Astasov-Frauenhoffer, T. Waltimo, R. Weiger, C. Walter
Objective: To evaluate the influence of the lateral deflection of the toothbrush bristles (amplitude) of a
powered toothbrush with side-to-side action for noncontact biofilm removal in an interdental space model.
Methods: A three-species biofilm consisting of Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium nucleatum, and
Streptococcus sanguinis was formed in vitro on protein-coated titanium disks. A flow chamber system was
combined with a static biofilm growth model. The amplitude of a commercially available side-to-side tooth
brush was evaluated by means of a dose response. The amplitude was decreased in steps (100 %, 85 %,
70 %, 55 %, 40 %). Subsequently, the biofilm-coated substrates were exposed to the side-to-side tooth-
brush. The biofilm volumes were measured using volumetric analyses (Imaris 8.1.2) with confocal laser
scanning microscope images (Zeiss LSM700).
Results: The amplitude of the toothbrush bristles affected the biofilm reduction. The highest percentage of
biofilm reduction was obtained by 85 % of amplitude power setting. Decreasing the amplitude from 85 %
to 40 % led to increased median percentage of biofilm reduction (median biofilm reduction of 80 % to
25 %, p = 0.029). Additionally, the lowest amplitude showed an enhanced variety in the results of repeated
measurements.
Conclusions: The amplitude of the tested side-to-side toothbrush affected the biofilm reduction in an inter
dental space model.
*The project was supported in part by an unrestricted grant from the GABA Research Fund by the German
Society for Preventive Dentistry (DGPZM).
Parodontologie 2017;28(3):333–364Abstracts der Posterpräsentationen n 339
Poster 10
Vergleich von Langzeitstabilität an Implantaten und Kontrollzähnen während
unterstützender Parodontitistherapie
R. Kohnen, S. K. Sonnenschein, T-S. Kim
Ziel: Ziel der Studie war der retrospektive Vergleich der Langzeitstabilität an Implantaten, im Vergleich
zu natürlichen Kontrollzähnen. Die Veränderung der Sondierungstiefe und der Entzündungswerte an
Implantaten und Kontrollzähnen wurde über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren unterstützender
Parodontitistherapie (UPT) beobachtet.
Material und Methoden: Nach schriftlicher Einverständniserklärung wurden die parodontologischen Be-
funde von allen Patienten mit Implantaten, die im Zeitraum Juni 2014 bis Dezember 2016 an der UPT am
Universitätsklinikum Heidelberg teilgenommen haben und sich seit mind. 5 Jahren in dem Programm be-
fanden, retrospektiv ausgewertet. Als Kontrollzahn wurde der entsprechende Zahn im entgegenliegenden
Quadranten des gleichen Kiefers definiert, bei Fehlen dieses Zahnes, ein benachbarter Zahn der gleichen
Zahngruppe. Von anfangs 78 Patienten mit 154 Implantaten mussten 44 (96 Implantate) aufgrund unge-
nügender Dokumentation oder fehlender Kontrollzähne ausgeschlossen werden. Der klinische Zustand des
Parodonts wurde mithilfe der gemessenen Sondierungstiefen (ST) und Blutung auf Sondieren (BOP) an
mind. 4 Stellen pro Zahn/Implantat ausgewertet. Zusätzlich wurden Gesamt-BOP, sowie die Mundhygiene-
parameter Plaque-Control-Record (PCR) und Gingival-Bleeding-Index (GBI) analysiert.
Ergebnisse: Die mittlere ST am Kontrollzahn lag im Ausgangsbefund bei 2,53 ± 0,73 mm und am Implantat
bei 2,91 ± 1,10 mm. Nach 5 Jahren betrugen die mittlere ST am Kontrollzahn 2,55 ± 0,68 mm und am
Implantat 3,00 ± 0,90 mm. Die Anzahl der Blutungsstellen am Implantat nahm von 0,85 ± 1,37 auf
1,42 ± 1,66 zu. Am Kontrollzahn blieb die Anzahl der Blutungsstellen stabiler (0,83 ± 1,00 zu 0,98 ± 1,21).
Insgesamt gingen im Beobachtungszeitraum ein Kontrollzahn und ein Implantat verloren.
Schlussfolgerungen: Während der UPT scheinen sich die Sondierungstiefen an Implantaten und natürlichen
Zähnen ähnlich zu verändern. Die Implantate zeigten jedoch eine stärkere Zunahme der Entzündungswerte
als die Kontrollzähne, bei insgesamt stabilen Mundhygienewerten. Dies könnte darauf hinweisen, dass
Implantate von parodontal geschädigten Patienten eine erhöhte Nachsorgebedürftigkeit aufweisen.
Poster 11
Langzeitergebnisse der mundgesundheitsbezogenen Lebensqualität bei Patienten in der
unterstützenden Nachsorge
C. Betzler, S. K. Sonnenschein, T-S. Kim
Ziel: Erhebung der mundgesundheitsbezogenen Lebensqualität bei Patienten mit regelmäßiger unter
stützender Parodontitistherapie (UPT) von mindestens 5 Jahren.
Material und Methoden: 313 Patienten (146 Männer), die nach systematischer Parodontitistherapie
einer chronischen (n = 244) oder aggressiven (n = 68) Parodontitis seit 5–20 Jahren regelmäßig zur UPT
erschienen, wurden anhand des Oral Health Impact Profile-Germany Fragebogens mit 14 Fragen (OHIP-G14)
zur Einschränkung ihrer mundgesundheitsbezogenen Lebensqualität (MLQ) befragt. Folgende Parameter
wurden bestimmt: Erstdiagnose, OHIP-G14-Gesamtwert, Anzahl der Zähne im Gesamtgebiss, Anzahl
der Stellen mit Sondierungstiefen ≥ 6mm, Versorgung mit Teilprothese, Parodontitisrisiko sowie
Compliance.
Parodontologie 2017;28(3):333–364340 n A bstracts der Posterpräsentationen
Ergebnisse: Bei einem möglichen OHIP-G14-Summenwert von 56 betrug der mittlere Gesamtwert 3,64
und war bei weiblichen Patienten (3,87) höher als bei männlichen (3,38). 38,7 % gaben keine oralen Pro-
bleme an. Der mittlere OHIP-G14-Summenwert betrug bei Patienten ohne herausnehmbaren Zahnersatz
3,55, mit Teilprothese 4,19. In der Gruppe ohne herausnehmbaren Zahnersatz (n = 264) lag der mittlere
OHIP-G14-Summenwert bei Patienten, die nur Sondierungstiefen (ST) < 6mm aufwiesen bei 2,74, bei
ST ≥ 6 mm bei 4,43. Für die Gruppe mit Teilprothese betrugen die Werte 4,78 und 3,71. Bei Unterbrechung
des UPT-Intervalls über 1 Jahr war der mittlere OHIP-G14-Summenwert höher (5,39) als bei Patienten, die
regelmäßiger zur UPT erschienen (3,28). Bei niedrigem Parodontitisrisiko war er kleiner (2,68) als bei mitt-
lerem (3,18) und hohem Risiko (5,20).
Schlussfolgerungen: Der niedrige mittlere OHIP-G14-Summenwert lässt darauf schließen, dass die Befrag-
ten kaum eine Einschränkung ihrer MLQ empfanden. Patienten mit herausnehmbarem Zahnersatz schienen
sich in ihrer MLQ stärker eingeschränkt zu fühlen. Die Anzahl von Taschen mit ST ≥ 6 mm wirkte sich bei
Patienten ohne Teilprothese negativer auf die subjektive MLQ als bei Patienten mit Teilprothese. Insbeson-
dere eine UPT-Intervall-Unterbrechung über ein Jahr sowie bei Vorhandensein mehrerer Parameter, welche
für ein hohes Parodontitisrisiko sprechen, fühlten sich Patienten stärker in ihrer MLQ beeinträchtigt. Eine
regelmäßige Nachsorge hat offensichtlich einen starken Einfluss auf die subjektive MLQ und scheint sich
positiv auf diese auszuwirken.
Poster 12
Die Effektivität und subjektive Behandlerbewertung eines Zungensaugers –
eine Anwendungsbeobachtung
K. Stroh, P. Hahner, C. Klode, G. Gaßmann
Ziel: Auf dem Zungenrücken befinden sich mehr als 60 % der oralen Bakterien und bei Zungenbelägen ist
die Bakteriendichte bis um den Faktor 25 erhöht. Daher kommt der mechanischen Zungenreinigung be
sonders bei der Halitosistherapie eine wichtige Rolle zu. Das Ziel dieser Anwendungsbeobachtung war es,
die Effektivität eines neu entwickelten Zungensaugers und dessen Akzeptanz beim zahnmedizinischen
Prophylaxepersonal zu bewerten.
Material und Methoden: Die Effektivität des Zungensaugers (TS-1, TSPro, Karlsruhe) zur Entfernung von
Zungenbelägen wurde an 60 Patienten untersucht und gemäß dem von Winkel angegebenen Zungen
belagsindex (WTCI, Winkel et al., 2003) dokumentiert. Zusätzlich bewerteten 4 Untersucher unter Nutzung
des WTCI die Zungenoberfläche von 30 Patienten anhand von Fotografien. Die einzelnen Ergebnisse
wurden miteinander verglichen und der Übereinstimmungskoeffizient errechnet. Die subjektive Behandler-
bewertung wurde mittels eines Fragebogens mit 15 Items bei 24 Behandlern evaluiert.
Ergebnisse: Durch den Einsatz des Zungensaugers wird eine deutliche Reduktion der Zungenbeläge, ge-
messen am WTCI, erreicht (vor Behandlung WTCI-0 6,017 ± 2, nach erster Reinigung WTCI-1 3,167 ± 2,
nach Wiederholung der Reinigung WTCI-2 1,75 ± 1,4). Die Korrelationstests bezüglich der Übereinstimmung
des WTCI mit 4 Indexbestimmern ergaben hoch signifikante Werte (Kendall-Tau-b > 0,9 und Pearson-
Korrelation > 0,97). Durch die Einführung des Zungensaugers ist die Wahrnehmung des Themas Zungen-
belag und -reinigung beim zahnmedizinischen Prophylaxepersonal in den Zahnarztpraxen deutlich gestiegen.
Schlussfolgerungen: Der verwendete Zungensauger ist ein effektives Hilfsmittel zur mechanischen Zungen-
reinigung speziell in der zahnärztlichen Praxis und damit eine sinnvolle Ergänzung zu den zahlreichen auf dem
Markt befindlichen Produkten für die häusliche Anwendung. Damit wird der Bedeutung der mechanischen
Keimreduktion auf dem Zungenrücken im Rahmen des Individuellen Mundgesundheitscoachings (IMC)
Rechnung getragen.
Parodontologie 2017;28(3):333–364Abstracts der Posterpräsentationen n 341
Poster 13
Ist Zahnfleischbluten ein Symptom des von-Willebrand-Syndroms Typ 2 und 3?
L. Epping, K. Nickles, W. Miesbach, P. Eickholz
Ziel: Für das von-Willebrand-Syndrom (vWS) Typ 1 wurde gezeigt, dass die Parameter Gingivaler Blutungs-
index (GBI) und Bluten auf Sondieren (BOP) im Vergleich zu gematchten Kontrollen ohne Blutgerinnungs-
störung nicht stärker ausgeprägt sind und wesentlich von supragingivaler Plaque und parodontaler Er
krankung abhängen. In dieser Studie wurde untersucht, ob das Symptom Zahnfleischbluten bei den
schwereren Ausprägungen des vWS (Typ 2 und 3) stärker ausgeprägt ist als bei gematchten Kontrollen ohne
Blutgerinnungsstörung.
Material und Methoden: In diese prospektive klinische Fall-Kontroll-Studie wurden alle Patienten einge-
schlossen, die sich konsekutiv im Hämophiliezentrum Frankfurt mit einem Typ 2 oder 3 vWS vorstellten, Es
wurden Alter, Geschlecht, vWS-Parameter (vWS-Antigen, Ristocetin-Kofaktor, Faktor VIII), Medikation und
Nikotinabusus erfasst. Die Patienten wurden zur bestehenden Blutungssymptomatik befragt und es wurden
die Parameter Sondierungstiefen (ST), Rezession, BOP, GBI und supragingivale Plaque (PCR) erfasst.
Ergebnisse: 24 vWS- (Alter 45,9 ± 11,8 Jahre; Zahnzahl 26,7 ± 3,0; 7 Männer; 7 Raucher; CO-Gehalt der
Ausatemluft 3,9 ± 4,6 ppm) und 24 Kontrollprobanden (Alter 46,6 ± 12,4 Jahre; Zahnzahl 26,8 ± 2,2;
7 Männer; 7 Raucher; CO-Gehalt der Ausatemluft 2,8 ± 3,4 ppm) wurden untersucht. Bei den vWS-
Patienten lag das vWS-Antigen bei 44,0 ± 45,9 % (Normbereich: 60–200 %), der Ristocetin-Kofaktor bei
24,7 ± 23,4 % (Normbereich: 60–200 %) und der Faktor VIII bei 55,6 ± 46,3 % (Normbereich: 68–133 %).
Der GBI lag bei 10,5 ± 9,9 % (vWS) bzw. 8,8±4,8% (Kontrolle; p = 0,852), BOP bei 14,5 ± 10,1 % (vWS)
bzw. 12,3 ± 5,3 % (Kontrolle; p = 0,542).
Schlussfolgerungen: Die gingivale Blutungsneigung gemessen als GBI und BOP ist auch bei Typ 2 und
3 vWS nicht stärker ausgeprägt als bei entsprechenden Kontrollpersonen. GBI und BOP hängen vielmehr
von supragingivaler Plaque und parodontaler Erkrankung ab.
Poster 14
GATA-3-Polymorphismus beeinflusst den klinischen Attachmentlevel während der
unterstützenden Parodontitistherapie
K-A. Walther, J. R. Gonzales, S. E. Gröger, R. Koch, B. Ehmke, D. Kaner, T. Hoffmann, P. Eickholz, T. Kocher,
T-S. Kim, U. Schlagenhauf, J. Meyle
Ziel: GATA-3 ist ein wichtiger Transkriptionsfaktor während der Th2-Zell-Differenzierung und ein putativer
Tumorsuppressor. Patienten mit einem Mammakarzinom, die Träger eines Einzelnukleotid-Polymorphismus
(SNP) auf dem GATA-3-Gen sind, zeigen ein geringeres Risiko für die Entwicklung eines Mammakarzinoms.
Einige Studien fanden bei Parodontitis-(PAR)-Patienten ein signifikant erhöhtes Risiko für die Entstehung
eines oralen Tumors. Das Ziel dieser Studie war die Analyse eines SNPs auf dem GATA-3-Gen und die
Evaluation der Aussagekraft dieses Markers für die PAR-Progression nach nichtchirurgischer PAR-Therapie.
Material und Methoden: 209 PAR-Patienten, die Teil der prospektiven longitudinalen ABPARO-Studie
waren, wurden nach einer nichtchirurgischen PAR-Therapie, mit adjuvanter Antibiotikagabe (Amoxicillin
und Metronidazol) oder Placebo, nach 24 Monaten nachuntersucht. Die DNA wurde mittels quantitativer
Real-Time PCR an Positionen GATA-3-IVS4+1468 (rs3802604) genetisch analysiert. Die Hauptzielparameter
waren die Differenzen des mittleren klinischen Attachmentlevels (CAL) zwischen Baseline bzw. 3 (Reevaluation)
Parodontologie 2017;28(3):333–364342 n A bstracts der Posterpräsentationen
und 24 Monate nach PAR-Therapie. Die paarweisen Vergleiche zwischen Wildtyp, heterozygotem Genotyp
und SNP wurden mittels Wilcoxon-Mann-Whitney-Tests (U-Test) durchgeführt. Um den adjustierten Ein-
fluss der Genloci auf die Differenz vom CAL zu schätzen, erfolgte eine multivariate Analyse unter Anpassung
linearer Regressionsmodelle. Einflussgrößen waren die Gene IL-1, IL-4 und COX-2 mit den Genotypen
sowie die Therapiegruppe.
Ergebnisse: In der Antibiotikagruppe zeigten sich keine Unterschiede beim paarweisen Vergleich der Geno-
typen (p > 0,05; U-Test). In der Placebogruppe unterschieden sich die mittleren CAL-Differenzen zwischen
SNP und Wildtyp jeweils vor und nach der Therapie (24-Monate-Baseline p = 0,0085/24-Monate-
Reevaluation p = 0,0306). In den multivariaten Regressionsmodellen ergab sich ein adjustierter Unterschied
zwischen SNP und Wildtyp von -0,32 mm/-0,24 mm (p = 0,0116/p = 0,0218) in der CAL-Differenz bzw.
von -0,18 mm/-0,21 mm (p = 0,1591/p = 0,0424) für den Vergleich heterozygoter Genotyp gegen Wildtyp.
Schlussfolgerungen: Unabhängig von der gewählten PAR-Therapie zeigte der analysierte Marker einen
Einfluss auf die PAR-Progression nach einer nichtchirurgischen PAR-Therapie. Patienten, die Träger eines
heterozygoten Genotyps oder SNPs waren, erzielten einen höheren CAL-Gewinn während der UPT als
Wildtyp-Patienten.
Poster 15
Externe Gingivektomie einer Gingivavergrößerung
A. Ciardo, T-S. Kim, S. K. Sonnenschein
Anamnese: Der Patient ist 16 Jahre alt und männlich. Es sind keine Allgemeinerkrankungen oder Allergien
bekannt. Er nimmt keine Medikamente ein. Er wurde aufgrund ausgeprägter Gingivavergrößerung nach
festsitzender kieferorthopädischer Behandlung in die Sektion Parodontologie der Abteilung für Zahn
erhaltung des Universitätsklinikums Heidelberg überwiesen. Die Gingivaveränderung setzte mit Beginn der
kieferorthopädischen Behandlung ein und nahm in deren Verlauf zu. Der Patient berichtet über einen hohen
psychischen Leidensdruck und soziale Beeinträchtigungen aufgrund der Gingivaveränderung.
Befund: Ausgeprägte Gingivavergrößerung im Ober- und Unterkieferfrontzahnbereich. Es zeigen sich
generalisiert weiche Beläge und lokalisiert supra- und subgingivale Adhäsivreste. Es sind Sondierungstiefen
bis zu 6 mm (mittlere Sondierungstiefe: 3 mm) festzustellen. Der Patient zeigt habituelle Mundatmung.
Diagnose: Gingivavergrößerung modifiziert durch iatrogene Faktoren und Mundatmung.
Therapie: Zunächst wurden Adhäsivreste und Beläge im Rahmen von professionellen Zahnreinigungen
entfernt. Der Patient erhielt ein individuelles Mundhygienetraining inkl. der Anpassung von Interdental-
bürstchen. Die Mundhygieneindizes konnten im Verlauf der Therapie deutlich reduziert werden. Im Anschluss
wurde die Gingivavergrößerung im Oberkieferfrontzahnbereich mittels externer Gingivektomie entfernt.
Nach Markierung des Taschenbodens wurde in einem 45-Grad-Winkel nach schräg koronal der marginale
Gingivaverlauf mittels Skalpell präpariert. Papilläre Wucherungen wurden durch feine horizontale Schnitte
abgetragen. Nach Spülung mit steriler isotonischer Kochsalzlösung wurde die Wundfläche mit einem Zahn-
fleischverband abgedeckt. An einem weiteren Termin wurde das Vorgehen im Unterkiefer angewandt.
Verlauf: Die Wundheilung zeigte sich regelrecht und nach wenigen Wochen konnte ein für den jugendlichen
Patienten optimales Ergebnis erzielt werden, wodurch seine subjektiv empfundene Lebensqualität deutlich
gesteigert werden konnte.
Empfehlung: Aufgrund der weiter bestehenden Mundatmung und suboptimalen Mundhygiene ist ein
Rezidiv nicht auszuschließen. Ein engmaschiger Recall mit professioneller Zahnreinigung inkl. Mundhygiene
remotivation ist damit unerlässlich. Die interdisziplinäre Therapie der Mundatmung durch Logopädie und
Kieferorthopädie muss fortgesetzt werden.
Parodontologie 2017;28(3):333–364Abstracts der Posterpräsentationen n 343
Poster 16
Evaluation of stain removal using different air-polishing powders
M. Morawietz, S. Sarembe, A. Kiesow
Objective: Air-polishing powders made from different ingredients were evaluated regarding stain removal
on human enamel. Comparison was made between powders containing sodium bicarbonate (AIR-FLOW
Powder CLASSIC, EMS), glycine (AIR-FLOW Powder SOFT, EMS), and trehalose (Lunos Gentle Clean, Dürr
Dental AG). The particle size of all powders is 65 µm.
Methods: Embedded and flat ground human tooth crowns were treated with a phosphoric acid gel and
artificial saliva followed by a staining procedure based on chlorhexidine and black tea. Treatment with
air-polishing powders was conducted by fixing the samples to an automated brushing machine to generate
a reproducible movement of the powder beam. Cleaning performance was determined by colorimetric
measurements (L*a*b* values) on the initial samples after staining and after air polishing. Images of the
specimens were taken under standardized conditions using a reflex camera. Ten enamel samples were used
per air-polishing powder.
Results: AIR-FLOW Powder CLASSIC had the best cleaning performance. Lunos Gentle Clean exhibited
similar cleaning performance to AIR-FLOW Powder SOFT but significantly lower cleaning performance than
AIR-FLOW Powder CLASSIC. For all three powders, cleaning performance was significantly higher than that
of water alone. Noteworthy is the high reproducibility demonstrated by Lunos Gentle Clean. Its standard
deviation is considerably lower than that of the two AIR-FLOW powders. Photographs of samples taken
after treatment confirm the quantitative color measurements.
Conclusions: Sodium bicarbonate-based air-polishing powder showed the best cleaning results compared
with glycine- and trehalose-based powders, which revealed similar results. However, this is in line with the
postulated lower abrasiveness of both glycine and trehalose. The very limited cleaning performance of
water alone confirms the cleaning efficiency of all tested air-polishing powders. Both evaluation methods
(quantitative colorimetry and photography) support the conclusion.
*This study was supported by Orochemie GmbH + Co. KG, a company of the Dürr Dental Group.
Poster 17
Validierung eines Prognosemodells zum Zahnverlust von Parodontitispatienten
C. Graetz, E. Schmietendorf, A. Plaumann, J. Fritzsche, C. Dörfer, F. Schwendicke
Ziel: Zur Entscheidung für oder gegen den Erhalt von Zähnen bei Parodontitispatienten können multivariable
Modelle eingesetzt werden. Viele dieser Modelle wurden in einer bestimmten Population entwickelt, jedoch
unzureichend (an anderen Populationen) validiert. Ziel der Studie war die Validierung eines komplexen
Prognosemodells in einer für 22 ± 6 Jahre durch unterstützende Parodontitistherapie (UPT) nachversorgten
Population von Patienten mit chronischer bzw. aggressiver Parodontitis.
Material und Methoden: Von 2.564 Patienten mit einer aktiven Parodontitistherapiephase (APT: T0–T1)
zwischen 1982–1998 wiesen 301 eine vollständige Dokumentation der röntgenologischen und klinischen
Variablen während einer UPT (T1–T2) ≥ 9 Jahre mit ≥ 1 Behandlungssitzung/Jahr auf. Der Endpunkt unserer
Analyse war der Zahnverlust. Zur Prognose wurden Patientenvariablen (Versicherungs-, Raucherstatus,
systemische Erkrankungen, Compliance) sowie Zahnvariablen (Sondierungstiefe, Mobilität, Knochenabbau
[Tiefe, Morphologie des Defektes], endodontische Therapie mit/ohne Stiftversorgung, Wurzelresektionen,
Parodontologie 2017;28(3):333–364344 n A bstracts der Posterpräsentationen
Kronen-Wurzelverhältnis, ausgedehnte kariöse Läsionen), die bei T0 erhoben worden sind, nach dem von
Avila et al. (2009) beschriebenen Algorithmus eingesetzt. Sensitivität und Spezifität wurden für die 5 ko-
dierten Schweregrade kalkuliert und die Fläche unter der Receiver-Operating-Characteristics-Kurve (AUC)
berechnet.
Ergebnisse: Das mittlere Alter aller Patienten bei T0 betrug 46 ± 10 Jahre (Streubreite: 16–73 Jahre). Ins-
gesamt wurden 387 Zähne in der APT und 1.017 Zähne in der UPT entfernt, 6371 Zähne überlebten bis
T2. Das eingesetzte Prognosemodell zeigte zur Vorhersage der Zahnverluste in APT/UPT/APT + UPT mo-
derate Güte (mittlere AUC: 0,725/0,668/0,722). Das Risiko, Zähne fälschlicherweise zu extrahieren, war
nur bei dem höchsten Schweregrad akzeptabel (1-Spezifität: 14 %/16 %/12 %). Hingegen war die Vor-
hersage von Zahnverlusten bei diesem Grad nur bedingt möglich (Sensitivität: 57 %/45 %/52 %).
Schlussfolgerungen: Das eingesetzte Prognosemodell war in der untersuchten Parodontitispopulation nur
bedingt in der Lage Zahnverluste korrekt vorherzusagen. Nur wenn der höchste Schweregrad als Entschei-
dungskriterium eingesetzt wurde, war die Spezifität akzeptabel. Auch komplexe Prognosemodelle sind nicht
zwingend in der Lage, eine valide Langzeitabschätzung zum Risiko des Zahnverlustes zu treffen.
Poster 18
Zahnverlust während 10 Jahren unterstützender Parodontitistherapie
S. Karamustafa, S. K. Sonnenschein, T-S. Kim
Ziel: Ziel der Studie war die Erfassung der Gründe für Zahnverlust bei Parodontitispatienten während
10 Jahren unterstützender Parodontitistherapie (UPT) und der Vergleich der Gründe bei Patienten mit
chronischer (CP) und aggressiver Parodontitis (AP).
Material und Methoden: Nach schriftlicher Einverständniserklärung wurden die Befunde von 199 Patienten,
welche sich seit 10 Jahren regelmäßig in UPT befinden, retrospektiv erhoben. Verglichen wurde die Anzahl
der Zähne im Gesamtgebiss nach abgeschlossener antiinfektiöser Therapie (T1) mit der Anzahl nach
10 Jahren (± 6 Monate) UPT (T10). Die Gründe für Zahnverlust zwischen T1 und T10 wurden erfasst und
diese zwischen den Gruppen AP und CP verglichen.
Ergebnisse: Zum Zeitpunkt T1 waren insgesamt 4690 Zähne vorhanden, zum T10 4454 Zähne, was einem
Verlust von 5,03 % bzw. im Mittel 1,19 Zähnen pro Patient entspricht. In der Gesamtkohorte war der
häufigste Grund für Zahnverluste ein parodontologisches Problem (49,58 %) gefolgt von endodontalen
Problemen (29,24 %). Weitere Zahnverluste sind aufgrund Paro-Endo-Läsionen (2,97 %), aus protheti-
schen Gründen (2,97 %) und durch Karies (0,85 %) verursacht worden. Bei 14,41 % der Zähne konnte der
Grund für den Zahnverlust nicht nachvollzogen werden. 44 Patienten hatten eine AP und 155 eine CP.
Differenziert nach Diagnose zeigten die Patienten mit AP mit 7,1 % (im Mittel 1,77 Zähne pro Patient)
einen höheren Zahnverlust als Patienten mit CP, welche 4,4 % (im Mittel 1,02 Zähne pro Patient) verloren
haben. Die Patienten mit CP wiesen eine ähnliche Anzahl von Zahnverluste wegen parodontologischer
(39,87 %) und endodontaler Probleme (35,44 %) auf, wohingegen die Patienten mit AP 69,23 % der Zähne
aus parodontologischen Gründe und 16,67 % aus endodontalen Probleme verloren haben.
Schlussfolgerungen: In dieser Studie wurden parodontologische und endodontale Probleme als die
häufigsten Ursachen für den Zahnverlust während 10 Jahren UPT festgestellt. Patienten mit AP wiesen einen
höheren Zahnverlust auf, wobei der Anteil der AP-Patienten in dieser Studie im Vergleich zur Verteilung in
der Bevölkerung deutlich erhöht war.
Parodontologie 2017;28(3):333–364Abstracts der Posterpräsentationen n 345
Poster 19
Adjuvante photodynamische Therapie in der Behandlung schwerer chronischer Parodontitis
D. Hoedke, D. Omlor, N. Pischon, H. Dommisch, A. Kielbassa
Ziel: Ziel der Studie war die Untersuchung der Effektivität der adjuvanten photodynamischen Therapie (PDT)
zur mechanischen Reinigung der Zahnwurzeloberflächen im Rahmen der antiinfektiösen Therapie (AIT).
Material und Methoden: 45 systemisch gesunde Patienten (Nichtraucher) mit schwerer chronischer Par-
odontitis wurden in einer dreiarmigen, kontrollierten, monozentrischen, einfach-verblindeten klinischen
Studie behandelt: Kontrollgruppe: AIT mit Handinstrumenten; Testgruppe 1: AIT, einmalige PDT; Test-
gruppe 2: AIT, zweimalige PDT. Sechs Monate nach der ersten Behandlung erfolgte eine zweite Behandlung
entsprechend dem gleichen Therapieprotokoll in den Gruppen. Folgende Parameter wurden vor der Therapie
sowie 3, 6 und 12 Monate posttherapeutisch erhoben: Plaqueindex, Gingivaindex, Sondierungstiefe (ST),
Sondierungsblutung (SB), Attachmentverlust sowie die Bestimmung der parodontalen Entzündungsoberfläche
(PISA). Die statistische Auswertung erfolgte deskriptiv sowie mittels univariater Varianzanalysen (ANOVA)
und verbundener T-Tests.
Ergebnisse: Vor der Therapie gab es keine Unterschiede hinsichtlich der parodontalen Paramater zwischen
den Gruppen (ST, SB, PISA: Kontrollgruppe: 2,8 mm, 26,3 %, 528,3 mm2; Testgruppe 1: 2,7 mm, 21,7 %,
429,1 mm2; Testgruppe 2: 2,7 mm, 23,6 %, 460,2 mm2; p > 0,05, ANOVA). Nach drei Monaten waren ST,
SB und PISA in allen drei Gruppen signifikant geringer im Vergleich zur Ausgangsuntersuchung (Kontroll-
gruppe: 2,3 mm, 14,9 %, 252,9 mm2; Testgruppe 1: 2,3 mm, 14,9 %, 236 mm2; Testgruppe 2: 2,3 mm,
13.3 %, 205,7 mm2; p > 0,05, ANOVA). Die niedrigsten Werte für ST, BOP und PISA wurden nach
12 Monaten detektiert: Kontrollgruppe 2,2 mm, 14.8 %, 229,4 mm2; Testgruppe 1: 2,2 mm, 11.8 %,
206,8 mm2; Testgruppe 2: 2,1 mm, 12,2 %, 187,1 mm2.Für alle posttherapeutischen Untersuchungs
zeitpunkte gab es keine Unterschiede zwischen den Gruppen (p > 0,05, ANOVA).
Schlussfolgerungen: Ein Trend hinsichtlich der Reduktion der parodontalen epithelialen Entzündungs
oberfläche kann bei zweimaliger Anwendung der PDT 12 Monate nach der Behandlung eruiert werden,
jedoch waren die Unterschiede zwischen den Gruppen nur geringfügig.
*Die Untersuchung wurde unterstützt durch die Firma Helbo (Grieskirchen, Österreich).
Poster 20
Tabakentwöhnung während der Parodontaltherapie: Gesprächsempfehlungen ohne
„Dr. Google“
F. Wörner, T. Eger, A. Brinkmann, B. Raffel, A. Kasaj
Ziel: Rauchen, meist von Zigaretten, ist der wichtigste extrinsische Risikofaktor für die Entwicklung einer
chronischen Parodontitis. In der Bundeswehr ist Rauchen weiterhin stark verbreitet. Zahnärzte sind bisher
nur selten in Maßnahmen der Tabakentwöhnung involviert. Das Ziel der hier vorgestellten Pilotstudie war
es, den Erfolg eines Tabakentwöhnungsprogrammes mittels edukativer Aufklärung und Motivation in
6–8 Behandlungssitzungen während einer nichtchirurgischen Parodontaltherapie (Full Mouth Deep Scaling
and Root Planing) aufgrund einer chronischen Parodontitis zu evaluieren.
Material und Methoden: Der Erfolg bzw. Misserfolg der Tabakentwöhnung wurde anhand der subjektiven
Angabe der Studienteilnehmer bezüglich ihres Tabakkonsums sowie dem Urin-Cotininspiegel der Studien-
teilnehmer bei Baseline und nach 55 Wochen dokumentiert.
Parodontologie 2017;28(3):333–364346 n A bstracts der Posterpräsentationen
Ergebnisse: 114 von 153 vorgestellten Patienten (57 Raucher und 57 Nichtraucher, Durchschnittsalter
48 ± 8 Jahre) absolvierten die nichtchirurgische Parodontaltherapie (Sitzungen 1–3). 51 Raucher (R) und
50 Nichtraucher (NR) schlossen die Studie nach einem Jahr ab. 7 Raucher waren nach einem Jahr rauchfrei
(RF: 14 %). 5 weitere Raucher gaben eine Tabakentwöhnung im Untersuchungszeitraum an, wurden aber,
nach Auswertung der Urin-Cotininmessungen, als rückfällig eingestuft. 7 Raucher erhöhten und 10 Raucher
reduzierten Ihren Tabakkonsum. Die Cotininspiegelbestimmung bei Studienende bestätigte die Tabak
entwöhnung bei allen 7 RF-Patienten. Das Ausmaß der Tabakabhängigkeit entsprechend den Fagerström-
Test-Scores 0–4 für geringe Abhängigkeit wurde für 27 Patienten (53 % – Tabakentwöhnungsrate 19 %),
5–6 für mittelstarke Abhängigkeit für 14 Patienten (27 % – Tabakentwöhnungsrate 14 %)und 7–10 Punkte
für 10 stark abhängige Raucher (20 %) ermittelt. Stark vom Tabakkonsum abhängigen Patienten gelang
keine Tabakentwöhnung im Studienzeitraum.
Schlussfolgerungen: Der Erfolg einer Tabakentwöhnung mittels edukativer Begleitung einer Parodontal
therapie durch geschulte Zahnärzte ist möglich, die Erfolgsquote ist vergleichbar mit verhaltenstherapeu
tischen Programmen durch Ärzte. Der Anteil von Rauchern (59 %), die ein Interesse an einer edukativen
Tabakentwöhnung im Rahmen der Parodontaltherapie zum Erhalt ihrer Zähne hatten, ist ermutigend. Bisher
liegt die Verantwortung für Tabakentwöhnung und Ernährungsberatung bei den Truppenärzten. Diese sollte
auf Truppenzahnärzte und den militärischen Vorgesetzten ausgedehnt werden. Für die objektive Kontrolle
des Rauchkonsums ist die Cotininspiegelbestimmung im Urin geeignet. Weitere Forschungen an größeren
Studiengruppen und im Vergleich zu gruppentherapeutischen Maßnahmen oder medikamentöser Begleit
therapie sind notwendig um unsere Ergebnisse zu bestätigen.
*Die Studie wurde als Sonderforschungsprojekt der Bundeswehr finanziert.
Poster 21
IL-6 c.-174 G/C-Polymorphismus und Oralhygiene als kardiale Risikofaktoren
V. Beschow, S. Reichert, S. Schulz, A. Schlitt
Ziel: Die Assoziation zwischen koronaren Herzerkrankungen und Parodontitis wird vielfach diskutiert und in
aktuellen Metaanalysen mit moderater Evidenz (20 %) angegeben (Leng et al., 2015). Grundlage bildet die
Vielzahl gemeinsamer Risikofaktoren sowie eine vergleichbare primär-inflammatorische Pathophysiologie.
Als zentraler Mediator einer derartigen Inflammation agiert das Zytokin IL-6, dessen Transkriptionsrate
durch den c.-174 G/C-Polymorphismus (rs1800795) modifiziert werden kann.
Zielstellung war es, unter Berücksichtigung des IL-6-Polymorphismus, die prospektive potentielle Bedeutung
der Parodontitis und ihrer Risikofaktoren auf das kardiovaskuläre Outcome von Patienten mit relevanter
Koronarstenose zu untersuchen.
Material und Methoden: Von 942 initial eingeschlossenen Probanden konnten 895 im dreijährigen
Follow-up nachuntersucht werden. Ausgeschlossen wurden Probanden unter 18 Jahren, Koronarstenosen
< 50 %, Patienten mit weniger als vier Zähnen, Probanden mit AB-Therapie in den letzten drei Monaten
sowie ein subgingivales Debridement in den letzten sechs Monaten. Klinisch erfolgte die Erhebung parodon-
tologischer Parameter mittels druckkalibrierter Messsonde sowie die Bestimmung von Plaque- und Blutungs
indizes. Die mikrobiologische Untersuchung der subgingivalen Plaque wurde mittels Micro-Ident Plus-Test
(Hain Lifescience, Nehren) durchgeführt, während der Nachweis des IL-6-Polymorphismus nach DNA-
Präparation mit dem Cytokine CTS-PCR-SSP Tray Kit erfolgte.
Ergebnisse: 166 Studienprobanden (18,5 %) wiesen innerhalb des Nachbeobachtungszeitraums ein kardiales
Outcome (MI, TIA/Stroke, kardialer Tod) auf. Im Rahmen der multivariablen Analyse parodontaler Parameter
waren davon signifikant häufiger Patienten mit einem Plaqueindex > 1 (HR: 1,53) und einem BOP > 30 %
Parodontologie 2017;28(3):333–364Abstracts der Posterpräsentationen n 347
(HR: 1,78) betroffen. Bei Betrachtung weiterer Risikofaktoren zeigten Patienten mit anamnestisch bekann-
tem Myokardinfarkt (HR: 1,50), Diabetes mellitus Typ II (HR: 1,81) sowie einem erhöhtem CRP-Spiegel
(> 10mg/l; HR: 1,88) eine signifikant höhere Rate an kardialen Ereignissen. Darüber hinaus konnte der
c.-174 CC-Genotyp als möglicher prädiktiver Faktor für erneute kardiale Ereignisse identifiziert werden
(HR: 1,67, p = 0,003), dies gilt insbesondere bei einem über die Norm (> 10 pg/ml) erhöhten IL-6-Spiegel
(Log-Rank, p = 0,003).
Schlussfolgerungen: Neben bekannten Risikofaktoren wie kardialen Vorerkrankungen und Diabetes mellitus
stellen auch die individuelle Mundhygiene sowie der IL-6 c.-174 CC-Genotyp Prädiktoren eines wiederholten
kardialen Ereignisses dar.
Poster 22
Fallpräsentation einer generalisierten aggressiven Parodontitis
S. Rahim, S. K. Sonnenschein, T-S. Kim
Anamnese: Die allgemeine Anamnese der 35-jährigen Patientin ist unauffällig. Die Patientin hat bis 2014
ca. 20 Zigaretten/Tag über 15 Jahre konsumiert (15 packyears). Bei einer Körpergröße von 170 cm und
einem Gewicht von 104 kg liegt der Body-Mass-Index bei 36 (Adipositas Grad II). Innerhalb der Familie sind
nach Angaben der Patientin auch die Eltern und ein Geschwisterteil an einer Parodontitis erkrankt. Die
Patientin stellte sich im Juni 2016 mit seit vier Jahren bestehenden zunehmenden Zahnlockerungen in der
Poliklinik für Zahnerhaltung der Universitätsklinikums Heidelberg vor. Aufgrund der Progredienz hatte der
Hauszahnarzt die Oberkieferfrontzähne mittels Retainer geschient.
Befund: Es liegen generalisierte Rezessionen vor. Die mittlere Sondierungstiefe lag bei 6,98 ± 2,85 mm und
der Attachmentverlust bei 9,24 ± 2,61 mm.
Diagnosen: 1. Generalisierte aggressive Parodontitis; 2. Nicht erhaltungsfähiger Zahn 18
Therapie: Der mikrobiologische Test (Carpegen Periodiagnostik, Carpegen, Münster) ergab keinen
Nachweis des Bakteriums Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Aufgrund der Schwere des klinischen
Erscheinungsbildes erfolgte dennoch eine adjuvante Antibiotika-Gabe (500 mg Amoxicillin + 400 mg
Metronidazol, dreimal pro Tag für 7 Tage). Die antiinfektiöse Therapie wurde nach dem Konzept der
Full-Mouth-Disinfection durchgeführt. Die paarweise Schienung der Oberkieferseitenzähne und die Ex
traktion des Zahnes 18 fanden in der ersten Sitzung des subgingivalen Debridements statt.
Verlauf: Der zunehmend entzündungsreduzierte Zustand führte im Verlauf von einigen Wochen und nach
erneuter subgingivaler Reinigung zu einer deutlichen Reduktion der pathologisch vertieften Taschen auf
eine mittlere Sondierungstiefe von 2,76 ± 0,91 mm sowie einem durchschnittlichen Attachmentverlust von
5,85 ± 1,97 mm. Im Anschluss folgte die chirurgische Korrekturphase.
Empfehlung: Die Behandlung von Patienten mit einer generalisierten aggressiven Parodontitis stellt weiter-
hin eine große Herausforderung für Zahnarzt und Patienten dar. Der Behandlungserfolg und die Tendenz
zum Erhaltungsversuch sind wesentlich von der Compliance des Patienten abhängig.
Parodontologie 2017;28(3):333–364348 n A bstracts der Posterpräsentationen
Poster 23
Zahnmedizin außerhalb der Zahnarztpraxis – gesellschaftliche Herausforderungen für die
zahnmedizinische Prävention
J. Blank, G. Gaßmann
Hintergrund: Die Unterzeichnung der UN-Behindertenkonvention im Jahr 2009 sowie die Zuwanderung
von Flüchtlingen seit dem Jahr 2015 stellen das Gesundheitssystem in Deutschland vor Herausforderungen,
von denen die Zahnmedizin in erheblichem Maße betroffen ist. Die UN-Konvention garantiert behinderten
Menschen das Recht auf „das Höchstmaß an Gesundheit ohne Diskriminierung aufgrund von Behinde-
rung“. Dessen ungeachtet weisen Behinderte in Deutschland oft eine schlechtere orale Gesundheit auf als
Menschen ohne Behinderung. Gleichzeitig sind aufgrund der Flüchtlingskrise aktuell ca. 300.000 minder-
jährige Flüchtlinge in Deutschland registriert. Zahlreiche Studien konnten einen erhöhten Kariesbefall als ein
hauptsächliches gesundheitliches Defizit in dieser Personengruppe identifizieren. Da allen in Deutschland
lebenden Kindern unabhängig von ihrer Herkunft und ihrem rechtlichen Status gleiche Gesundheitsrechte
zustehen, ist es erforderlich, minderjährige Flüchtlinge in zahnmedizinische Versorgungs- und Prophylaxe-
programme einzubinden, um ihnen dauerhafte Mundgesundheit zu ermöglichen.
Material und Methoden: Die Integration von Menschen mit Behinderung sowie (minderjährigen) Flüchtlin-
gen erfordert neue Wege der zahnmedizinischen Prävention. Kognitive oder motorische Einschränkungen,
Sprachschwierigkeiten, kulturelle Besonderheiten und ein niedriger sozioökonomischer Status stehen in
diesen Personengruppen einem mundgesundheitsfördernden Verhalten sowie der Inanspruchnahme prä-
ventiver Leistungen oft im Wege. Um der gesetzlichen Forderung nach Verbesserung der Mundgesundheit
beider Bevölkerungsgruppen Genüge zu leisten, müssen die Patienten in ihrer häuslichen Umgebung auf-
gesucht und individuell betreut werden. Studierende der Dentalhygiene erlernen im Rahmen Ihres Studiums
an der praxisHochschule Köln die Erstellung solcher Prophylaxekonzepte und führen sie in entsprechenden
Einrichtungen durch.
Ergebnisse: Studien zeigen, dass Präventionsprogramme die Prävalenz von Karies und Parodontal
erkrankungen bei Behinderten signifikant senken. Im Bereich der Kariesprophylaxe bei Kindern wird der
verzeichnete Kariesrückgang auf die Effektivität präventiver Maßnahmen zurückgeführt, von denen
Flüchtlingskinder ebenfalls profitieren könnten.
Schlussfolgerungen: Die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen „Inklusion Behinderter“ und
„Flüchtlingskrise“ erfordern innovative Prophylaxekonzepte jenseits der zahnärztlichen Praxis. Hausbesuche
durch qualifizierte Dentalhygienikerinnen bieten eine medizinisch und wirtschaftlich sinnvolle Möglichkeit
zur Förderung der Mundgesundheit in den genannten Bevölkerungsgruppen.
Poster 24
Problembasiertes Lernen – klinische Instruktion für die Anwendung einer Gracey-Kürette
J. Haas, J. Blank, J. Breuer, K. Anderie, G. Gaßmann, B. Veltjens
Ziel: Die praxisHochschule Köln verpflichtet sich einer anwendungs- und am Lernenden orientierten Lehre.
Handlungs orientierte Didaktik ist eine grundlegende methodische Anforderung bei der Lehrplanung.
Problembasiertes Lernen (PBL) in praktischen Lehreinheiten bietet den Studierenden eine explorative
Lernumge bung und soll neben Sach- und Methodenkompetenz, Handlungs- und Problemlösungs -
kompetenz abverlangen sowie die selbständige Reflexion der Handlungsabläufe stärken.
Parodontologie 2017;28(3):333–364Sie können auch lesen