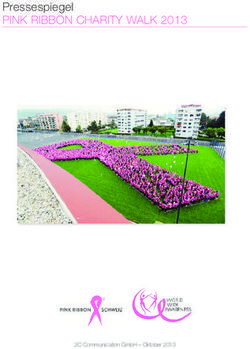Die Auswirkungen des Klimawandels auf den Waldbestand im Forstbezirk Neudorf - Anna Bretschneider
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Die Auswirkungen des Klimawandels
auf den Waldbestand im Forstbezirk
Neudorf
von
Anna BretschneiderInhaltsverzeichnis Evangelische Schulgemeinschaft Erzgebirge....................................................................1 Fachbereich: Geografie......................................................................................................1 Betreuer: Tabea McDonald................................................................................................1 Schuljahr: 2019/20.............................................................................................................1 1 Einleitung........................................................................................................................3 2 Klimawandel Definition.................................................................................................3 2.1 Klimawandel in Sachsen.........................................................................................4 3 Lagebeschreibung des untersuchten Gebietes................................................................5 4 Bestandsaufnahme des Waldgebietes um 2009/2010.....................................................6 4.1 Klima 2009/2010....................................................................................................6 4.2 Fläche der Wälder 2009..........................................................................................6 4.3 Gesundheit der Wälder 2009...................................................................................7 5 Bestandsaufnahme des Waldgebietes 2018/2019 im Vergleich......................................7 5.1 Klima 2018/2019....................................................................................................7 5.2 Fläche der Wälder 2019..........................................................................................8 5.3 Gesundheit der Wälder 2019...................................................................................9 6 Mögliche Zusammenhänge mit dem Klima...................................................................9 6.1 Kalte, niederschlagsreiche Winter..........................................................................9 6.2 Abrupter Übergang von Winter zu Frühjahr ........................................................10 6.3 Heiße, trockene Sommer ......................................................................................10 7 Schutzmöglichkeiten der Wälder..................................................................................11 7.1 Unterdrückung der Verbreitung des Borkenkäfers................................................11 7.2 Mischwälder .........................................................................................................12 7.3 Natürliche Anpassung...........................................................................................13 8 Fazit..............................................................................................................................13 9. Literaturverzeichnis.....................................................................................................14 Selbstständigkeitserklärung.............................................................................................17 Die Auswirkungen des Klimawandels auf den Waldbestand im Forstbezirk Neudorf
1 Einleitung
Der Wald ist nicht nur ein Erholungsort zum Besinnen oder eine Landschaftsbestückung, sondern
auch ein essenzieller Lebensraum für viele Organismen, ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und
notwendiger Sauerstoffproduzent. Wenn man den heimischen erzgebirgischen Wald betrachtet und
ein paar Jahre zurückdenkt, bemerkt man jetzt die Veränderungen, die sich in dieser Zeit vollzogen
haben: Durch den vielen Schnee im Winter halten die Äste und Baumspitzen der Belastung nicht
stand und zerbrechen, wodurch man überall umgefallene Bäume erblicken kann. Starke Stürme
reißen ebenfalls dünne Fichten zu Boden. In den Sommern wird der Wald immer mehr ausgedünnt
durch die Verbreitung von Parasiten. Aber, woran genau liegt das eigentlich? Gibt es
Zusammenhänge zum aktuellen Klimawandel, durch den es immer wärmer wird?
Ich möchte herausfinden, ob sich Auswirkungen des Klimawandels anhand der Gesundheit des
erzgebirgischen Waldes rund um meinen Wohnort Neudorf nachweisen lassen, um mögliche
Schutzmöglichkeiten vorzustellen. Aufgrund der genannten Indizien vermute ich, dass der
Klimawandel seine Spuren auch im heimischen Wald hinterlässt. Das möchte ich herausfinden,
indem ich wissenschaftliche Lektüren durcharbeite, aktuelle Zeitungen zum Thema lese, im Internet
recherchiere und vor allem indem ich Fachkundige, wie Naturschützer oder Forstangestellte,
interviewen werde, weil ich bei dieser Methode gezielt und sicher an Informationen gelangen kann.
Es interessiert mich, wie sich der Wald durch das Klima verändert, weil der Wald essentiell wichtig
für das Klima und damit für die komplette Menschheit ist. Zudem ist es ein sehr naheliegendes
Thema, das meine heimatliche Umgebung betrifft, bei dem ich Vorwissen besitze, fast täglich damit
in Kontakt komme und mich persönlich an Experten wenden kann.
Zu Beginn werden der Klimawandel und das untersuchte Gebiet definiert. Anschließend wird der
erzgebirgische Wald von 2009 und 2010 in ausgewählten Aspekten untersucht und im nächsten
Kapitel mit dem aktuellen Bestand von 2018 und 2019 verglichen. Folgend werden
Zusammenhänge mit der Klimaveränderung dargestellt und im nächsten Kapitel
Naturschutzmaßnahmen aufgezeigt. Danach wird alles in einem Fazit zusammenfasst. Es folgt nun
der Anhang und das Literaturverzeichnis.
2 Klimawandel Definition
Ein Klimawandel, der natürlicherweise oder anthropogen, von Menschen beeinflusst, entstehen
1kann, beschreibt eine messbare Veränderung des globalen Durchschnittsklimas. 1 „Klima ist der
mittlere Zustand der Atmosphäre an einem bestimmten Ort oder in einem bestimmten Gebiet über
einen längeren Zeitraum“.2
Der aktuelle, anthropogene Klimawandel zeigt sich dadurch, dass seit dem vergangenen
Jahrhundert die Temperatur steigt.3 Die Ozonschicht, die ein konstantes Klima reguliert, indem sie
das Eintreffen der Sonnenstrahlen bestimmt wird in diesem Fall von Treibhausgasen angegriffen.
Der Ausstoß dieser Gase wie Kohlenstoffdioxid, Stickstoffdioxid oder Methan ist größtenteils auf
den Menschen zurückzuführen. Durch diese Gase wirkt die Atmosphäre wie ein Spiegel und
reflektiert die von der Erde stammenden Wärmestrahlen, wodurch sich die Temperatur auf der Erde
erhöht.4
Auswirkungen dieser Durchschnittstemperaturerwärmung sind sehr komplex und noch nicht
vollständig absehbar5, aber zum Beispiel betreffen sie den Anstieg des Meeresspiegels,
Veränderungen der Meeresströme, der Niederschläge, der Vegetationen oder die Zunahme von
Extremwetterereignissen.6
2.1 Klimawandel in Sachsen
Der globale Klimawandel hinterlässt auch seine Spuren in Sachsen.
Sachsen befindet sich in einer Omega-Wetterlage, was bedeutet, dass ein beständiges
Hochdruckgebiet zwischen zwei ebenso beständigen Tiefdruckgebieten eingebettet ist. 7
„Atmosphärische Zirkulatonen“8 werden durch den Temperaturanstieg verändert, weshalb die
Omega-Wetterlagen über Sachsen sich nur langsam verschieben und für längere Zeit das Wetter
festlegen. Die Auswirkungen daraus zeigen sich durch Hitze und Trockenheit bis hin zu Dürren und
im Winter durch Kälte bis hin zu Kältewellen. 9 „Häufigkeit und Intensität witterungsbedingter
1 Vgl. Fuchs, Manuel: „Globalisierung Fakten“ (o. J.), online unter URL https://www.globalisierung-
fakten.de/klimawandel/definition/ [Stand: 15.11.2019].
2 Umweltbundesamt: „Was ist eigentlich Klima?“ (01.08.2013 ), online unter URL
https://www.umweltbundesamt.de/service/uba-fragen/was-ist-eigentlich-klima.
3 Vgl. Umweltbundesamt: „Klimawandel“ (23.02.2016), online unter URL
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimawandel [Stand: 11.01.2020].
4 Vgl. Umweltbundesamt: „Klimawandel und Treibhauseffekt“ (01.09.2014), online unter URL
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimawandel/klima-treibhauseffekt#textpart-1 [Stand:
11.01.2020].
5 Vgl. Paeger, Jürgen: „Die Folgen des Klimawandels“ (o. J.), online unter URL http://www.oekosystem-
erde.de/html/klimawandel-03.html [Stand: 12.01.2020].
6 Vgl. Günther, Prof. Dr. Edeltraud: „Klimawandel: Definition“ (14.02.2018), online unter URL
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/klimawandel-52424 [Stand: 18.11.2019].
7 Klaßen, Dipl.-Met. Dr. Joachim: „Omegawetterlage – Wetterlexikon“ (o.J.), online unter URL
https://www.wetteronline.de/wetterlexikon?topic=omegawetterlage [01.02.2020].
8 Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft: „Klimawandel in Sachsen – wir passen uns an!“,
SDV Direct World GmbH, 10.11.2015, S. 8.
9 Vgl. Ebd.
2Extreme nehmen in Folge des Klimawandels in Sachsen zu.“ 10 Zukünftig werden
Starkniederschläge und lang anhaltende Trockenperioden sowie intensive Niederschläge und
Unwetter in allen Jahreszeiten zunehmen.11
Es verringern sich die Frühjahrs- und Sommerniederschläge, wogegen die Niederschläge im Winter
leicht steigen.12 Dennoch „nimmt die Jahresniederschlagssumme tendenziell ab.“13 Der Übergang
vom Winter zum Frühjahr wird immer trockener und findet abrupter statt. 14 Die
Jahresmitteltemperatur hat sich in Sachsen seit 1961 bis zum Jahr 2007 um 1,35 Kelvin erhöht.15
Demnach sorgt die Erderwärmung für Sachsen und damit auch für das Erzgebirge vor allem für
mehr Wetterextremereignisse und Trockenheit.
3 Lagebeschreibung des untersuchten Gebietes
„Der Forstbezirk Neudorf erstreckt sich von Gelenau im Norden bis Oberwiesenthal im Süden
sowie von Jöhstadt im Osten bis Schwarzenberg im Westen“ 16 und befindet sich im Erzgebirgskreis
und damit in Sachsen. Diese Fläche hat einen Waldanteil von 43% und beträgt 27.000 ha, wovon
rund ein Drittel zum Privat- und Kommunalwald und zwei Drittel zum Landeswald, der untersucht
wird, gehören.17
Das Gebiet liegt in einem Mittelgebirge in Höhenlagen von 550 Metern (m) NN bis zum höchsten
Punkt, dem Fichtelberg mit 1214 m NN und 18 „[d]as Relief steigt von Norden nach Süden
kontinuierlich an“.19
Zum Großteil befindet es sich in der „[dynamischen Klimastufe] II (sehr frisch bis feucht & mäßig
kühl)“.20 Es ist dem Übergang vom atlantischen zum kontinentalen Klima zuzuordnen und befindet
sich in der gemäßigten Klimazone.21
10 Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (10.11.2015), S. 66.
11 Vgl. Sächsisches Land für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Abteilung Pflanzliche Erzeugung: „Klimawandel
in Sachsen“, in: Glückauf, 130. Jahrgang (10/2019), S. 55.
12 Vgl. Ebd.
13 Ebd.
14 Vgl. Weinrich, Matthias; Riedel, Johannes: „Vorbericht zur Forsteinrichtung des Landeswaldes im Forstbezirk
Neudorf zum 01.01.2019“, Staatsbetrieb Sachsenforst: Schwarzenberg, 16.03.2018, S. 10.
15 Vgl. Sächsisches Land für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Abteilung Pflanzliche Erzeugung (2019), S. 55.
16 URL: Staatsbetrieb Sachsenforst: „Forstbezirk Neudorf“ (01.01.2018), online unter URL
https://www.sbs.sachsen.de/neudorf-17325.html [Stand: 05.01.2020].
17 Vgl. Ebd.
18 Vgl. Weinrich, Matthias; Riedel, Johannes (16.03.2018), S.5.
19 Ebd.
20 Ebd.
21 Vgl. Mitteldeutscher Rundfunk: „Klimawandel ist in Sachsen angekommen“ (o. J.), online unter URL
https://www.mdr.de/sachsen/klimawandel-in-sachsen-angekommen-100.html [11.01.2020].
34 Bestandsaufnahme des Waldgebietes um 2009/2010
Im folgenden Kapitel wird das Gebiet unter den Aspekten Klima, Fläche, einschließlich Vegetation
und Gesundheit des Waldes untersucht. Da die Datenlage sehr dünn ist werden exemplarisch zwei
Jahre zusammengefasst untersucht.
4.1 Klima 2009/2010
Da die Messreihe der Waldklimastation im untersuchten Gebiet erst im Oktober 2009 begonnen hat,
es aber mehr Walddaten zum Jahr 2010 gibt, wird nun das Klima ab Oktober 2009 bis einschließlich
September 2010 untersucht. Die Klimastation befindet sich im Forstrevier Rittersgrün des
Forstbezirks Neudorf auf einer Höhe von 810 m über NN.
In diesem Zeitraum betrug die Niederschlagssumme 1259,8 Millimeter (mm). Der trockenste Monat
ist April mit 53,6 mm und der niederschlagsreichste August mit 282,4 mm.
Die Durchschnittstemperatur liegt bei rund 5,0 Grad Celsius (°C) und die Höchsttemperatur im Juli
erreicht 31,4 °C. Die Tiefsttemperatur wurde im Januar mit -7,5 °C gemessen. Somit beträgt die
Temperaturamplitude 38,9 Kelvin (K).
Es gibt milde Sommer (Juni bis September) und kalte Winter (Dezember bis März), die
kontinuierlich ineinander übergehen und eine starke Temperaturschwankung bilden. Winter und
Frühling sind niederschlagsarm, wogegen der Herbst sehr feucht ist.22
4.2 Fläche der Wälder 2009
Die forstliche Betriebsfläche beträgt am 01.01.2009 18.643 ha, wovon 17.950 Hektar (ha) zur
Holzbodenfläche (= Fläche zur dauerhaften Holzerwirtschaftung) und die verbleibenden 693 ha
zum Nichtholzboden gehören.23
Es gibt keine genauen Daten zur Baumartenzusammensetzung in 2009, doch anhand der im
Zeitraum von 2009 zu 2019 gepflanzten Verjüngungsbaumarten lässt darauf schließen, dass es 2009
der Anteil von Weißtannen und Rotbuchen im Wald kleiner als 2018 gewesen sein muss und der
Großteil des Waldes eine Fichtenmonokultur gewesen ist.24
22 Vgl. Staatsbetrieb Sachsenforst, Forstbezirk Neudorf: „Messdaten Waldklimastation Rittersgrün im Forstbezirk
Neudorf 2009 – 2019“.
23 Vgl. Weinrich, Matthias; Riedel, Johannes (16.03.2018), S.2.
24 Vgl. Weinrich, Matthias; Riedel, Johannes( 16.03.2018): S. 16.
44.3 Gesundheit der Wälder 2009
Anhand des Schadholzanteils lässt sich festmachen, wie resistent der Wald ist und wie stark sich
Witterungen auswirken.
Im Jahr 2009 wurden 106.552 Festmeter (fm = Holzvolumen in m³) Holz aus dem Wald entfernt. 27
Prozent (%) davon entsprechen durch Schneebruch zustande gekommenem Schadholz, was ein
Volumen von 29.249 fm ausmacht. Dafür gab es nur wenige Schäden durch Insekten oder Stürme.25
Das bedeutet, dass sich der kalte, schneereiche Winter großräumig auf den Waldbestand ausgewirkt
hat. Dennoch scheint der Wald sich davon erholt zu haben, da die Bäume trotzdem noch resistent
gegen die Ausbreitung von Parasiten gewesen sind.
5 Bestandsaufnahme des Waldgebietes 2018/2019 im Vergleich
Nun wird das Gebiet in den Jahren 2018 und 2019 unter den selben Aspekten wie in den Jahren
2009 und 2010 untersucht und verglichen. Die sich dabei herauskristallisierenden Unterschiede
bezüglich des Klimas, der Fläche, der Vegetation und der Gesundheit des Waldes werden
aufgezeigt. Aufgrund des mangelnden Bestands an Daten werden die Unterschiede mithilfe der
Daten von zwei Jahren dargestellt.
5.1 Klima 2018/2019
Laut der Waldklimastation im Forstgebiet Neudorf waren die niederschlagsreichsten Monate
zwischen Oktober 2018 und einschließlich September 2019 Dezember mit 176,5 mm, gefolgt von
Januar mit 151,8 mm. Damit liegen die Niederschlagssummen pro Monat deutlich unter denen von
2009/2010. Die mit Abstand trockensten Monate sind November mit einem Niederschlag von 19,9
mm und April mit 25,2 mm. Diese Monate sind deutlich trockener als der trockenste Monat im
untersuchten Zeitraum 2009/2010 mit 53,6 mm Niederschlag. Die Summe aller Niederschläge
beträgt 974,5 mm. Damit hat sich die Niederschlagsmenge um 285,3 mm verringert.
Der Juni ist der wärmste Monat und enthält auch das Temperaturmaximum des Jahres von 33,9 °C,
was das Maximum von 2009/2010 um 2,5 K übertrifft. Dagegen ist der Januar mit einer
Tiefsttemperatur von -10,7 °C der kälteste Monat des untersuchten Zeitraums und 3,2 K kälter als
der Januar 2010, was eine Temperaturschwankung von 44,6 K ergibt, welche mit einer Differenz
von 5,7 K deutlich größer ist als die von 2009/2010. Die Durchschnittstemperatur von Oktober
2018 bis September 2019 beträgt rund 7,5 °C, womit sie seit 2009/2010 um 2,5 K gestiegen ist.
25 Vgl. Weinrich, Matthias; Riedel, Johannes( 16.03.2018): S. 8.
5Es geht hervor, dass der Sommer mit geringen Niederschlägen sehr trocken war und nach dem, bis
auf den Februar (54,2 mm Niederschlag) feuchten Winter im Gegensatz zu 2010 ein abrupter
Übergang zum Frühjahr stattgefunden hat. Trotzdem variiert die Niederschlagsmenge von Monat zu
Monat stark, wogegen sie sich 2009/2010 kontinuierlicher veränderte und deutlich größer war. Die
Temperaturkurve verläuft kontinuierlich bis auf den abrupten Anstieg von Mai zu Juni (7,7°C zu
18,5 °C). Die Temperaturen zwischen dem kalten Winter und dem warmen Sommer schwanken
enorm und deutlich stärker als 2009/2010. Zudem sind 2018/2019 durchschnittlich viel wärmer und
erreichen höhere Temperaturen als 2009/2010.26
5.2 Fläche der Wälder 2019
Die forstliche Betriebsfläche im Forstbezirk beträgt zum 01.01.2019 18.628 ha und hat sich um 15
ha verkleinert im Vergleich zum Jahr 2009. Dafür ist die Nichtholzbodenfläche von 693 ha auf
746,3 ha gewachsen, womit sie nun einen größeren Anteil (4%) der Gesamtfläche ausmacht.
17881,8 ha zählen demnach zur Holzbodenfläche, die sich im Vergleich zu 2009 um ca. 70 ha
minimiert hat.
Wie bereits 2009 dominiert in der Baumartenzusammensetzung die gemeine Fichte mit einem
Anteil von 86% im Oberstand und einem kleineren Anteil von 65,7% im Unterstand. Den
nächstgrößeren Anteil bildet die Buche mit einer 3,8-prozentigen Einnahme des Oberbestands und
einem deutlich höheren Anteil von 19.4% im Unterstand, was darauf schließen lässt, dass die Buche
besonders als Verjüngungsbaumart eingesetzt wird. Weiterhin hat die Lärche mit 3,6% einen
beinahe so hohen Anteil im Oberbestand wie die Buche. Doch im Unterstand ist sie kaum zu finden
(0,2%).27
Anhand der meist genutzten Verjüngsbaumarten lässt sich seit ein Zuwachs von 2009 zu 2018 an
Weißtannen (239,4 ha) und Rotbuchen (421,3 ha) neben der gemeinen Fichte (404,6 ha) ablesen.28
Insgesamt kann man feststellen, dass sich die Waldfläche, insbesondere die Holzbodenfläche, seit
2009 verkleinert hat und dass sich die dominante Fichtenmonokultur immer mehr zu einem
Mischwald entwickelt.
26 Vgl. Staatsbetrieb Sachsenforst, Forstbezirk Neudorf: „Messdaten Waldklimastation Rittersgrün im Forstbezirk
Neudorf 2009 – 2019“.
27 Vgl. Staatsbetrieb Sachsenforst, Forstbezirk Neudorf: „Landeswald Forstbezirk Neudorf FoB 1513
Forstbetriebswerk Neudorf Einrichtungszeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2028“
28 Vgl. Weinrich, Matthias; Riedel, Johannes: „Vorbericht zur Forsteinrichtung des Landeswaldes im Forstbezirk
Neudorf zum 01.01.2019“, Staatsbetrieb Sachsenforst: Schwarzenberg, 16.03.2018, S. 16.
65.3 Gesundheit der Wälder 2019
Die Gesundheit des Waldes lässt sich anhand von Daten zum Einschlag und zum
Schadholzvorkommen des Forstbezirks Neudorf im Jahr 2019 erschließen. Mit Hilfe der Daten von
2009 kann man Veränderungen bestimmen.
Im Jahr 2019 gab es einen Holzeinschlag von 121.985 fm, was im etwa 15.000 fm mehr als im Jahr
2009 bedeutet. Wie im Jahr 2009 ist das meiste Schadholz durch Schneebruch zustande gekommen.
Allerdings ist der Anteil von 59% Schadholz durch Schneebruchschäden mehr als doppelt so hoch
als im Jahr 2009 (27%). Die zweithäufigste Ursache für einen Holzeinschlag mit 25% sind Stürme.
Vor zehn Jahren haben Sturmereignisse eine untergeordnete Rolle gespielt, wogegen sie 2019 ein
Viertel des Holzeinschlages ausmachen. Des Weiteren führen Schäden durch Borkenkäfer zu rund
17.000 fm Schadholz, was einem Anteil des Gesamtholzeinschlages von 14% entspricht. Auch
dieser Schadfaktor war im Jahr 2009 nahezu irrelevant. Die verbleibenden 2% des Holzeinschlages
sind sonstigen Ursachen zuzuordnen.
Ein drastischer Unterschied zu 2009 zeigt sich darin, dass damals nur im etwa ein Viertel des
Holzeinschlags Schadholz zuzuweisen war, wogegen im Jahr 2019, bis auf einen Anteil von 2%,
das Holz ausschließlich aufgrund von Schäden aus dem Wald geschafft wurde.29
Durch die Zunahme von Schäden lässt sich schließen, dass die Gesundheit des Waldes durch
Wetterereignisse wie Stürme oder Schneebruch, aber auch durch Parasiten wie den Borkenkäfer
stark gefährdet ist.
6 Mögliche Zusammenhänge mit dem Klima
Die in den vorherigen Kapiteln aufgelisteten Daten zum Wald und zum Klima werden nun
verknüpft und in einen möglichen Zusammenhang gestellt. Dabei werden die drei Klimaaspekte
kalte niederschlagsreiche Winter; abrupter Übergang vom Winter zum Frühjahr und heiße, trockene
Sommer in Betracht gezogen und je in den Zusammenhang zur Gesundheit und damit zur Fläche
des Waldes gestellt.
6.1 Kalte, niederschlagsreiche Winter
Die Wahrscheinlichkeit für Starkniederschläge steigt an, weil das Wasser schneller verdunstet und
sich die Wasserdampfkapazität in der Luft erhöht.
Das Schneebruchrisiko wird durch Kaltlufteinbrüche, die durch verlängerte Vegetationsperioden
29 Vgl. Siehe Anhang: „8.3 Email vom Leiter des Staatsforstbetriebs im Forstbezirk Neudorf“.
7entstehen, verstärkt. Intensive Niederschlagsereignisse unter dem Gefrierpunkt führen zu einer
enormen Schneemasse, welcher Bäume nicht standhalten können und brechen.30
Folgen von Schneebruchereignissen sind die Begünstigung für einen Insekten- oder Pilzbefall am
Baum und31 „Zuwachsverluste am verbleibenden Bestand“32.
Der Forstbezirk Neudorf ist definitiv von Schneebruchereignissen betroffen, da diese über die
Hälfte (59%) des Holzeinschlags ausmachen 33 und damit als größte Bedrohung angesehen werden
kann.
6.2 Abrupter Übergang von Winter zu Frühjahr
Der Übergang von Winter zu Frühjahr verlief in den vergangenen Jahren unter extremer
Trockenheit und sommerlicher Wärme.
Deswegen können neu gepflanzte Bäume nicht genug im Boden fest gebundenes Wasser
aufnehmen, was dazu führt, dass junge Bäume mit kurzen Wurzeln nicht an genug Bodenwasser
kommen und schneller eingehen können. Das bedeutet wiederum, dass zur Verjüngung und
Mischwalderstellung eingesetzte Neubepflanzungen am Gedeihen gehindert werden. 34 Da auch die
älteren Bäume nun weniger Wasser aufnehmen können, sind sie geschwächt und damit anfälliger
für Parasiten. Weil im Winter das erhöhte Schneebruchrisiko den Waldbestand gefährdet und die
Vegetationsperiode ihre Aufgabe, das Wachsen zu bestärken, nicht mehr erfüllen kann, schrumpft
der Wald möglicherweise oder wird lichter.
6.3 Heiße, trockene Sommer
„Der Temperaturanstieg, die Verlängerung der Vegetationszeit und abnehmende
Sommerniederschläge können zu häufigeren und längeren Dürreperioden führen.“35
Bei zu wenig Feuchtigkeit gelingt es den Fichten nicht, genug Harz zu produzieren, wodurch
Parasiten herausgeschwemmt würden. So können sich durch Trockenheit geschwächte Fichten nicht
mehr vor dem Befall von hiesigen Borkenkäfern wie dem Kupferstecher oder dem Buchdrucker
30 Vgl. Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft: „Klimawandel in Sachsen – wir passen uns
an!“, SDV Direct World GmbH, 10.11.2015, S. 65.
31 Vgl. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft; Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
nukleare Sicherheit: „Dufteis und Schneebruch – Wenn Eis und Schnee die Äste biegen“ (09.12.2019), online unter
URL https://www.waldwissen.net/waldwirtschaft/schaden/sturm_schnee_eis/fva_schneebruch_w4/index_DE
[11.01.2020].
32 Ebd.
33 Vgl. Siehe Anhang: „8.3 Email vom Leiter des Staatsforstbetriebs Neudorf“.
34 Vgl. Weinrich, Matthias; Riedel, Johannes: „Vorbericht zur Forsteinrichtung des Landeswaldes im Forstbezirk
Neudorf zum 01.01.2019“, Staatsbetrieb Sachsenforst: Schwarzenberg, 16.03.2018, S. 11.
35 Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (10.11.2015), S. 66.
8schützen. Ebenso dienen zum Beispiel durch Stürme oder Schneebruch gefallene Fichten als
Brutplatz für Kupferstecher oder Buchdrucker.36 Die Larven uns Jungkäfer ernähren sich vom Bast,
wobei sie existenzielle Leitungsbahnen durchtrennen, welche normalerweise die Baumwurzel mit
Nahrung versorgen, die in den Nadeln hergestellt wird. Zudem gelangt bei extremem Befall auch
von den Wurzeln kein Wasser mehr bis in die Baumspitzen, sodass diese absterben.37
Ein Temperaturanstieg fördert diese Parasitenverbreitung, weil der Borkenkäfer nun weniger
Entwicklungszeit, die temperaturabhängig zwischen 6 und 22 Wochen liegt, vom Ei bis zum
ausgebildeten Käfer benötigt. Bei einem früheren Eintreffen des Sommers und höherer
Durchschnittstemperatur können sich mehr Generationen an Borkenkäfern ausbilden, von denen
eine 40 Nachkommen umfasst, was bedeutet, dass nach drei Generationen bei nur einem
Ausgangsweibchen bereits 64 000 Nachkommen existieren. 38 Vor allem in Fichtenwäldern sorgen
der Kupferstecher und der Buchdrucker für ein Vernichten großer Baumbestände.39
Damit lässt sich erklären, warum sich der Borkenkäfer auch im Forstbezirk Neudorf verbreitet und
14% des Holzanteils ausmacht.40
7 Schutzmöglichkeiten der Wälder
Der Wald verschwindet nicht sofort durch die Klimaveränderung, aber er passt sich
natürlicherweise neu an.41 Dieses Vorgehen wird durch nachhaltige und ökologische Forstwirtschaft
unterstützt, welche die Anpassung des Waldes an das Klima beschleunigt.42
7.1 Unterdrückung der Verbreitung des Borkenkäfers
Erkennungsmerkmale für einen Borkenkäferbefall, von Buchdrucker oder Kupfersetcher, sind aus
den Bäumen rieselndes Bohrmehl, rote Nadeln und eine aufgeplatzte Rinde.43
Befallene Bäume müssen sofort gestürzt werden, bevor der Käfer wieder ausfliegt und aus dem
36 Vgl. Pollmeier, Ralf: „Unbeliebte Promis - Borkenkäfer im deutschen Fichtenwald“ (o.J.), online unter URL:
https://www.waldhilfe.de/borkenkaefer-im-deutschen-fichtenwald/ [Stand: 05.01.2020].
37 Vgl. Steinfath, Martin: „Kleines Einmaleins des Borkenkäfers“ (27.03.2019 ), online unter URL
https://www.forstpraxis.de/kleines-einmaleins-des-borkenkaefers/ [Stand: 19.01.2020].
38 Vgl. Tomiczek, C.; Pfister, A.: „Was bedeutet der Klimawandel für die Borkenkäfer? BFW-Praxisinformation“ ,
2008, S. 17; 23.
39 Vgl. URL: Bayrisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: „Verursacher verheerender
Waldschäden: Bokenkäfer – Buchdrucker und Kupferstecher“ (o.J.),
http://www.stmelf.bayern.de/wald/waldschutz/borkenkaefer/ [11.01.2020].
40 Vgl. Siehe Anhang: „8.3 Email vom Leiter des Staatsforstbetriebs Neudorf“.
41 Vgl. Siehe Anhang: „8.2 Interview mit Kay Meister“.
42 Vgl. Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft: „Klimawandel in Sachsen – wir passen uns
an!“, SDV Direct World GmbH, 10.11.2015, S. 68.
43 Vgl. Steinfath, Martin: „Kleines Einmaleins des Borkenkäfers“ (27.03.2019 ), online unter URL
https://www.forstpraxis.de/kleines-einmaleins-des-borkenkaefers/ [Stand: 19.01.2020].
9Wald heraustransportiert werden. Bei dem Befall des Kupferstechers müssen die beschädigten
Baumspitzen präventiv verbrannt oder zerhäckselt werden.44 Zudem sollten aber auch durch Sturm
oder Schneebruch gefallene Bäume aus dem Wald entsorgt werden, da diese sonst als Brutstätte für
Borkenkäfer dienen würden.45 Eine andere Maßnahme ist, den ausschwärmenden Borkenkäfer im
Frühjahr durch Pflanzenschutzmittel zu bekämpfen.46
Die Eindämmung der Verbreitung geschieht größtenteils also aus menschlicher Hand, da der Wald
zu geschwächt ist, um sich selbst gegen diese Bedrohung zu behaupten.
7.2 Mischwälder
Wenn ein Wald aus mindestens zwei Baumarten zusammengesetzt ist und beide dessen Ökologie
beeinflussen, spricht man von einem Mischwald.47
Mischwälder haben hingegen zur Fichtenmonokultur, die den erzgebirgischen Wald dominiert 48, den
Vorteil, dass sie eine größere Biodiversität aufweisen, weswegen sie sich durch eine 49 „bessere
Bodendurchwurzlung und eine höhere Bestandessicherheit gegenüber Schädlingen und Schäden
durch Sturm [...], Schnee […] oder Feuer [...] aus[zeichnen.]“ 50 Somit sind Mischwälder beständiger
gegen Sturmereignisse oder immense Schneevorkommnisse, die das Stürzen der Bäume bezwingt
und auch gegen die Trockenheit, welche die Bäume schwächt und die Ausbreitung der Borkenkäfer
begünstigt.51
Deshalb ist „die Erziehung von stabilen, horizontal und vertikal strukturierten Mischbeständen […]
unter Führung der Fichte sowie der Etablierung von zielzustandsanhängigen
Mischbaumartenanteilen von Weißtanne und Rotbuche“ 52 ein wichtiges Betriebsziel im Forstgebiet
Neudorf. Darum wird als Verjüngungsbaumart zur Förderung des Waldumbaus bis hin zu einem
mehr vielfältigeren Wald besonders die Rotbuche genutzt, die 2017 bereits auf 421,3 ha neu
44 Vgl. URL: Bayrisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: „Verursacher verheerender
Waldschäden: Bokenkäfer – Buchdrucker und Kupferstecher“ (o.J.),
http://www.stmelf.bayern.de/wald/waldschutz/borkenkaefer/ [11.01.2020].
45 Vgl. Pollmeier, Ralf: „Unbeliebte Promis - Borkenkäfer im deutschen Fichtenwald“ (o.J.), online unter URL:
https://www.waldhilfe.de/borkenkaefer-im-deutschen-fichtenwald/ [Stand: 05.01.2020].
46 Vgl. Steinfath, Martin: „Kleines Einmaleins des Borkenkäfers“ (27.03.2019 ), online unter URL
https://www.forstpraxis.de/kleines-einmaleins-des-borkenkaefers/ [Stand: 19.01.2020].
47 Vgl. Lingenhöhl, Dr. Daniel und Müller, Dr. Andreas: „Lexikon der Biologie: Mischwald“ (o.J.)
https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/mischwald/43242 [Stand: 05.01.2020].
48 Vgl. Staatsbetrieb Sachsenforst: „Forstbezirk Neudorf: Daten zum Wald“ (01.01.2019), online unter URL
https://www.sbs.sachsen.de/daten-zum-wald-17364.html [Stand: 18.11.2019].
49 Vgl. Lingenhöhl, Dr. Daniel und Müller, Dr. Andreas: „Lexikon der Biologie: Mischwald“ (o.J.)
https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/mischwald/43242 [Stand: 05.01.2020].
50 Ebd.
51 Vgl. Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft: „Klimawandel in Sachsen – wir passen uns
an!“, SDV Direct World GmbH, 10.11.2015, S. 68.
52 Weinrich, Matthias und Riedel, Johannes: „Vorbericht zur Forsteinrichtung des Landeswaldes im Forstbezirk
Neudorf zum 01.01.2019“, Staatsbetrieb Sachsenforst: Schwarzenberg, 16.03.2018, S. 27.
10gepflanzt wurde und deren erntereife Exemplare dem natürlichen Verfall überlassen werden. Ebenso
wird die Weißtanne mit 239,4 ha Neubepflanzung im Jahr 2017 verwendet, da diese unter den
hiesigen Umständen sehr gut wächst. Weitere, weniger relevantere Waldumbaubaumarten sind der
Bergahorn, Bergulmen, Douglasien, Lärchen und Roterlen neben der gemeinen Fichte.53
Mischwälder sind demnach eine angestrebte Alternative zur Monokultur, weil sie sich als viel
resistenter erweisen.
7.3 Natürliche Anpassung
Sobald sich die Standortbedingungen verändern, gibt es darauf zwei wesentliche
Anpassungsreaktionen des Waldes.
Zum einen die sogenannte Sukzession, welche das Einwandern für den Standort neuer, resistenter
und angepasster Baumarten beschreibt. Dies geschieht durch die Einführung neuer Samen, die
durch den Wind oder durch Tiere transportiert werden. Das funktioniert jedoch nur, wenn sich die
Pflanzen gegen ihre Konkurrenten behaupten können und sich noch weiter verbreiten.54 Im
Forstgebiet Neudorf ist noch nicht festzustellen, dass sich neue Baumarten natürlicherweise in das
Ökosystem eingegliedert haben.55
Die zweite Anpassungsart nennt sich Evolution und definiert sich durch56 „die Selektion besonders
angepasster Exemplare einer Baumpopulation.“57 Das bedeutet, dass Bäume, die besonders
angepasst und gesund sind, diese Eigenschaften an die nächste Generation weitergeben und damit
die anderen Individuen der selben Art übertrumpfen.58
Die natürliche Anpassung verläuft länger und unscheinbarer als die künstliche und lässt sich
deshalb nicht mit konkreten Daten nachweisen.
8 Fazit
Es kristallisiert sich heraus, dass der globale Klimawandel auch im Forstbezirk Neudorf seine
Spuren am erzgebirgischen Wald hinterlässt. Im Vergleich zu 2009 nehmen aufgrund des
53 Vgl. Weinrich, Matthias und Riedel, Johannes (2018), S. 15.
54 Vgl. Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft: „Klimawandel in Sachsen – wir passen uns
an!“, SDV Direct World GmbH, 10.11.2015, S. 60.
55 Vgl. Weinrich, Matthias und Riedel, Johannes: „Vorbericht zur Forsteinrichtung des Landeswaldes im Forstbezirk
Neudorf zum 01.01.2019“, Staatsbetrieb Sachsenforst: Schwarzenberg, 16.03.2018, S. 17.
56 Vgl. Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft: „Klimawandel in Sachsen – wir passen uns
an!“, SDV Direct World GmbH, 10.11.2015, S. 60.
57 Ebd.
58 Vgl. Ebd., S. 60 - 61.
11Klimawandels Wetterextreme zu, weswegen im Winter Schneebruchgefahr herrscht und sich
Sturmschäden häufen. Die vom Klimawandel bedingte Temperaturerhöhung bringt Trockenheit und
Hitze im Sommer hervor, wodurch die Verbreitung von Parasiten wie dem Borkenkäfer begünstigt
wird. Doch der Wald passt sich natürlicherweise an diese Klimaveränderung an, was gefördert wird
durch nachhaltige Forstwirtschaft. Neben dem Entfernen des Schadholzes aus dem Wald bewährt
sich die resistente Waldstruktur des Mischwaldes als eine gute Anpassungsstrategie. Allerdings ist
es noch ein langer Prozess, bis der Wald gegen diese klimabedingten Störungen vollständig
angepasst ist. Da sich zeigt, dass sich der Wald rapide verkleinert und die Borkenkäferverbreitung,
welche eine enorme Gefahr für den Waldbestand ist, nur durch menschliches Eingreifen gehemmt
werden kann, sollte die Forstwirtschaft weiterhin den Wald schützen und dabei aufgrund der
Zunahme an Schadpotential mehr gefördert werden. Abgesehen vom Entfernen der enormen Masse
an Schadholz sollten auch trockenheitsresistente und wärmeliebende Bäume gepflanzt werden und
das Waldumbauprogramm zum Mischwald weiterhin durchgeführt werden. Für diese aufwendigen
Prozesse sollte der Staatsforst mehr gefördert werden.
Die Deutungshypothese, dass sich der Klimawandel beispielsweise durch die
Borkenkäferverbreitung am erzgebirgischen Wald zeigt, wird durch die aufgezeigten
Zusammenhänge unterstützt, konnte aber nicht endgültig vollkommen bewiesen werden.
Zu Beginn des Schreibens bezog sich das Thema noch auf das gesamte Erzgebirge und umfasste
mehr Auswirkungen. Aufgrund eines Verbesserungsvorschlags des Leiters vom Staatsforstbetrieb
Neudorf, Herrn Riedel, wurde das Thema nun räumlich auf den Forstbezirk Neudorf beschränkt,
weil es für das gesamte Erzgebirge sehr schwierig wäre, einheitliche Daten zusammenzusuchen.
Auch der untersuchte Zeitraum veränderte sich im Schreibprozess, weil die Daten der
Waldklimastation erst ab Oktober 2009 aufgezeichnet wurden und die Aufzeichnungen zum Wald
zwar im Januar 2009 begannen, aber manche Aspekte des Jahres 2010 nicht umfassen.
9. Literaturverzeichnis
Bayrisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: „Verursacher verheerender
Waldschäden: Bokenkäfer – Buchdrucker und Kupferstecher“ (o.J.), online unter URL
http://www.stmelf.bayern.de/wald/waldschutz/borkenkaefer/ [Stand: 11.01.2020].
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft; Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
nukleare Sicherheit: „Dufteis und Schneebruch – Wenn Eis und Schnee die Äste biegen“ (09.12.2019),
online unter URL
https://www.waldwissen.net/waldwirtschaft/schaden/sturm_schnee_eis/fva_schneebruch_w4/index_DE
[11.01.2020].
12Fuchs, Manuel: „Globalisierung Fakten“ (o. J.), online unter URL https://www.globalisierung-
fakten.de/klimawandel/definition/ [Stand: 15.11.2019].
Günther, Prof. Dr. Edeltraud: „Klimawandel: Definition“ (14.02.2018), online unter URL
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/klimawandel-52424 [Stand: 18.11.2019].
Klaßen, Dipl.-Met. Dr. Joachim: „Omegawetterlage – Wetterlexikon“ (0.J.),
https://www.wetteronline.de/wetterlexikon?topic=omegawetterlage [01.02.2020].
Lingenhöhl, Dr. Daniel und Müller, Dr. Andreas: „Lexikon der Biologie: Mischwald“ (o.J.)
https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/mischwald/43242 [Stand: 05.01.2020].
Mitteldeutscher Rundfunk: „Klimawandel ist in Sachsen angekommen“ (o.J.), online unter URL
https://www.mdr.de/sachsen/klimawandel-in-sachsen-angekommen-100.html [Stand: 11.01.2020].
Paeger, Jürgen: „Die Folgen des Klimawandels“ (o. J.), online unter URL http://www.oekosystem-
erde.de/html/klimawandel-03.html [Stand: 12.01.2020].
Pollmeier, Ralf: „Unbeliebte Promis - Borkenkäfer im deutschen Fichtenwald“ (o.J.), online unter URL:
https://www.waldhilfe.de/borkenkaefer-im-deutschen-fichtenwald/ [Stand: 05.01.2020].
Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft: „Klimawandel in Sachsen – wir passen uns
an!“, SDV Direct World GmbH, 10.11.2015, S. 8; 60; 61; 65; 66.
Sächsisches Land für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Abteilung Pflanzliche Erzeugung:
„Klimawandel in Sachsen“, in: Glückauf, 130. Jahrgang (10/2019), S. 55.
Staatsbetrieb Sachsenforst: „Forstbezirk Neudorf“ (01.01.2018), online unter URL
https://www.sbs.sachsen.de/neudorf-17325.html [Stand: 05.01.2020].
Staatsbetrieb Sachsenforst: „Forstbezirk Neudorf: Daten zum Wald“ (01.01.2019), online unter URL
https://www.sbs.sachsen.de/daten-zum-wald-17364.html [Stand: 18.11.2019].
Staatsbetrieb Sachsenforst, Forstbezirk Neudorf: „Landeswald Forstbezirk Neudorf FoB 1513
Forstbetriebswerk Neudorf Einrichtungszeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2028“
Staatsbetrieb Sachsenforst, Forstbezirk Neudorf: „Messdaten Waldklimastation Rittersgrün im Forstbezirk
Neudorf 2009 – 2019“.
Steinfath, Martin: „Kleines Einmaleins des Borkenkäfers“ (27.03.2019 ), online unter URL
https://www.forstpraxis.de/kleines-einmaleins-des-borkenkaefers/ [Stand: 19.01.2020].
Tomiczek, C.; Pfister, A.: „Was bedeutet der Klimawandel für die Borkenkäfer? BFW-
Praxisinformation“, 2008, S. 17 und 23.
13Umweltbundesamt: „Klimawandel“ (23.02.2016), online unter URL
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimawandel [Stand: 11.01.2020].
Umweltbundesamt: „Klimawandel und Treibhauseffekt“ (01.09.2014), online unter URL
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimawandel/klima-treibhauseffekt#textpart-1
[Stand: 11.01.2020].
Umweltbundesamt: „Was ist eigentlich Klima?“ (01.08.2013 ), online unter URL
https://www.umweltbundesamt.de/service/uba-fragen/was-ist-eigentlich-klima.
Weinrich, Matthias und Riedel, Johannes: „Vorbericht zur Forsteinrichtung des Landeswaldes im Forstbezirk
Neudorf zum 01.01.2019“, Staatsbetrieb Sachsenforst: Schwarzenberg, 16.03.2018.
1415
Sie können auch lesen