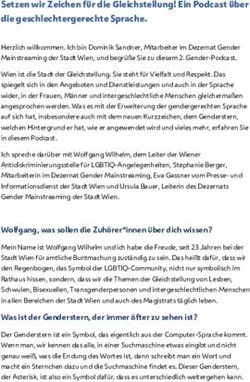Die Geschlechter-Dimension der Nachhaltigkeitspolitiken und ihre Evaluation1
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Die Geschlechter-Dimension der Nachhaltigkeitspolitiken
und ihre Evaluation1
(Online) Workshop
Donnerstag, 14.10.2021 13.15-17.15h
Das Schlagwort Nachhaltigkeit ist inzwischen in (fast) aller Munde, nicht zuletzt wegen der
2015 in Paris von der UN verabschiedeten Sustainable Development Goals
(https://www.un.org/sustainabledevelopment/ ). Seither ist die Politik verstärkt
aufgefordert, sich an den 17 Leitzielen zu orientieren. Die meisten dieser Ziele sind
unmittelbar mit geschlechter- und gleichstellungpolitischen Themen verknüpft. Um die
zentralen zu nennen: allen voran Ziel 5 „Geschlechtergleichstellung“ sowie Ziel 8
„Menschwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum“ wie auch Ziel 4 „Hochwertige Bildung“,
„Kein Hunger“ und „Keine Armut“ (Ziele 1 und 2) und Ziel 10 „Weniger Ungleichheiten“. Trotz
vieler politischer Proklamationen schreiten die Implementierung und ihre Evaluierung dieser
Ziele aber höchst langsam voran. Dies gilt auch für ihre geschlechterpolitische Dimension, die
- nimmt man die SDGs ernst – unabdingbar zu berücksichtigen ist, wenn es um die
Realisierung nachhaltiger Politiken geht; noch einmal mehr aufgrund der sozio-ökonomischen
Folgen der Corona-Pandemie.
Der Workshop befasst sich mit den Fragen, wie es um die Implementierung und Evaluierung
der geschlechterpolitischen Dimension der Nachhaltigkeitspolitik bestellt ist. Die
Vortragenden aus Deutschland und Österreich thematisieren – nicht nur bezogen auf diese
Länder – inwiefern und wie Geschlechterpolitik und Nachhaltigkeitspolitik verknüpft werden;
aber auch warum sie vielfach separiert werden.
Anmeldung unter: zukuenfte.der.nachhaltigkeit@uni-hamburg.de , damit der Zoom-link für
die Teilnahme verschickt werden kann.
1
Organisation und Konzeption: Beate Littig, Fellow der DFG-Kolleg-Forschungsgruppe "Zukünfte der
Nachhaltigkeit", Hamburg sowie am Institut für Höhere Studien, WienProgramm
13.15-13.30 Sighard Neckel (Leitung Kolleg, Hamburg): Begrüßung
13.30-13.45 Beate Littig (Fellow Hamburg/Wien): Begrüßung und Einführung
13.45-14.15 Christine Bauhardt (HU Berlin): Nachhaltigkeit – was heißt das aus
feministischer Perspektive? Die Beispiele Verkehr und Ernährung
14.15-14.45 Thomas Barth (LMU München) und Beate Littig: Nachhaltige Arbeit – auch für
Frauen?
14.45-15.00 Pause
15.00-15.30 Angela Wroblewski (IHS Wien): Evaluation der Genderdimension im Kontext
der SDGs: zwischen Datenverfügbarkeit und politischer Ambition
15.30-16.00 Brigitte Ratzer (TU Wien): Politikberatung der österreichischen
Bundesregierung und SDG 5
16.00-16.15 Pause
16.15-16.45 Arn Sauer (UBA Berlin): Ambitionierter Klimaschutz braucht
Genderperspektiven. Neue Perspektiven in Folgeabschätzungen in Klimaschutz
und Klimaanpassung
16.45-17.15 Resümee und Abschlussdiskussion
Moderation: Irina Zielinska (IHS Wien)
Abstracts und Kurz-Bios
Bauhardt, Christine:
Nachhaltigkeit – was heißt das aus feministischer Perspektive? Die Beispiele Verkehr und
Ernährung
Abstract
Das Plastikwort „Nachhaltigkeit“ soll mit dem feministischen Konzept von Sustainable
livelihoods konfrontiert werden, um nochmals auf den kritischen Impetus der Debatte zurück
zu kommen. Sustainable livelihoods betonen die Bedeutung lokaler Machtverhältnisse und
die Notwendigkeit dezentraler Entscheidungsfindung. Die Beispiele der Verkehrspolitik, die
nach wie vor weitgehend immun ist gegen feministische Einsprüche und der Ernährung, wo
sich globale Bewegungen für mehr lokale Politiken unter Berücksichtigung feministischerErkenntnisse stark machen, werden die Implementationsprobleme von Nachhaltigkeitspolitiken beleuchten. Bio Christine Bauhardt, Leiterin des Fachgebiets Gender und Globalisierung an der Humboldt- Universität zu Berlin. Politikwissenschaftlerin und Raumplanerin mit Arbeitsschwerpunkten in feministischer Ökonomiekritik, Postwachstum und Gender, globale Umwelt- und Nachhaltigkeitsdebatten, Infrastrukturpolitiken. Thomas Barth und Beate Littig: Nachhaltige Arbeit – auch für Frauen? Abstract In Bezug auf den Klimawandel, als derzeit prominentestem Ausdruck der Krise gesellschaftlicher Naturverhältnisse, werden vor allem zwei unterschiedliche Ansätze zur Transformation der Arbeitsgesellschaften diskutiert: die Schaffung von grünen Ökonomien und Vollerwerbsgesellschaften einerseits und von sozial-ökologisch nachhaltigen Postwachstumsgesellschaften andererseits. Letztere basieren auf einem erweiterten Arbeitsbegriff, der nicht nur Erwerbsarbeit, sondern auch Care, Eigenarbeit und zivilgesellschaftliches Engagement umfasst, der Neubewertung und Umverteilung von Arbeit, auch zwischen den Geschlechtern. Als Voraussetzungen dafür werden unter anderem eine neue Vollerwerbsarbeitszeit (20-30 Stunden) für alle sowie eine sozial-ökologische Steuerreform angeführt. Was diese Konzepte für Frauen bedeuten, wird zumeist eher am Rande diskutiert. In der grünen Ökonomie geht es aus geschlechterpolitischer Sicht vor allem darum, Frauen die Teilhabe an den guten, grünen Arbeitsplätzen insbesondere im technologischen Bereich überhaupt zu ermöglichen (z.B. durch Ausbildung, Kinderbetreuung etc.). Auch in Postwachstumsgesellschaften wird sich eine gerechte Aufteilung der Care- Arbeit sowie der Erwerbsarbeit nicht automatisch einstellen. Sie muss systematisch gefördert werden. Der Beitrag reflektiert diese Konzepte aus geschlechterpolitischer Sicht und vor dem Hintergrund der gegenwärtigen multiplen Krise, die im Zuge der Corona-Pandemie noch schärfer hervortritt. Bios Thomas Barth ist akademischer Rat auf Zeit am Institut für Soziologie der Ludwig-Maximilians- Universität München. Seine Arbeitsschwerpunkte in Forschung und Lehre liegen in den Bereichen Arbeit und Nachhaltigkeit, Politische Ökologie und Soziologie sowie Demokratie und Kapitalismus.
Beate Littig ist habilitierte Soziologin und Fellow am Institut für Höhere Studien (IHS) in Wien sowie bei der DFG-Kolleg-Forschungsgruppe "Zukünfte der Nachhaltigkeit", Hamburg. Ihre langjährigen Arbeitsschwerpunkte sind sozial-ökologische Transformationsforschung, nachhaltige Entwicklung und Arbeit(sgesellschaften), nachhaltige Praktiken und qualitative Forschungsmethoden. Ratzer, Brigitte: Politikberatung der österreichischen Bundesregierung und SDG 5 Abstract Im Großprojekt „UniNEtZ“ (Universitäten und Nachhaltige EntwicklungsZiele) haben sich 16 österreichische Universitäten zusammengeschlossen, um einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung in Österreich zu leisten. Das Projekt soll Optionen identifizieren, entwickeln und evaluieren, wie Österreich der Verpflichtung der Umsetzung der UN Agenda 2030 nachkommen kann. Optionen sind dabei Bündel konkreter Maßnahmen, die auf aktuellen, interdisziplinär erarbeiteten wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen. Dabei wird die Agenda 2030 als Wegbeschreibung für die Transformation im Sinne der Nachhaltigkeitsziele in den Grenzen des Systems Erde verstanden. Ein umfassender Optionenbericht wird im Dezember 2021 an die österreichische Bundesregierung übergeben. Der Vortrag geht auf die Zielsetzungen des SDG 5, aber auch das Thema „Gender als Querschnittsmaterie“ ein und diskutiert die Optionen im Spannungsfeld zwischen schrittweiser „Modernisierung“ und radikaler Transformation. Bio Brigitte Ratzer, Leiterin Abteilung Genderkompetenz an der TU Wien. Studium der Technischen Chemie, Promotion im Fach Wissenschaftssoziologie. Aktuell u.a. Koordinatorin des H2020 Projektes „GEECCO – Gender Equality in Engineering through Communication and Commitment“ und des SDG 5 im Projekt UniNeTZ – Universitäten und Nachhaltige Entwicklungsziele. Sauer, Arn Ambitionierter Klimaschutz braucht Genderperspektiven. Neue Perspektiven in Folgeabschätzungen in Klimaschutz und Klimaanpassung Abstract Die zunehmende Bedeutung von Geschlechterperspektiven für eine wirksamere Klimapolitik ist im Pariser Klimaschutzabkommen und dessen Gender Action Plan abgebildet. Um diese Beschlüsse auf nationaler Ebene umzusetzen, hat das UBA 2016-2019 ein Forschungsprojekt
zu interdependenten Genderaspekten im Klimaschutz in Auftrag gegeben. Seit 2020 liegt der Abschlussbericht vor, in dem u.a. Genderdimensionen zur Untersuchung der strukturell ungleichen Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern sowie ihrer Ausprägungen in verschiedenen Lebensbereichen aus klimarelevanter Forschung abgeleitet wurden. Mit Hilfe der Genderdimensionen können potenzielle Wirkungen von Maßnahmen auf die Geschlechterverhältnisse identifiziert und klimapolitische Handlungsmöglichkeiten justiert werden. Sie sind als analytische Kategorien in die Weiterentwicklung der gleichstellungsorientierten Folgenabschätzung (Gender Impact Assessment - GIA) eingeflossen. Das GIA-Instrument wurde auf Klimaanpassung und- schutz zugeschnitten sowie um einen intersektionalen Gender+ Ansatz erweitert. In dem Vortrag stellt Arn Sauer die klima-/praxisorientierte GIA-Arbeitshilfe vor und gibt Einblick in die Ergebnisse der Testings. Zur Diskussion steht, inwiefern die neue GIA Arbeitshilfe dazu beitragen kann, intersektionale Genderperspektiven stärker im Klimaschutz zu verankern, um diesen ambitionierter, zielgruppenspezifischer und effektiver auszurichten. Bio Dr. phil. Arn Sauer arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter für Gender Mainstreaming bei der Gleichstellungsbeauftragten des UBA. Er hat zu Instrumenten der gleichstellungsorientierten Folgenabschätzung am Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien an der Humboldt-Universität zu Berlin promoviert. Wroblewski, Angela: Evaluation der Genderdimension im Kontext der SDGs: zwischen Datenverfügbarkeit und politischer Ambition Abstract Die Berücksichtigung der Geschlechter-Dimension im Kontext von Evaluationen ist generell durch das Spannungsfeld zwischen theoretischem bzw. politischem Anspruch und Datenverfügbarkeit geprägt. Auch wenn in der Konzeption von Politiken auf ein intersektionales oder non-binary Verständnis von Geschlecht abgestellt wird, wird in verfügbaren Datengrundlagen häufig nur zwischen Frauen und Männern unterschieden. Vor allem wenn es darum geht, geschlechterbezogene Wirkungen zu erfassen, wird auf ein dichotomes Verständnis von Geschlecht abgestellt. Da Wirkungsindikatoren häufig auch als Steuerungsinstrumente herangezogen werden, wirkt sich dies auch auf die Umsetzung von Politiken aus. Der Beitrag beschreibt das Spannungsfeld anhand konkreter Beispiele und plädiert für eine verstärke Evaluation der Wirkungsmechanismen anstelle der Wirkungen, um die Geschlechter-Dimension adäquat abbilden zu können und aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten.
Bio Dr.in Angela Wroblewski ist Senior Researcher am Institut für höhere Studien, Wien. Ihr Arbeitsschwerpunkt ist die Evaluation von Gleichstellungspolitiken in Wissenschaft und Forschung auf institutioneller und nationaler Ebene wie auch im internationalen Vergleich. In diesem Kontext setzt sie sich mit der Entwicklung von Indikatoren und der Nutzung von Indikatoren als Steuerungsinstrument von Gleichstellungspolitik auseinander.
Sie können auch lesen