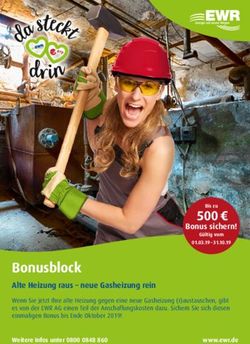Die neue Missbrauchsaufsicht im GWB aus Unternehmenssicht - Aufbruch in Zeiten erheblicher Rechtsunsicherheit - November 2020 Dr. Romina Polley
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Die neue Missbrauchsaufsicht im GWB aus Unternehmenssicht – Aufbruch in Zeiten erheblicher Rechtsunsicherheit 26. November 2020 Dr. Romina Polley clearygottlieb.com
Ausweitung der Normadressatenstellung (I)
Persönlicher Anwendungsbereich der überragenden marktübergreifenden Bedeutung (§ 19a)
ist nicht klar:
• Begründung RegE spricht von großen Digitalkonzernen und einem kleinen Kreis von Unternehmen.
• Wortlaut des § 19a spricht nicht von großen digitalen Plattformen, sondern von erheblicher Tätigkeit auf
mehrseitigen Märkten i.S.v. § 18 3a.
• Keine „Superdominanz“, weil nicht einmal Feststellung von Marktbeherrschung auf einem Markt notwendig
(„insbesondere“ in § 19a Abs. 1 S.1).
• Kriterien des § 19a Abs. 1 sehr allgemein, unterscheiden sich nicht von Marktbeherrschungskriterien des § 18.
• Abweichung vom „Gatekeeper“-Ansatz der Kommission im Digital Markets Act mit spezifischen Diensten.
• Vorherige Feststellung der Normadressatenstellung durch Verfügung des Amtes hilft nicht wegen
Vorfeldwirkung für Unternehmen.
• Keine Anpassungsfrist für Normadressaten, weil Verbot mit Feststellung marktübergreifender Marktmacht
verbunden werden kann.
2Ausweitung der Normadressatenstellung (II)
Das Konzept der relativen Marktmacht (§ 20) wird in dreierlei Hinsicht stark ausgedehnt:
• Die Aufhebung des KMU-Erfordernisses (§ 20 Abs. 1 S.1) wird Rechtsstreitigkeiten begünstigen, weil unklar
ist, wann „Ungleichgewicht“ der Machtverhältnisse zwischen Parteien vorliegt.
• Die Konturen der „Intermediationsmacht“ (§ 18 Abs. 3b, § 20 Abs. 1 S. 2) sind unscharf: Besteht relative
Marktmacht bereits, weil Anbieter/Kunden keinen direkten Zugang mehr zur anderen Marktseite haben? Was
bedeuten „ausreichende, zumutbare Ausweichmöglichkeiten“ in diesem Zusammenhang?
• Die Definition der „Datenmacht“ (§ 20 Abs. 1a ist ebenfalls unklar: Jedes Unternehmen sammelt Daten und
wertet sie aus. Besteht Marktmacht, weil ein anderes Unternehmen die Daten nicht hat und gebrauchen könnte?
Die Ausdehnung auf bisher Dritten nicht zur Verfügung gestellte Daten vergrößert den möglichen
Adressatenkreis erheblich und weicht von bisheriger Rechtsprechung ab.
3Ausweitung der Normadressatenstellung (III)
Fazit: Unklarheit insbesondere bei §§ 19a, 20, wer Normadressat der Missbrauchsaufsicht ist.
• Nicht nur GAFA-Unternehmen als mögliche Adressaten sind betroffen, sondern auch kleinere Plattformen.
• Erhöhter Beratungsbedarf entsteht und damit höhere Kosten auch bei kleineren Unternehmen.
• Die Ausweitung der Abweichung vom EU-Recht, das keine relative Marktmacht kennt, ist rechtspolitisch nicht
wünschenswert.
• Die Ausweitung der Normadressatenstellung ist eine Steilvorlage für Beschwerdeführer und Zivilkläger. Es
droht Over-Enforcement.
4Abgrenzungsschwierigkeiten in Bezug auf
zulässige/unzulässige Verhaltensweisen (I)
Behinderung
• Selbstbevorzugung (§ 19a): Pauschale Schädlichkeit für Wettbewerb ist nicht erwiesen. Nach Rspr. des BGH
(„Werbeanzeigen“) ist die Ungleichbehandlung eigener Dienste zulässig; Unzulässigkeit ist auch im EU-Recht
unklar (Google Shopping-Appeal anhängig). Verstoß ist schwer zu ermitteln (worin genau liegt
Selbstbevorzugung?) und geeignete Abhilfemaßnahmen sind schwer zur identifizieren; Art. 7 P2B-VO schreibt
bereits Transparenz vor. Effizienzvorteile/bessere Produkte drohen durch Verbot verhindert zu werden.
• Aufrollen (§ 19a): seit Regierungsentwurf immerhin „Unbilligkeit“ erforderlich und „Eignung zur erheblichen
Wettbewerbsbeeinträchtigung“. Jedoch unklar, auf welches konkrete Verhalten Vorschrift abzielt. §§ 19, 20
GWB sind ausreichend.
• Beweislastumkehr (§ 19a Abs. 2 S. 2) ist angesichts der Unschärfe der Tatbestände in Abs. 2
unverhältnismäßig.
• Tipping (§ 20 Abs. 3a): unklar, wann ein Markt anfällig für Tipping ist. Keine Abgrenzung von Maßnahmen
des Leistungs- bzw. Nichtleistungswettbewerb; Beispiele würden helfen, z.B. zu Erschwerung Multi-Homing.
Diskriminierung
Angesichts von Unklarheit über die Normadressatenstellung bei § 20 GWB droht gleichförmiges Verhalten am
Markt.
5Abgrenzungsschwierigkeiten in Bezug auf
zulässige/unzulässige Verhaltensweisen (II)
Ausbeutung
Ohne Kausalitätserfordernis in § 19 Abs. 1 GWB droht ausufernde Anwendung der kartellrechtlichen
Missbrauchsaufsicht auf Rechtsverstöße aller Art
• Im RegE genannte Erforderlichkeit von „Marktbeziehungen“ ist im Geschäftsverkehr keine Einschränkung.
• Geschäftsbedingungen, die Wahlfreiheit des Vertragspartners einschränken, sind ebenfalls omnipräsent.
Mehrere neue Vorschriften zu Datenmissbrauch (§§ 19, 19a Abs. 2 Nr. 3, 4, 5, 20 GWB)
• Nutzung von Daten als Missbrauch (§ 19 a Abs. 2 Nr. 3): Datensammlung und –verwertung gehört zum
Tagesgeschäft und ist erforderlich für Innovationen. Nicht Nutzung von Daten sondern allenfalls Ausschluss
Dritter vom Zugang ist problematisch. Abweichung von Ansatz der Kommission im Digital Markets Act.
• Einfordern der Zustimmung zur Nutzung als Missbrauch (§ 19 a Abs. 2 Nr. 3): kein Unbilligkeits-
erfordernis; in Facebook-BGH war zumindest auch Behinderung von Wettbewerbern gegeben. Nutzung von
Daten kann effizient sein und damit Zustimmung für Kunden sinnvoll.
• Vorenthalten von Daten als Missbrauch zur Reservierung eines nachgelagerten Marktes (Abgrenzung § 19
Abs. 2 Nr. 4 zu § 20 Abs. 1, 1a GWB unklar); Abwägung bei § 20 GWB führt zu Rechtsunsicherheit. In Bezug
auf Erschwerung eines Anbieterwechsels § 19 a Abs. 2 Nr. 4, 5 GWB gilt schon DSGVO (Art. 20) und P2B-VO
(Art. 9). Vorenthalten von Daten beruht häufig auf unklarer Rechtslage in Bezug auf Geschäftsgeheimnisse,
Datenschutz.
6Unklares Verhältnis zu anderen Vorschriften
Die Rechtsunsicherheit wird durch unklare Abgrenzung zu anderen Vorschriften erhöht:
• Verschärfung der Diskrepanz zum EU-Recht (Artikel 102 AEUV) ist rechtspolitisch fragwürdig.
Fragmentierung der Rechtslage in der EU verhindert Level Playing Field für Unternehmen.
• Art. 20 DSGVO enthält Recht des Nutzers auf Portabilität personenbezogener Daten.
• Teilweise handelt es sich um Probleme der Vertragsgestaltung (§ 19a Abs. 2 Nr. 5).
• P2B-VO regelt in Art. 7 Selbstbevorzugung und in Art. 9 Datenzugang.
• Geplante Plattformregulierung im Digital Markets Act mit Blacklists für Gatekeeper sollte
abgewartet werden, um Inkonsistenzen zu vermeiden.
• Gesetzliche Zuständigkeitsregeln werden unterlaufen, wenn Bundeskartellamt gem. § 19 GWB
Rechtsverstöße aller Art aufgreifen kann.
7Folgen der neuen Missbrauchsaufsicht
Die Verschärfung der Missbrauchsaufsicht birgt verschiedene Risiken und Nachteile:
• Erhebliche Rechtsunsicherheit, weil jahrzehntelange Paradigmen aus der Rspr. aufgegeben werden.
• Flickenteppich verschiedener EU- und nationaler Regelungen erhöht die Unsicherheit.
• Höhere Kosten für viele Unternehmen aufgrund gestiegenen Beratungsbedarfs, um wenige
Unternehmen schärfer zu kontrollieren.
• Mehr zivile Rechtsstreitigkeiten wegen Ausweitung relativer Marktmacht, Ausbeutungsmissbrauch
(Rechtsverstöße) und Datenzugangsansprüchen. Gerichte sind darauf nicht vorbereitet.
• Es droht das Unterbleiben von Innovation, Produkten mit neuen Funktionalitäten und
leistungswettbewerblichen Vorstößen.
• Verringerung des Angebots durch Rückzug von Plattformen/Dienstleistungen aus Deutschland.
• Mehr behördliche Missbrauchsfälle, Sektoruntersuchungen und einstweilige Maßnahmen im
Digitalbereich binden erhebliche personelle Ressourcen.
8© 2020 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. All rights reserved. Throughout this presentation, “Cleary Gottlieb”, “Cleary” and the “firm” refer to Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP and its affiliated entities in certain jurisdictions, and the term “offices” includes offices of those affiliated entities.
Sie können auch lesen