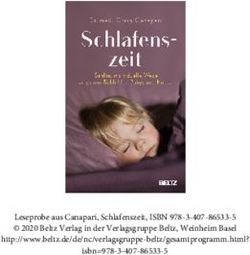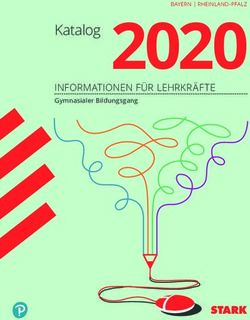"Die Welt trifft sich im Klassenzimmer" - Empirische Befunde und konzeptionelle Überlegungen für einen sprach- und kultursensiblen ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
sprache im beruf 1, 2018/1, 50–66
Birgit Werner / Rebecca Müller
„Die Welt trifft sich im Klassenzimmer“ –
Empirische Befunde und konzeptionelle
Überlegungen für einen sprach- und
kultursensiblen (Mathematik-)Fachunterricht
Free Download von der Franz Steiner Verlag eLibrary am 07.06.2022 um 20:44 Uhr
The world gathering in a classroom – empirical findings and conceptional
reflexions on comprehensible input in culturally responsive mathematics
instruction
Kurzfassung: Aus inter- bzw. transkultureller Perspektive ist zu berücksichtigen, dass un-
terschiedliche individuelle und soziokulturelle Rahmenbedingungen den Erwerb mathema-
tischer Kompetenzen beeinflussen. Der Beitrag skizziert soziologische und fachdidaktische
Grundlagen und referiert erste Befunde aus einem Forschungsprojekt, in dem asylsuchende,
berufsschulpflichtige Jugendliche begleitet werden. Anhand konkreter Unterrichtssituationen
aus dem Fach Mathematik werden bildungstheoretische sowie (fach)didaktisch-methodische
Überlegungen entwickelt, die die Teilhabe der Jugendlichen mit ganz unterschiedlichen
Sprach-, resp. Deutschkenntnissen am Unterricht ermöglichen.
Schlagworte: sprach- und kultursensibler (Mathematik-)Fachunterricht; mathematische Kom-
petenzen im Kontext von (Schrift)Sprache und Deutsch als Zweitsprache; Konzept der Grund-
bildung; Zweitsprachdidaktik; Mathematik und berufliche Bildung
Abstract: Viewed from an intercultural or transcultural perspective respectively, individual
and socio-cultural parameters have to be taken into account when looking at the acquisition
of mathematical competences. This article outlines the sociological base and the principles of
mathematics methodology, and presents first findings from a research project that follows teen-
age asylum seekers attending vocational schools. Based on concrete mathematics classroom
situations, thoughts on aspects of educational theory and mathematics pedagogy are developed
that illustrate how classroom participation of linguistically diverse teenage learners can be fa-
cilitated.
Keywords: comprehensible input in culturally responsive mathematics instruction; mathemati-
cal competencies in the context of Second Language and Literacy Acquisition; concept of „ba-
sic education“; Second Language Pedagogy; mathematics and vocational education
Franz Steiner Verlag„Die Welt trifft sich im Klassenzimmer“ 51
1. Projektbeschreibung
Das Forschungsprojekt „Reallabor Asylsuchende in der Rhein-Neckar-Region“ (Baden-
Württemberg) (www.reallabor-asyl.de) widmet sich der Untersuchung von Erfolgsfak-
toren für eine möglichst schnelle gesellschaftliche Integration von Asylsuchenden. Es
wird davon ausgegangen, dass insbesondere die Faktoren
• Spracherwerb
• berufliche Bildung
• Arbeitsmarktintegration
• dezentrales Wohnen
• bürgerschaftliches Engagement (als Querschnittsprojekt)
Free Download von der Franz Steiner Verlag eLibrary am 07.06.2022 um 20:44 Uhr
eine wesentliche Rolle für eine gelungene Integration spielen. Zur transdisziplinären
Betrachtung dieser Faktoren unterteilt sich das Gesamtprojekt in drei Teilprojekte, die
unter anderem durch das Querschnittsprojekt „Bürgerschaftliches Engagement und tri-
sektorale Kooperation“ miteinander verbunden sind. Ziel des Projekts ist es, belastbare
Erkenntnisse über Einflussfaktoren auf die Integration von Flüchtlingen in den Berei-
chen Spracherwerb, Arbeitsmarktintegration und Wohnen zu gewinnen. Bildung und
Arbeit werden innerhalb dieses Projektes als die entscheidenden Voraussetzungen für
das Gelingen gesellschaftlicher Integration angesehen. Teilhabe – genauer: berufliche
und gesellschaftliche Teilhabe – wird somit zur zentralen Ziel- und Inhaltskategorie von
Bildung.1
Die hier vorgestellten Erkenntnisse und Überlegungen wurden im Teilprojekt I –
Diagnose und Förderung sprachlicher und mathematischer Kompetenzen von be-
rufsschulpflichtigen jugendlichen Asylsuchenden – gewonnen. Dieses zielt darauf ab,
exemplarisch didaktische Settings zu modellieren und Materialien für eine VABO-
Klasse (Vorbereitungsklassen Arbeit und Beruf mit dem Schwerpunkt Erwerb von
Deutschkenntnissen) zu entwickeln, zu erproben, zu modifizieren sowie zu evaluie-
ren. Die didaktischen Settings sollen es den Lernenden ermöglichen, den Sprach- und
ggf. Schrifterwerb der deutschen Sprache, den Erwerb mathematischer und fachlicher
Kompetenzen im Kontext von beruflich relevanten Inhalten so zu kombinieren, dass sie
auf ihren eigenen Fähigkeiten und Ressourcen aufbauen können. Bildungsangebote in
diesem herausfordernden Handlungsfeld intendieren zunächst die Teilhabe und Par-
tizipation aller Beteiligten am Unterrichtsgeschehen selbst sowie nachfolgend auf die
Erlangung eines qualifizierten Abschlusses.
Um einen qualifizierten Bildungsabschluss zu erreichen, müssen neu zugewanderte Schülerin-
nen und Schüler nach kurzer Zeit am Fachunterricht an deutschen Schulen teilnehmen. Da
sie oftmals umfangreiche Fachkenntnisse aus dem Heimatland mitbringen, ist eine zeitnahe
1 Die Darstellungen dieses Beitrags fokussieren sich auf den Bereich der beruflichen Bildung. Die Faktoren
Arbeitsmarktintegration, dezentrales Wohnen und bürgerschaftliches Engagement sind eigenständige,
zentrale Themenbereiche, die hier nicht berücksichtigt werden können.
Franz Steiner Verlag52 birgit werner / rebecca müller
zielgruppenspezifische fachliche und sprachliche Förderung elementar für ihren Schulerfolg.
(Mavruk/Schmidt 2016: 53)
Diese Rahmenbedingungen machen deutlich, dass die sprachliche Bewältigung unter-
richtlicher Anforderungen von zentraler Bedeutung ist.
2. Mathematik-Lernen unter Berücksichtigung bildungs- und fachsprachlicher
Aspekte
Die nachfolgenden Überlegungen konzentrieren sich auf den Erwerb mathematischer
Free Download von der Franz Steiner Verlag eLibrary am 07.06.2022 um 20:44 Uhr
Kompetenzen im Kontext von (Schrift)Sprache, hier unter der besonderen Situation,
dass zeitgleich die deutsche Sprache als Zweitsprache erworben wird.
Mathematische Kompetenzen und sprachliche Fähigkeiten stehen in engem Zu-
sammenhang. In der Mathematikdidaktik und verschiedenen mathematikaffinen Dis-
ziplinen wie Sonderpädagogik und Lern- und Entwicklungspsychologie beschreiben
zahlreiche Publikationen den Zusammenhang zwischen Sprache und dem Erwerb ma-
thematischer Kompetenzen (u. a. Freudenthal 1985, Maier 1989, Voigt 1991, Krummheu-
er 1994, Ruf/Gallin 1995, Steinbring 2000, Bills 2002, Häsel-Weide 2007, Krauthausen
2007, Schütte 2009, Prediger/Özdil 2011, Nolte 2016, Berg et al. 2016, Meyer/Tiedemann
2017).
Sprache erfüllt im Mathematikunterricht eine Doppelfunktion: Sie ist sowohl Lern-
gegenstand als auch Unterrichtsmedium. Der Lerngegenstand ‚Mathematik‘ selbst wird
vorrangig als kulturgebundenes, konventionelles Zeichen-, Begriffs- und Symbolsystem
betrachtet (Werner 2009, Meyer/Tiedemann 2017). Mathematische Symbole, Terme
und Gleichungen weisen eine hoch komprimierte, präzise und abstrakte Notation auf.
So erfasst beispielsweise bereits die grundlegende Gleichung 7 - 2 = 5 – bestehend aus
lediglich fünf Symbolen in konventionell festgelegter Reihenfolge folgenden mengen-
theoretischen Sachverhalt: immer, wenn von einer Menge mit sieben Elementen eine
Menge von zwei Elementen entfernt/abgezogen wird, ist diese übriggebliebene Menge
genau so groß wie eine Menge von fünf Elementen. Während in der mathematischen
Konvention dafür lediglich fünf Symbole benötigt werden, nimmt diese beispielhafte
Beschreibung der mathematischen Aussage in der schriftlichen Form mindestens zwei
Textzeilen ein.
Die nachfolgende Analyse der sprachlich-mathematischen Anforderungen des
in dieser Klasse im Fach ‚Rechenkompetenz‘ eingesetzten Mathematik-Lehrwerkes
„Grundwissen für den Beruf: Mathematik – Technik“ (Koullen 2013) verdeutlicht die
beschriebene Komplexität.
Franz Steiner Verlag„Die Welt trifft sich im Klassenzimmer“ 53
Free Download von der Franz Steiner Verlag eLibrary am 07.06.2022 um 20:44 Uhr
Abb. 1: Mathematik für den Beruf – Technik (Koullen 2013)
Diese Seite zum Themenfeld ‚Zuordnungen und Dreisatz‘ (Abb. 1) illustriert selbst ei-
nem kompetenten Leser und einer mathematisch kompetenten Person die Komplexität
beim Erlernen mathematischer Sachverhalte. Auffallend ist zunächst, dass ‚die Mathe-
matik‘ hier überwiegend in schriftsprachlicher, d. h. in einer Art Text dargeboten wird.
Die Wörter und Sätze sind eng verknüpft mit grafischen bzw. symbolischen Elementen
wie Diagrammen, mit mathematischen Symbolen beschrifteten Pfeilen sowie tabellen-
ähnlichen Darstellungen, die sowohl zeilen- als auch spaltenartiges Lesen erfordern.
Die Sinnentnahme ist nur möglich, wenn diese hochkomplexe Kombination als zusam-
mengehöriger Text einschließlich seiner komplexen Satzstrukturen erfasst und verstan-
den wird.
Zu berücksichtigen ist bei einem Teil der Zielgruppe – arabisch sprechende Jugend-
liche – zudem, dass die im arabischen übliche waagerechte linksläufige Schrift (es wird
primär von rechts nach links geschrieben und gelesen), die Texterschließung zusätzlich
erschwert.
Dieses Textangebot enthält sowohl bildungs- als auch fachsprachliche Merkmale.
Die B i l d u n g s s p r a c h e bestimmt sowohl die sozialen und kulturellen Praktiken der
Sprachverwendung als auch die Formen der Vermittlung und des Erwerbs von Wissen
in einer Gesellschaft (Gogolin/Lange 2011, Schmölzer-Eibinger et al. 2013, Feilke 2012).
Unter Bildungssprache versteht man im Allgemeinen den für schulische Kommunika-
tion charakteristischen Sprachgebrauch, von dem angenommen wird, dass er sich im
Vergleich zur Alltagssprache z. B. durch einen anspruchsvolleren Wortschatz, eine kom-
Franz Steiner Verlag54 birgit werner / rebecca müller
plexere Grammatik und eine geringere situative Einbettung auszeichnet (Heppt et al.
2012). Unschwer ist diese Charakteristik in folgendem Satz zu erkennen: „Trägt man
die Wertepaare in einem Koordinatensystem ein, liegen die Punkte auf einer fallenden Kurve“
(vgl. Abb. 1). Dieser Satz trägt die typischen Merkmale der Bildungssprache. Sie stellt
eine Distanz zur gesprochenen Sprache her und ist monologisch, themenfixiert und ra-
tional, nüchtern angelegt (Gellert 2008). Bildungssprache ist als eine Art von Sprache zu
verstehen, die einen besonders komplexen, abstrakten, kontextgebundenen, expliziten
und kohärenten Charakter aufweist. Typisch sind Fremdwörter, Fachbegriffe, komplexe
syntaktische Strukturen, Nominalisierungen und Komposita, komplexe Attribute, eine
hohe lexikalische Dichte sowie der Verzicht auf Redundanzen, Passivkonstruktionen
und Abstrakta (Schmölzer-Eibinger et al 2013: 26). Bildungssprache enthält sowohl
Free Download von der Franz Steiner Verlag eLibrary am 07.06.2022 um 20:44 Uhr
Elemente der alltäglichen Umgangssprache als auch der disziplinären Fachsprache.
Als vermittelndes Medium in Lehr- und Lernkontexten setzt sie bereits Verstehen und
abstraktes Bedeutungswissen voraus und bildet eine eigene Sprachumgebung (Feilke
2012). Als sogenanntes Register ist Bildungssprache letztlich eine Sprachgebrauchsform
in einem bestimmten sozial-funktionalen Kommunikationsfeld (Feilke 2012: 6). Sie ist
stark normativ, denn deren Beherrschung wird von den Schülern erwartet und stellt ein
‚kulturelles Kapital‘ dar (Feilke 2012, Walzebug 2015).
Teilhabe bzw. Partizipation am Mathematikunterricht erfordern umfangreiches und
differenziertes Sprachhandeln, in der die individuelle Sprachkompetenz eine zentrale
Stellung einnimmt. Sprachkompetenz berücksichtigt, dass Sprache einerseits Voraus-
setzung für die Partizipation am Unterricht, gleichzeitig integraler Bestandteil des Kon-
struktes Mathematik sowie relevant für die Anwendung und Vertiefung der erworbenen
Kompetenzen ist (Krummheuer 1994, Werner 2009, Linneweber-Lammerskitten 2014,
Berg et al 2016, Meyer/Tiedemann 2017).
Welche Herausforderungen stellt dies nun für Jugendliche ohne bzw. mit nur ge-
ringen Deutschkenntnissen im berufsbildenden Bereich dar? Ganz grundlegend gilt
es zunächst, die Teilhabe aller Jugendlichen an diesem Lernangebot zu sichern. Die
Bildungsangebote müssen sich an der Frage bewerten lassen: welche Chancen werden
dem Lernenden eröffnet, mit ihren Kompetenzen in den jeweiligen sozialen Situationen
(Schule, Ausbildung, Beruf) anschlussfähig zu sein. Damit liegt der Fokus auf einem
eher bildungssoziologisch geprägten Bildungsverständnis, das Sozialisations-, Erzie-
hungs- und Bildungsprozesse im Lebenslauf einer Person in den Mittelpunkt stellt. Ein
teilhabeorientiertes Bildungsangebot orientiert sich an einem funktionalen Verständnis
von Bildung und stellt die Passung zwischen individuellen Kompetenzen und den je-
weils sozial-lebensweltlich und ausbildungs- und arbeitsweltbezogenen Anforderungen
in den Vordergrund. Charakteristisch für teilhabeorientierte Bildungsangebote ist, sich
weniger an formalen Abschlüssen, sondern mehrheitlich an den Anschlussmöglichkei-
ten zu orientieren (Werner 2017).
Franz Steiner Verlag„Die Welt trifft sich im Klassenzimmer“ 55
2.1 Situation im Forschungsfeld
„Die Welt trifft sich im Klassenzimmer“ – dieser spontane Ausspruch markiert prägnant
die vielschichtige Heterogenität der Lerngruppen. Zunächst sei anhand ausgewählter
Merkmale wie die Herkunftsländer und Muttersprachen die sprachlich-kulturelle Hete-
rogenität der Jugendlichen umrissen (Abb. 2).
Free Download von der Franz Steiner Verlag eLibrary am 07.06.2022 um 20:44 Uhr
Abb. 2: Herkunftsländer von Asylbewerber in Deutschland Jahr 2015 (BAMF 2015: 10)
Abbildung 2 illustriert die zehn häufigsten Herkunftsländer anhand der gestellten Asyl-
anträge. Die aktuellsten Zahlen des BAMF für das erste Quartal des Jahres 2016 zeigen,
dass Syrien mit einem Anteil von 50,3% am häufigsten vertreten ist(BAMF 2016: 8).
Erste Auskünfte über die sprachliche und bildungsbiografische Vielfalt geben die
Ergebnisse einer Befragung von über 500 neuzugewanderten Jugendlichen und jungen
Erwachsenen (Baumann/Riedl 2016). Neben allgemeinen personenbezogenen Daten
und der Bildungsbiografie wurden Daten zur Sprachbiografie sowie zum Spracherwerb
Deutsch erhoben.
Franz Steiner Verlag56 birgit werner / rebecca müller
Free Download von der Franz Steiner Verlag eLibrary am 07.06.2022 um 20:44 Uhr
Abb. 3: Muttersprachen mit mindestens 10 Nennungen (n=529) (Baumann/Riedl 2016: 66)
Die Anzahl der erfassten Muttersprachen (Abb. 3) zeigt ebenfalls eine enorme Viel-
falt. Je nach Klassenzusammensetzung sprechen selbst die Schülerinnen und Schüler,
die bspw. alle aus Afghanistan eingewandert sind, bis zu drei verschiedene Sprachen
(Dari, Farsi und Paschto). Dies führte in unserem Projekt dazu, dass allein die Installati-
on einer gemeinsamen Unterrichtssprache äußerst anspruchsvoll war.
Abb. 4: Schulbiografie Vielfalt; Anzahl der Nennungen (n = 386) (Baumann/Riedl 2016: 100)
Franz Steiner Verlag„Die Welt trifft sich im Klassenzimmer“ 57
Eine weitere Heterogenitätsdimension zeigt sich bei der Betrachtung der Bildungsbio-
grafie. Die Ergebnisse der Befragung von Baumann und Riedl (2016) verdeutlichen,
dass das Spektrum der Bildungsbiografien der Befragten von Jugendlichen von gänzlich
ohne bisherigen Schulbesuch bis hin zum Besuch der Universität reicht. Im Teilprojekt
des Reallabors zeigte sich ähnliches. Drei Afghanen brachten beispielsweise Bildungs-
biografien von ‚kein Schule – Ich hab zuhause Ziegen aufgepasst‘, über den Besuch der Ko-
ranschule bis hin zum (vergleichbar) gymnasialen Schulbesuch mit.
Für derartig heterogene Settings liegen bislang keine evidenzbasierten Konzepte vor.
Während der fachdidaktische Diskurs für den Lernbereich ‚ D e u t s c h a l s Z w e i t -
s p r a c h e ‘ (DaZ) im schulischen Kontext schon mit einer Vielzahl evidenzbasierter
Konzepte aufwarten kann, muss für den berufsbildenden Bereich und dabei speziell
Free Download von der Franz Steiner Verlag eLibrary am 07.06.2022 um 20:44 Uhr
für den Lernbereich Mathematik ein großes Forschungsdesiderat konstatiert werden.
Die Herausforderung dieses Teilprojektes bestand/besteht darin, für neuzugewan-
derte und geflüchtete Jugendliche Bildungsangebote zu generieren, die bislang jeglicher
fachwissenschaftlichen und didaktischen Grundlegung entbehren. Ebenso fehlen der-
zeit zielgruppenspezifische Verfahren zur systematischen Erfassung ihrer sprachlichen,
mathematischen und berufsrelevanten Kompetenzen. Dies markiert ein scheinbar aus-
wegloses Dilemma: Einerseits ist für diese Schülergruppe ein sprachlich vereinfachter,
lernunterstützender und kontextualisierter Input notwendig, um die Auseinanderset-
zung mit den Lerngegenständen zu initiieren. Andererseits sind es vorrangig gerade die-
se sprachlichen Anforderungen, die eine solche Auseinandersetzung mit dem Lernge-
genstand erschweren.
2.2 Theoretische Grundlagen des didaktischen Vorgehens
Die nachfolgend skizzierten Herangehensweisen sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt
lediglich als „Best-Practice“-Beispiel zu verstehen.
Eine Annäherung an die Gestaltung didaktischer Settings basierte auf drei theore-
tischen Quellen, die eine Verknüpfung verschiedener theorie- bzw. problemaffiner An-
sätze darstellen:
1. Konzept der Grundbildung (vorrangig aus dem berufsbildenden Bereich) (Klein/
Schöpper-Grabe 2012, Werner 2017)
2. Mathematikdidaktische Überlegungen, die sich auf den Zusammenhang von Spra-
che und Mathematik konzentrieren (u. a. Maier 1989, Maier et al 1999, Prediger/
Özdil 2011, Leisen 2011, Tajmel 2013, Thürmann/Vollmer 2013, Spreer 2014, Meyer/
Tiedemann 2017)
3. Ansätze aus der Zweitsprachdidaktik, d. h. aus der Fachdidaktik Deutsch als Zweit-
sprache (DaZ), die mehrheitlich einen situativen Ansatz verfolgen sowie „durchgän-
gige Sprachbildung“ als Unterrichtsprinzip verstehen (Kniffka 2010, Gogolin/Lange
2011) und Unterstützungsvarianten unter dem Begriff Scaffolding subsummieren
(Schnotz 2006, Kniffka 2010).
Franz Steiner Verlag58 birgit werner / rebecca müller
Bildungstheoretisch basieren die Lernangebote auf dem Konzept der Grundbildung
(Klein/Schöpper-Grabe 2012, Werner 2017). Grundbildungsorientierte Bildungsange-
bote berücksichtigen und nutzen die Wechselwirkungen individueller Kompetenzen
und situativer, sozialer Anforderungen. Sie intendieren, die Teilhabe an diesen jeweils
spezifischen sozialen Situationen zu ermöglichen, d. h. die Situationen sind so zu ge-
stalten, dass die Schüler ihre Teilnahme daran für sich als sinnhaft, gewinnbringend,
wertvoll und wertschätzend wahrnehmen. Grundbildung ist zu allererst Bildung, die
Teilhabe i. w. S. ermöglicht. Strategien und Inhalte von Grundbildung werden kontex-
tualisiert. Das Lernen bezieht sich u. a. auf Kommunikationsprozesse im realen Alltag
in Schule und Beruf, indem vielfältige Lernorte (Arbeitsplatz, Bildungseinrichtung, öf-
fentliche Räume) genutzt werden.
Free Download von der Franz Steiner Verlag eLibrary am 07.06.2022 um 20:44 Uhr
Die Inhalte und Anforderungen der Grundbildung nehmen – im Gegensatz zum
schulischen Fachunterricht – keine strikte Trennung zwischen schriftsprachlichen und
mathematischen Anforderungen vor. Die Bildungsangebote greifen vorrangig auf ar-
beits- und lebensweltorientierte Themen in ihren konkreten sozialen Bezügen zurück.
Es werden Lernsituationen modelliert, zu deren Lösung nicht ausschließlich schulisch
vermittelte Strategien (mehrheitlich kognitiver und metakognitiver Art) notwendig
sind. Sie lassen gleichermaßen kreative, unkonventionelle Lösungswege und -strategi-
en unter Einbezug der situativen Gegebenheiten zu. Die Angebote folgen nicht zwin-
gend der sachstrukturellen Logik des Lerngegenstandes, sondern vorrangig der Logik
der Situation. Intention dieser Bildungsangebote ist es, eine Passung zwischen den in-
dividuellen Lernvoraussetzungen und -möglichkeiten sowie den situativen konkreten
Anforderungen herzustellen. Sie sichern generell die Teilhabe an institutionellen Bil-
dungsangeboten und fokussieren primär auf Anschlüsse und erst nachrangig auf forma-
le Abschlüsse.
Unter dieser Prämisse gilt es, die Strukturen der Situation hinsichtlich ihrer kom-
munikativen Hürden zu identifizieren und über remediale bzw. kompensatorische
Maßnahmen auszugleichen. Als fachdidaktische Basis bietet es sich an, das Modell der
Aktivitäten des intermodalen Transfers zu nutzen (Maier/Schweiger/Reichel 1999: 78).
Abb. 5: Aktivitäten des intermodalen Transfers (Maier et al. 1999)
Franz Steiner Verlag„Die Welt trifft sich im Klassenzimmer“ 59
In diesem – in der Mathematikdidaktik – schon recht lange bekannten und weit verbrei-
teten Modell soll ein mathematischer Sachverhalt möglichst in allen vier Darstellungs-
bzw. Abstraktionsebenen – Bild, Zeichnung und/oder Grafik, Handlung, Sprache so-
wie mathematische Konvention – aufgegriffen werden. Besonderes Gewicht wird auf
den Transfer zwischen allen vier Repräsentationsmodi gelegt. Die Doppelpfeile markie-
ren, dass der Transfer in beide Richtungen vorgenommen wird/vorgenommen werden
kann. Dieses Modell repräsentiert kein Stufenmodell, in welchem beispielsweise die
mathematische Konvention die höchste Ebene darstellt und die anderen Ebenen nur
als Vorform angesehen werden. Erst die gleichwertige Verbindung aller Darstellungs-
ebenen ermöglicht ein tiefes Verständnis eines mathematischen Sachverhalts.
Das Vorgehen im Rahmen der Projektarbeit stützt sich zudem auf die Methode
Free Download von der Franz Steiner Verlag eLibrary am 07.06.2022 um 20:44 Uhr
des Scaffoldings. Scaffolding bezeichnet im pädagogisch-psychologischen Kontext die
Unterstützung des Lernprozesses durch die Bereitstellung einer ersten vollständigen
Orientierungsgrundlage in Form von Anleitungen, Denkanstößen und anderen Hil-
festellungen. Sobald der Lernende fähig ist, eine bestimmte Teilaufgabe eigenständig
zu bearbeiten, wird dieses „Gerüst“ schrittweise entfernt (Schnotz 2006, Spreer 2014,
Gibbons 2002, Kniffka 2010). Im Kontext des Zweitspracherwerbs kennzeichnet Scaf-
folding ein Unterstützungssystem im (sprachsensiblen) Fachunterricht (Kniffka 2010).
Scaffolding stellt eine zeitlich begrenzte Unterstützung zur Erschließung neuer Konzep-
te, unbekannter Begriffe und komplexer Wissensnetze dar. Makro-Scaffolding konzen-
triert sich auf die Analyse von Strukturelementen wie Unterrichtsplanung, Lernstands-
analysen und Bedarfsanalysen, z. B. auf die Frage nach der Ermittlung des Sprachbedarfs
für einen Unterrichtsinhalt aus fachlicher Sicht, nach der Analyse der sprachlichen
Anforderungen eines Lerngegenstandes. Im Gegensatz dazu konzentriert sich Mikro-
Scaffolding auf konkrete Methoden, z. B. auf Elemente wie das Sprechen über das Spre-
chen, eine mögliche direkte Unterstützung durch passende Begriffe, die Ermutigung
zu längeren und/oder fachlichen Äußerungen und auch das indirekte Bereitstellen von
Fachsprache durch Nachfragen (Hammond/Gibbons 2005: 20).
2.3 Didaktische Umsetzung
Anhand des Themas „Körper und Volumen“ wurde versucht, die zuvor beschriebenen
Anregungen umzusetzen. Die grundsätzliche, didaktisch-methodische Entscheidung
der beteiligten Lehrkräfte fiel zugunsten des bereits erwähnten Lehrbuches „Grundwis-
sen für den Beruf. Mathematik“ aus (Koullen 2013: Abb. 6.). Damit war auch ein lehr-
gangszentriertes, weniger situations- bzw. anwendungsorientiertes Vorgehen festgelegt.
Franz Steiner Verlag60 birgit werner / rebecca müller
Free Download von der Franz Steiner Verlag eLibrary am 07.06.2022 um 20:44 Uhr
Abb. 6: Merksatz zum Thema Prisma (Koullen 2013: 160)
Um zunächst eine gemeinsame kommunikative Basis zu schaffen, wurden neben dem
Schulbuch entsprechende reale Modelle der abgebildeten geometrischen Körper ein-
gesetzt (Abb. 7). Die Jugendlichen operierten selbst mit diesen Gegenständen und be-
nannten die ihnen bekannten Merkmale bzw. Bezeichnungen der Körper, z. B. Prisma,
Grundfläche, Höhe, Ecken, Kanten (Verbalisieren/Konkretisieren). Diese spontan
verwendeten Begriffe wurden auf Wortkarten verschriftlicht und an die Körper gehef-
tet. Begleitend wurden die Jugendlichen aufgefordert, nicht nur die einzelnen Begriffe
auf Deutsch zu benennen, sondern diese in vorgegebene oder auch freie Satzmustern
einzubinden, z. B. ‚da ist die Grundfläche‘, ‚ich zeige die Grund- und die Mantelfläche des
Prismas‘. Selbstverständlich war die Nutzung entsprechender Apps zur Übersetzung per
Smartphone sowie die üblichen Nachschlagewerke wie mathematische Formelsamm-
lungen oder Lexika möglich und erwünscht. Als motivierend und bereichernd wurde
es von den Jugendlichen empfunden, sich in sozialkooperativer Erarbeitung Begriffe –
sofern möglich auch in ihren Herkunftssprachen – gegenseitig zu erklären bzw. sich
im Sprachgebrauch zu korrigieren. Somit wurden produktiv und wertschätzend auch
gleichzeitig die unterschiedlichen Sprach- und Lernstände genutzt. Parallel dazu wurde
ein Glossar angelegt, in dem diese Fachbegriffe tabellarisch im Deutschen aufgeführt
und durch Zeichnungen, Übersetzungen in die Herkunftssprache oder kurze Erklärun-
gen ergänzt wurden. Das Glossar diente den Jugendlichen als individuelle Lern- und
Merkhilfe, ähnlich einem Regel- oder Vokabelheft (Verbalisieren). Aufgrund der viel-
fältigen Beobachtungen und Situationen im Unterricht, kam wiederholt die Frage nach
Möglichkeiten und Grenzen der Nutzung weiterer Sprachen auf. Unbekannte Begriffe
wurden oft spontan mit Hilfe von Smartphones oder durch die Unterstützung der Klas-
Franz Steiner Verlag„Die Welt trifft sich im Klassenzimmer“ 61
senkameraden in die Erstsprache übersetzt. Die Verwendung der Erstsprache als Un-
terstützungssystem zum Aufbau eines mathematikspezifischen Sprachspeichers wird in
verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen unterschiedlich diskutiert. Studien der
Mathematikdidaktik zur Nutzung der Erstsprache im Sinne der ganzheitlichen Sprach-
förderung sehen in der Nutzung der Erstsprache eine Ressource, die zwar wesentlich
ist, dennoch mit Vorsicht betrachtet werden muss. So wurden Kindern der vierten und
sechsten Klasse, die als Erstsprache Türkisch sprechen und von sich sagen, auf Türkisch
lesen zu können, beobachtet, inwiefern diese zweisprachigen Schülerinnen und Schüler
ihre Erstsprache beim Mathematiklernen zielführend einsetzen können. Hierzu wurde
unter Laborbedingungen ein zweisprachiges Setting angeboten, das verschiedene Opti-
onen der Türkischnutzung hinsichtlich Sprachrezeption und -produktion enthielt.
Free Download von der Franz Steiner Verlag eLibrary am 07.06.2022 um 20:44 Uhr
Die Nutzung der Erstsprache kann […] einerseits Chancen zur Förderung des Verstehens
mit sich bringen, andererseits, unter der Bedingung des Fehlens entsprechender Sprachmittel,
kann sie sich gerade dadurch auch als lernhinderlich erweisen. Diese wichtige Grenze ist am
besten durch konsequente und frühzeitige Nutzung der Erstsprache vom Schuleintritt an zu
überschreiten. (Meyer/Prediger 2011: 201)
Auch Ansätze der Pädagogik und Spracherwerbsforschung präferieren die Nutzung der
Erstsprache:
Generell ist für den Unterricht mit neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern von großer
Relevanz, ob ein didaktischer Rückgriff auf die Kompetenzen in ihrer/n Erstsprache(n) erfolgt
da dieser bei der Aneignung der Zweit- und Fremdsprache unterstützend wirken kann. (Mav-
ruk/Schmidt 2016: 54)
Inwiefern die Nutzung der Erstsprache im Rahmen der Unterrichtsgestaltung gerade
für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler eine notwendige Brücke zur Teilha-
be am Unterricht darstellt, ist derzeit wissenschaftlich unzureichend betrachtet. Hier
zeichnet sich ein deutliches Forschungsdesiderat ab.
Im Rahmen des Unterrichts wurde den Jugendlichen freigestellt, ob und wie sie ihre
Erstsprache nutzten. Gelegentlich – je nach Sprachstand – fanden auch die jeweiligen
englischen Fachausdrücke Anwendung. In einem weiteren Schritt wurden Arbeits-
blätter mit Abbildungen geometrischer Körper vorgelegt, die die Jugendlichen ihrem
Sprachstand entsprechend beschriften sollten (Verbalisieren/Verschriftlichen). Umge-
kehrt wurden die Jugendlichen aufgefordert, an dem Modell bzw. in den Zeichnungen,
typische Merkmale zu zeigen, z. B. ‚zeige die Grundfläche‘.
Abstrakte Begriffe wie ‚Volumen‘ wurden durch konkrete Handlungssituationen
(Konkretisieren) wie z. B. ‚Fülle diesen Körper mit Wasser‘ erarbeitet. Auch hier ist das
handlungsbegleitende Sprechen von zentraler Bedeutung. Dies kann sowohl durch das
Glossar als auch durch die Vorgabe von Satzmustern erleichtert werden.
Franz Steiner Verlag62 birgit werner / rebecca müller
Free Download von der Franz Steiner Verlag eLibrary am 07.06.2022 um 20:44 Uhr
Abb. 7: Einsatz realer Gegenstände, Modelle geometrischer Körper
Breiten Raum nahm die Wortfeld- bzw. Begriffsarbeit ein, in der Fachbegriffe nicht
nur isoliert erarbeitet, sondern sprachlich-kommunikativ eingebunden werden (Pre-
diger 2016). Es ist zu empfehlen, gerade anstelle eines reinen Wortspeichers mit iso-
lierten Wörtern, vorzugsweise strukturierte und reichhaltige Sprachspeicher zu nutzen
(Prediger 2016). In diesem Fall wurden z. B. begriffliche Netzwerke wie ‚Volumen – ist
gleich – Grundfläche – mal – Höhe‘ oder ‚Oberfläche – zweimal – Grundfläche – plus –
Mantelfläche‘ als Merksätze und Plakate eingesetzt. Darin eingebunden ist auch die Be-
deutungsanalyse (mathematischer) Instruktionen bzw. Anleitungen z. B. ‚Berechne das
Produkt‘, ‚Skizziere‘ oder auch ‚Begründe, dass …‘. An prototypischen Aufgaben wurde
thematisiert, was bzw. wonach gefragt ist und welche (mathematischen) Lösungsstrate-
gien erwartet werden.
Das bisher eingesetzte Förderkonzept stellt eine erste Annäherung dar und ist ledig-
lich eine Skizze potentieller (fach-)didaktisch-methodischer, zielgruppenspezifischer
Modellierungen. Die nachfolgend notwendigen Forschungs- und Entwicklungsaufga-
ben sowie die Notwendigkeit der Evaluation sind nahezu selbsterklärend.
Zusammenfassend seien hier die situativen, materialen und sprachlichen Un-
terstützungsmaßnahmen aufgeführt, die sich in der bisherigen Arbeit im mathema-
tischen (Fach-)Unterricht mit der Zielgruppe bewährt haben (und deren Auflistung
keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt).
• Kontexte aus der Lebenswelt nutzen,
• kurze Sätze, d. h. ohne Nebensätze und Verschachtelungen verwenden,
• Genitiv-, Passiv- und Partizipialkonstruktionen vermeiden, d. h. auch Fachtexte um-
formulieren,
• Texte durch Absätze strukturieren,
• Wichtiges farbig/fett drucken bzw. unterstreichen lassen,
• Texte (laut) lesen und Fachbegriffe artikulieren lassen,
• Veranschaulichungsmittel zur Verfügung stellen,
Franz Steiner Verlag„Die Welt trifft sich im Klassenzimmer“ 63
• Fachwortschatz und schwierige Wörter erklären und veranschaulichen (Glossar er-
stellen, informative Figuren erarbeiten, reale Modelle einsetzen),
• Wortfeldarbeit, um den Aufbau eines themenspezifischen begrifflichen Netzwerkes
i. S. eines Wort- und Sprachspeichers zu initiieren,
• Fachspezifische Instruktionen/Anweisungen in konkreten Handlungssituationen
erklären,
• Kooperatives Arbeiten, Teamarbeit anregen, um die sprachlichen und fachbezogen
individuellen Wissensressourcen zu nutzen,
• temporär eine interne Unterrichtssprache festlegen, z. B. englisch, um eine gemein-
same sprachlich-kommunikative Basis zu schaffen,
• Aufgaben mit eigenen Worten sowie in verschiedenen Sprachen wiederholen lassen
Free Download von der Franz Steiner Verlag eLibrary am 07.06.2022 um 20:44 Uhr
• Doppel-, Mehrfachfragen vermeiden.
3. Fazit
Die skizzierten didaktisch-methodischen Überlegungen intendieren eine „Anschlussfä-
higkeit“ an den Lernenden, die das entscheidende Qualitätskriterium jeglicher Lernan-
gebote ist (Fend 2008: 207).
Nachfolgende Forschungs- und Entwicklungsaufgaben liegen vor allem in der Eva-
luation dieser skizzierten Konzepte hinsichtlich ihrer Lerneffekte, ihrer Wirksamkeit
auch in außerunterrichtlichen Lernfeldern, in der Akzeptanz der Konzepte durch die
Jugendlichen selbst, in der notwendigen Erweiterung um fachliche, sprachfördernde
aber auch psychosozialer Momente wie Motivation, Selbstkonzept usw. Zudem lässt die
kurze Laufzeit des Projektes sowie die hohe Fluktuation der Jugendlichen (z. B. durch
Rückführung, Umzug, Wechsel der Schulformen) und auch der beteiligten Lehrkräfte
noch keine Aussagen über den Einfluss der individuellen soziokulturellen und ethno-
mathematischen Faktoren zu. Eine inter- bzw. transkulturelle Perspektive lässt sich erst
auf der Basis einer systematischen Datenerhebung, die über die Erfassung bildungsbio-
grafischer Daten sowie schriftsprachlicher und mathematischer Kompetenzen hinaus-
geht, einnehmen. Fragen dieser Art müssen u. a. die kulturspezifischen Vorstellungen
von Mathematik, die Konstrukte der Schulmathematik in den Herkunftsländern und
die individuellen Herangehensweisen bei der Anwendung von Mathematik berücksich-
tigen. Darüber hinaus sind Aussagen über mathematikbezogene Vorstellungen notwen-
dig, die sowohl durch das eigene Selbstbild als auch durch das mathematikbezogene
Weltbild und somit auch durch die sprachlich-kulturellen sowie sozialen Lebensum-
stände geprägt sind (Deseniss 2015). Erst diese interdisziplinäre und intersektionale
Sichtweise vermag die Teilhabe der Jugendlichen an einem fach- bzw. berufsbezogenen
Mathematikunterricht theoretisch zu fundieren und langfristig zu sichern.
Franz Steiner Verlag64 birgit werner / rebecca müller
Literatur
BAMF/Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2015): Asylgeschäftsstatistik für den Monat
Dezember 2015. Online verfügbar unter: http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/
Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/201512-statistik-anlage-asyl-geschaeftsbericht.pdf ?__
blob=publicationFile (02.05.16).
Baumann, Barbara / Riedl, Alfred (2016): Neuzugewanderte Jugendliche und junge Erwachsene an
Berufsschulen. Ergebnisse einer Befragung zu Sprach- und Bildungsbiografien. Frankfurt a. M.
Berg, Margit et al. (2016): Inklusiver Mathematikunterricht als sprach- und kommunikationssen-
sibler Fachunterricht. Empirische Befunde und konzeptionelle Überlegungen. In: Stitzinger,
Ulrich / Sallat, Stephan / Lüdtke, Ulrike (Hrsg.): Sprache und Inklusion als Chance? Expertise
und Innovation für Kita, Schule und Praxis. Idstein, 255–268.
Bills, Chris (2002): Linguistic points in young children’s description of mental calculation. In:
Free Download von der Franz Steiner Verlag eLibrary am 07.06.2022 um 20:44 Uhr
Cockburn, D. Anne / Nardi, Elena (Eds.): Proceedings of the 26th Annual Conference of the
International Group for the Psychology of Mathematics, vol. 2. Norwich: University of East
Anglia, 97–104.
Deseniss, Astrid (2015): Schulmathematik im Kontext von Migration. Mathematikbezogene Vor-
stellungen und Umgangsweisen mit Aufgaben unter sprachlich-kultureller Perspektive. Wies-
baden.
Feilke, Helmuth (2012): Bildungssprachliche Kompetenzen – fördern und entwickeln. In: Praxis
Deutsch 233, 4–13.
Fend, Helmut (2008): Dimensionen von Qualität im Bildungswesen. Von Produktindikatoren zu
Prozessindikatoren am Beispiel der Schule. In: Klieme Eckhard / Tippelt Rudolf (Hrsg.): Qua-
litätssicherung im Bildungswesen. Weinheim, 190–209.
Freudenthal, Hans (1985): Muttersprache und Mathematiksprache. In: Mathematik Lehren 9, 3–5.
Gellert, Uwe (2008): Mathematikspezifische schulische Bildungssprache im Schuleingangsalter.
In: Ramseger, Jörg / Wagener, Mathea (Hrsg.): Chancenungleichheit in der Grundschule. Wi-
esbaden, 207–210.
Gibbons, Pauline (2002): Scaffolding Language, Scaffolding Learning. Teaching Second Language
Learners in the Mainstream Classroom. Portsmouth, NH.
Gogolin, Ingrid / Lange, Imke (2011): Bildungssprache und Durchgängige Sprachbildung. In: Fürs-
tenau, Sara / Gomolla, Mechthild (Hrsg.): Migration und schulischer Wandel: Mehrsprachig-
keit. Wiesbaden, 107–128.
Hammond, Jennifer / Gibbons, Pauline (2005): Putting scaffolding to work: The contribution of
scaffolding in articulating ESL education. In: Prospect Vol. 20, No. 1 April 2005, 6–30.
Häsel-Weide, Uta (2007): Sachrechnen. In: Walter, Jürgen / Wember, Franz B. (Hrsg.): Sonderpä-
dagogik des Lernens. Göttingen, 657–686.
Heppt, Birgit et al. (2012): Beherrschung von Bildungssprache bei Kindern im Grundschulalter. In:
Kurzbeiträge Diskurs Kindheits- und Jugendforschung 3, 349–356.
Klein, Helmut / Schöpper-Grabe, Sigrid (2012): Was ist Grundbildung? Bildungstheoretische und
empirische Begründungen von Mindestanforderungen an die Ausbildungsreife. Köln.
Kniffka, Garbiele (2010): Scaffolding. Online verfügbar unter: https://www.uni-due.de/imperia/
md/content/prodaz/scaffolding.pdf (19.05.2017).
Koullen, Reinhold (Hrsg.) (2013): Grundwissen für den Beruf: Mathematik. Technik. Berlin.
Krauthausen, Günter (2007): Sprache und sprachliche Anforderungen im Mathematikunterricht
der Grundschule. In: Schöler, Hermann / Welling, Alfons. (Hrsg.): Sonderpädagogik der Spra-
che. Göttingen, 1022–1034.
Krummheuer, Götz (1994): Der mathematische Anfangsunterricht: Anregungen für ein neues Ver-
stehen früher mathematischer Lehr-Lern-Prozesse. Weinheim.
Franz Steiner Verlag„Die Welt trifft sich im Klassenzimmer“ 65
Leisen, Josef (2011): Praktische Ansätze schulischer Sprachförderung – Der sprachsensible Fach-
unterricht. Online verfügbar unter: http://www.hss.de/fileadmin/media/downloads/Beric
hte/111027_RM_Leisen.pdf (19.05.2017).
Linneweber-Lammerskitten, Helmut (2014): Darstellen und Kommunizieren, Argumentieren und
Begründen, Interpretieren und Reflektieren von Resultaten. In: Linneweber-Lammerskitten,
Helmut (Hrsg.): Fachdidaktik Mathematik. Seelze, 179–200.
Maier, Hermann (1989): Sprache und Kommunikation im Mathematikunterricht. In: Die Grund-
schulzeitschrift 24, 26–29.
Maier, Hermann / Schweiger, Fritz / Reichel Hans (Hrsg.) (1999): Mathematik und Sprache. Zum
Verstehen und Verwenden von Fachsprache im Mathematikunterricht. Mathematik für Schule
und Praxis 4. Wien.
Mavruk, Gülsah / Schmidt, Eva (2016): Neu zugewanderte Kinder und Jugendliche im Unter-
richt – Ein Bericht aus der Praxis des Institutes für Deutsch als Zweit- und Fremdsprache an
Free Download von der Franz Steiner Verlag eLibrary am 07.06.2022 um 20:44 Uhr
der Universität Duisburg-Essen. In: Sonderpädagogische Förderung heute 61 (1), 50–63.
Meyer, Michael / Prediger, Susanne (2011): Vom Nutzen der Erstsprache beim Mathematiklernen.
Fallstudien zu Chancen und Grenzen erstsprachlich gestützter mathematischer Arbeitspro-
zesse bei Lernenden mit Erstsprache Türkisch. In: Prediger, Susanne / Özdil, Erkan (Hrsg.):
Mathematiklernen unter Bedingungen der Mehrsprachigkeit – Stand und Perspektiven der
Forschung und Entwicklung in Deutschland. Münster, 185–204.
Meyer, Michael / Tiedemann, Kerstin (2017): Sprache im Fach Mathematik. Wiesbaden.
Nolte, Marianne (2016): Sprache und Sprachverstehen in mathematischen Lernprozessen aus einer
mathematikdidaktischen Perspektive. In: Stitzinger, Ullrich / Sallat, Stephan / Lüdtke, Ulrike
(Hrsg.): Sprache und Inklusion als Chance? Expertise und Innovation für Kita, Schule und
Praxis. Idstein, 37–44.
Prediger, Susanne / Özdil, Erkan (2011): Mathematiklernen unter Bedingungen der Mehrsprachig-
keit. Münster.
Prediger, Susanne (2016): Zusammenspiel von Leistungsstudien, fachbezogener Entwicklungsfor-
schung und Implementation am Beispiel sprachlich bedingter Hürden beim Mathematikler-
nen. In: BMBF (Hrsg.): Bildungsforschung 2020. Zwischen wissenschaftlicher Exzellenz und
gesellschaftlicher Verantwortung, 429–435. Online verfügbar unter: http://www.mathematik.
uni-dortmund.de/~prediger/veroeff/16-BMBF-Prediger-Sprachstudien.pdf (15.12.2017).
Ruf, Urs / Gallin, Peter (1995): Ich mache das so! Wie machst du es? Das machen wir ab. Sprache
und Mathematik für das 1.–3. Schuljahr. Zürich.
Schmölzer-Eibinger, Sabine et al. (2013): Sprachförderung im Fachunterricht in sprachlich hetero-
genen Klassen. Stuttgart.
Schnotz, Wolfgang (2006): Pädagogische Psychologie Workbook. Weinheim.
Schütte, Markus (2009): Sprache und Interaktion im Mathematikunterricht an Grundschulen.
Münster.
Spreer, Markus (2014): „Schlag nach und ordne zu“. Bildungssprachliche Anforderungen im
(sprachheilpädagogischen) Unterricht kompetent begegnen. In: Sallat, Stephan / Spreer, Mar-
kus / Glück, W. Christian (Hrsg.): Sprache professionell fördern. Idstein, 83–90.
Steinbring, Heinz (2000): Mathematische Bedeutung als soziale Konstruktion im Mathematikun-
terricht. In: Journal für Mathematik-Didaktik 21, 28–48.
Tajmel, Tanja (2013): Möglichkeiten der sprachlichen Sensibilisierung von Lehrkräften naturwis-
senschaftlicher Fächer. In: Röhner, Charlotte / Hövelbrinks, Britta (Hrsg.): Fachbezogene
Sprachförderung in Deutsch als Zweitsprache. Weinheim, 198–211.
Thürmann, Eike / Vollmer, Helmut Johannes (2013): Schulsprache und Sprachsensibler Fachunter-
richt. Eine Checkliste mit Erläuterungen. In: Röhner, Charlott / Hövelbrinks, Britta (Hrsg.):
Fachbezogene Sprachförderung in Deutsch als Zweitsprache. Weinheim, 212–233.
Franz Steiner Verlag66 birgit werner / rebecca müller
Voigt, Jörg (1991): Sozial-interaktive Bedingungen der Entwicklung mathematischer Fähigkeiten
im gegenwärtigen Mathematikunterricht. In: Steiner, Hans-Georg (Hrsg.): Grundfragen der
Entwicklung mathematischer Fähigkeiten. Köln, 281–292.
Walzebug, Anke (2015): Sprachlich bedingte soziale Ungleichheit. Theoretische und empirische
Betrachtungen am Beispiel mathematischer Testaufgaben und ihrer Bearbeitung. Münster.
Werner, Birgit (2009): Dyskalkulie – Rechenschwierigkeiten: Diagnose und Förderung rechen-
schwacher Kinder an Grund- und Sonderschulen. Stuttgart.
Werner, Birgit (2017): Teilhabe durch Grundbildung. Die Förderung Benachteiligter im Sekund-
arbereich I. Stuttgart.
www.reallabor-asyl.de (08.12.2017)
Prof. Dr. Birgit Werner
Free Download von der Franz Steiner Verlag eLibrary am 07.06.2022 um 20:44 Uhr
Pädagogische Hochschule Heidelberg, Keplerstr. 87, 69120 Heidelberg, Tel.: 06221 477 182,
birgit.werner@ph-heidelberg.de
Rebecca Müller
Pädagogische Hochschule Heidelberg, Keplerstr. 87, 69120 Heidelberg, Tel.: 06221 477 180,
rebecca.mueller@ph-heidelberg.de
Franz Steiner VerlagSie können auch lesen